Laura Affolter | Rezension | 17.01.2024
Über die Deterritorialisierung von Recht
Rezension zu „Wie uns das Recht der Natur näher bringt“ von Sacha Bourgeois-Gironde
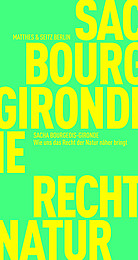
Weltweit werden Forderungen laut, Ökosystemen eigene Rechte einzuräumen. 2020 zählten Alex Putzer et al. (2022) 409 Initiativen in 39 Ländern, in denen es darum geht oder ging, der Natur an sich oder sogenannten natürlichen Entitäten wie Flüssen, Gletschern, (Regen-)Wäldern oder Lagunen subjektive Rechte zu gewähren. Zu diesen Initiativen zählten sie sowohl bereits bestehende Verfassungsrechte, Gesetzestexte, Gerichtsurteile und Verordnungen als auch noch laufende sowie gescheiterte politische und rechtliche Vorstöße auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene. So zahlreich wie die politischen und rechtlichen Ansinnen sind auch die wissenschaftlichen Publikationen. Sacha Bourgeois-Girondes politisch-programmatische Arbeit leistet einen wichtigen Beitrag zu dieser regen Debatte. Seinem Buch Wie uns das Recht der Natur näher bringt liegt ein starker Glaube an die positive schöpferische Kraft des Rechts zugrunde.
Allerdings trage das Recht nicht zwangsläufig dazu bei, den Planeten für alle bewohnbar(er) zu machen, es könne „unsere Umwelt auch unbewohnbar machen“ (S. 7). Bourgeois-Gironde gibt dem Recht eine Mitschuld an der heutigen ökologischen Krise und sucht nach einem Weg, die Beziehung zwischen Mensch und Natur juristisch anders zu definieren, sodass die Welt für alle bewohnbar bleibt. Eine Möglichkeit ist für ihn die Zuschreibung von Rechtspersönlichkeit an das, was er mal als „natürliche“, mal als „nichtmenschliche“, mal als „nicht lebende“ oder „nicht von sich aus empfindungsfähige Entitäten“ bezeichnet. Dabei scheint es ihm – im Gegensatz zu vielen Verfechter:innen der Rechte der Natur – weniger um die Verschiebung vom sogenannten Anthropo- zum Ökozentrismus zu gehen. Das eigentlich Wichtige ist in seinen Augen die „Deterritorialisierung von Recht“ (S. 46):
„Mit unseren zu Personen gewordenen Flüssen und Gletschern haben wir etwas, das diese einfache Schmitt’sche Dichotomie zwischen Raum und Territorium durcheinanderbringt. Diese geographischen Personen sind auf der Karte abgegrenzt und in Territorien verankert, und das ist auch der Grund, weshalb sie traditionell Gegenstand von Entscheidungen über Aneignung und Souveränität wurden. Aber als Personen laden sie dazu ein, dass jener Blick auf sie suspendiert wird, den Augustin Berque als ‚Stopp auf dem Objekt‘ bezeichnet hat. Wir sollten sie nicht länger als begrenzt und endlich sehen und beginnen, mit unserem Blick auf ihnen als Subjekt zu verweilen, indem wir uns fragen, was die Zwecke ihrer Existenz sind.“ (S. 48).
Ihre Deterritorialisierung sei das, was alle bisherigen Ansätze zur Personalisierung von Natur – die Gewährung von ökozentrischen Rechten, wie im Fall der Yamunotri und Gangotri Gletschern sowie den daraus entspringenden Yamuna und Ganges Flüssen in Indien, „organizistische Ansätze“, wie der Autor den Te Awa Tupua Act in Neuseeland bezeichnet, oder die Zuschreibung biokultureller Rechte im Falle des Atrato Flusses und dem amazonischen Regenwald in Kolumbien – gemeinsam hätten: Diese neuen Personen „lassen sich nicht länger besitzen und aneignen“ (S. 46), wir dürfen die Natur nicht als Ressource betrachten und behandeln.
Das Buch besteht aus sieben Kapiteln. Die ersten drei befassen sich mit spezifischen Fragen, die jeweils titelgebend sind. Kapitel 1 führt in die normative Fragestellung des gesamten Buches ein: „Wie weit (oder wie nah) soll sich das Recht von der Natur entfernt halten?“ Kapitel 2 – „Ergeben sich die Rechte der Natur aus dem Naturrecht?“ – beschäftigt sich mit dem Verhältnis von subjektiven Rechten der Natur und Naturrecht. Letzteres bezeichnet Sacha Bourgeois-Gironde als „natürliche Quelle von Normativität“, die vorjuristisch oder nichtmenschlich ist:
„Jene (dem gesetzlichen Recht) externe Quelle von Normativität liefert demnach ein anderes Kriterium für die rechtliche Legitimität als die interne Kohärenz der Aussagen und juristischen Entscheidungen, die in den Gesetzesbüchern und Sammlungen der Rechtssprechung stehen. Das Naturrecht ist nicht ausgearbeitet, es wird entdeckt und erhellt, soweit es unsere Erkenntnisgrenzen zulassen.“ (S. 18)
Im dritten Kapitel, überschrieben mit „Lässt sich vom ‚Wohl‘ unbelebter natürlicher Entitäten sprechen?“, geht es darum, welche Rolle der Begriff des Wohls spielt. Die Maximierung des Wohls nichtmenschlicher Entitäten könne, so Bourgeois-Gironde, zwar eine hilfreiche Referenz sein, um uns der Natur näherzubringen, Rechtssubjekte und Subjekte des Wohls seien aber nicht als deckungsgleich zu verstehen. Außerdem verhandelt (und verneint) der Autor die Frage, ob Entitäten empfindungsfähig sein müssen, um Anspruch auf Rechte zu haben. Das vierte Kapitel „Die neuen geographischen Personen“ vergleicht verschiede Beispiele aus der Praxis, in denen die Natur personalisiert und ihr Rechte gewährt wurden. Bourgeois-Gironde führt in die oben skizzierte Deterritorialisierung von Recht ein – via des Begriffs der „reinen geographischen Persönlichkeit“ (S. 50) – und schlussfolgert, wir seien damit „auf der angemessenen juristischen Abstraktionsebene angelangt, um die Bedingungen einer zivilrechtlichen Beziehung zwischen uns und den Entitäten der Natur auszuarbeiten“ (ebd.).
Damit leitet er über vom öffentlichen Recht ins Privatrecht. Kapitel 5 bis 7 – „Erbrechte“, „Das Exposom als Gemeingut einer neuen Art“ und „Auf dem Weg zu einem Recht der natürlichen Prozesse“ – diskutieren sodann verschiedene Werkzeuge aus dem Privatrecht, die helfen könnten, uns der Natur näherzubringen. In Kapitel 5, in dem sich Bourgeois-Gironde mit dem Erb- und Eigentumsrecht befasst, schlägt er vor, zwei gängige Floskeln wörtlich zu nehmen, nämlich, dass die Natur ein Erbe der Menschheit und die „Erde unser gemeinsames Zuhause ist“ (S. 52). Er diskutiert verschiedene Traditionen, aus denen wir dafür Lehren ziehen könnten beziehungsweise müssten: der Begriff der hereditas jacens aus dem alten römischen Recht, das Jubeljahr im talmudischen Recht und die „genealogischen Rezitationen der Maori“: die Whakapapa (S. 58).
Mithilfe des privaten Erbrechts begründet Bourgeois-Gironde auch, warum es nicht in erster Linie relevant ist, ob eine Entität als lebend begriffen wird oder nicht, um sie als Rechtsperson anzuerkennen. Er fragt: „Erben wir vom toten Körper unserer verstorbenen Angehörigen?“ (S. 59) Der tote Körper gelte im Zivilrecht klar als heilige Sache, „für die man verantwortlich ist und deren Willen man zu erkunden hat“ (S. 59). Genauso wäre auch mit der Natur zu verfahren, wenn beispielsweise ein „Kollektiv, […] in Anlehnung an die individuellen privatrechtlichen Regeln, einen Fluss vererbt“ bekäme (S. 60).
Vom Erbrecht führt uns der Autor in Kapitel 6 weiter zum Gesundheitsrecht. Hier schlägt Bourgeois-Gironde vor, genau wie bestimmte gesetzliche Regeln in Bezug auf die Manipulation des Genoms gelten, müsse es dies auch für das Exposom – alle nichtgenetischen Umwelteinflüsse, denen wir ein Leben lang ausgesetzt sind – geben. Weil sich beim Exposom keine klare Grenze zwischen Körper und Umwelt ziehen lässt – „aufgrund seiner epidemiologischen Definition [ist es] gleichzeitig ein internes Milieu unserers Körpers und ein externes Milieu“ (S. 74) –, reiche das Recht auf eine gesunde Umwelt, das viele Länder anerkennen, nicht aus, so die Argumentation Bourgeois-Girondes. Das Exposom brauche einen eigenen juristischen Status,
„der nicht nur dem Schutz der körperlichen Unversehrtheit oder dem Umweltschutz zuzuordnen wäre, denn dann würde sie [die damit geschaffene transversale Entität] in mehrere Orte juristischer Zuschreibung aufgesplittert. Sich spezifische Rechte für das Exposom vorzustellen, wäre vor allem der Versuch, eine Interaktion zwischen potenziellen körperlichen Beschwerden und Umwelteinflüssen (Strahlung, Viren etc.) zu charakterisieren. Es geht darum, den Kontakt zwischen einem Individuum und seiner Umwelt im Recht zu thematisieren.“ (S. 75 f.)
Damit kommt Bourgeois-Gironde in Kapitel 7 zu seinem letzten Punkt: Es müssten vielmehr Prozesse und weniger abgegrenzte Entitäten ins Zentrum des rechtlichen Interesses gerückt werden. Der Philosoph kritisiert die „Objekt-Ontologie“ (S. 78) der meisten bisherigen Ansätze zu Rechten der Natur und schlägt vor, die Beziehung zwischen Mensch und Natur durch eine Überarbeitung des Eigentumsrechts zu fokussieren. „Rechte der Inbesitznahme und Nutzung von Land und natürlichen Ressourcen […] könnten – bezogen auf ein Gebiet oder eine Ressource – dem Kriterium unterworfen werden, ob jeweils das Spezifische, Reproduzierbare und Stabile einer Ressource oder eines Territoriums ausreichend erhalten bleiben.“ (S. 85)
Das Buch von Sacha Bourgeois-Gironde ist herausfordernd.[1] Dies mag damit zusammenhängen, dass es insgesamt als eine „Bricolage an Ideen“[2] daherkommt: Ideen, die eingeworfen und skizziert werden, während die praktische Umsetzung offenbleibt und mögliche Hindernisse nicht thematisiert werden. Dennoch könnte das Buch für Diskussion sorgen, weil Bourgeois-Gironde an verschiedenen Stellen – wenn auch nicht sehr explizit – mit einer weitverbreiteten Aussage beziehungsweise Annahme bricht: Die Rechte der Natur würden sogenannten indigenen Weltsichten oder Ontologien entstammen.[3] Auch wenn verschiedene Autor:innen dies bereits kritisiert haben,[4] tauchen derlei Überzeugungen in der Literatur zu Rechten der Natur immer wieder auf; mitunter eher beiläufig und unreflektiert.
Weil Bourgeois-Gironde das Konzept der Rechtspersönlichkeit vom Wesen der Dinge und von menschlichen Glaubensvorstellungen über diese Dinge entkoppelt (S. 50), erscheint ihm die Frage der ideologischen oder moralisch-philosophischen Fundierung von Rechtsideen zunächst zweitranging. Er entwickelt eine eigene Vorstellung vom Wesen des Rechts und plädiert für ein „juristisches Idiom“, das „sich an natürliche Entitäten heften kann, ganz gleich, was man über sie denkt“ (S. 13). Im Umkehrschluss bedeute dies aber nicht – so seine Argumentation –, dass im Nachhinein „[d]ie Vorstellung einer reinen geographischen Persönlichkeit […] [nicht] auf Entitäten ausgedehnt werden [kann], die in Territorien, in menschliche Glaubensvorstellungen und Interessen, in administrative und politische Geographien eingebunden sind, sobald es gelungen ist, sie aus diesen mithilfe der juristischen Fiktion herauszulösen“ (S. 50).
Fußnoten
- Diesen Leseeindruck teilt Milos Vec, Was verschafft dem Gletscher Achtung? [4.12.2023], in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22.8.2023.
- Ebd.
- Siehe Frank Adloff / Iris Hilbrich, Practices of Sustainability and the Enactment of Their Natures/Cultures. Ecosystem Services, Rights of Nature, and Geoengineering, in: Social Science Information 60 (2021), 2, S. 168–187; Craig Kauffman / Pamela Martin, Can Rights of Nature Make Development More Sustainable? Why Some Ecuadorian Lawsuits Succeed and Others Fail, in: World Development 92 (2014), S. 130–142; Stefan Knauβ, Conceptualizing Human Stewardship in the Anthropocene. The Rights of Nature in Ecuador, New Zealand and India, in: Journal of Agricultural and Environmental Ethics 31 (2018), 6, S. 703–722.
- Siehe Mihnea Tanasescu, Understanding the Rights of Nature. A Critical Introduction, Bielefeld 2022; Lieselotte Viaene, Can Rights of Nature Save Us from the Anthropocene Catastrophe? Some Critical Reflections from the Field, in: Asian Journal of Law and Society 9 (2022), 2, S. 187–206.
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Henriette Liebhart.
Kategorien: Normen / Regeln / Konventionen Ökologie / Nachhaltigkeit Recht
Empfehlungen
Die Möglichkeit der Normen
Ein Buchforum in Kooperation mit theorieblog.de und voelkerrechtsblog.com
Hinterfragt – Der Ethik-Podcast
Entscheidungen über das Verhalten werden oft sekundenschnell getroffen: erst im Gespräch, das Situation, Optionen und Gründe auseinanderdividiert, ergeben sich ethische Alternativen.
Beings From the Mud
Donna Haraways Arbeiten zu einer relationalen Ontologie
