Nina Reiners | Rezension | 11.01.2022
Alles für die gute Sache
Rezension zu „ Privileged Precarities. An Organizational Ethnography of Early Career Workers at the United Nations“ von Linda Martina Mülli
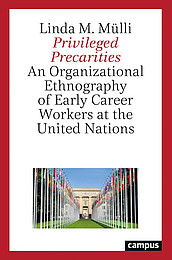
Integrity, Professionalim, Respect for Diversity – das sind die Werte, die (zukünftige) Mitarbeiter*innen der Vereinten Nationen (im Folgenden abgekürzt: UN) verinnerlicht haben sollten. Alle, die schon einmal die Karriereseiten der UN angeklickt oder deren Auswahlverfahren durchlaufen haben, kennen diesen Dreiklang und haben sich womöglich Gedanken über die damit verbundenen Kompetenzen gemacht. Die Aussicht, als Teil der UN sinnvolle Arbeit zu leisten, sorgt dafür, dass Interessent*innen häufig schon früh beginnen, ihr potenzielles Leben als internationale*r Bürokrat*in vorzubereiten und sorgfältig zu planen. Wem der berufliche Einstieg bei der Weltorganisation geglückt ist, der befindet sich allerdings erst einmal in kurzfristigen und häufig nur geringfügig bezahlten Beschäftigungsverhältnissen und hat wenig Chancen auf eine langfristige UN-Karriere.
Warum nehmen so viele early career workers das spezifische UN-Prekariat in Kauf? Die Frage untersucht Linda M. Mülli in ihrem exzellenten Werk Privileged Precarities, in dem sie ihren Leser*innen einen Einblick in die Lebenswelt des Homo UN ermöglicht, wie sie ihre Forschungssubjekte treffend bezeichnet. Die ethnografische Studie nimmt vor allem die Arbeits- und Lebensrealität (wobei die Interviewpartner*innen hier kaum unterscheiden) der UN-Mitarbeiter*innen in den Hauptquartieren in Genf und Wien in den Blick. Mülli konzentriert sich auf Personen, die am Beginn einer möglichen Karriere stehen, also vor allem Praktikant*innen, Consultants, Junior Professional Officers (JPOs) und Mitarbeiter*innen auf den P-2 Einstiegspositionen der UN, die zwei Jahre Berufserfahrung voraussetzen und ebenfalls überwiegend befristet sind.
Das Buch besteht aus sieben Kapiteln, die eingebettet sind in einen Prolog und einen Epilog. Die Autorin führt zunächst in ihre Arbeit bei der Weltorganisation und ihr Forschungsdesign ein und beleuchtet das ethnografische Feld, in das sie sich mit ihrer Untersuchung der drei UN-Standorten begibt (Kapitel 2), um anschließend ihre methodischen Überlegungen zur Forschung über early career workers vorzustellen (Kapitel 3). In den verbleibenden Kapiteln stellt Mülli ihre Beobachtungen in größere theoretische Zusammenhänge. Die (in-)formelle Organisationskultur der UN verknüpft sie mit der Analyse der ritualisierten Praktiken und Interaktionen der kurzfristig Beschäftigten (Kapitel 4). Pierre Bourdieus Homo academicus nutzt sie, um den Habitus der UN-Angestellten als Homo UN zu konzeptualisieren (Kapitel 5). Schließlich fasst sie ihr empirisches Material unter dem titelgebenden Begriff des „privilegierten Prekariats“ zusammen, um die ambivalente Situation der early career professionals bei der UN zu verdeutlichen (Kapitel 6). Das Buch ist damit eine wichtige Quelle, um die oftmals ernüchternde Arbeitsrealität und die persönliche Arbeitsmotivation gut ausgebildeter, junger professionals besser zu verstehen.
Institutionelle Erwartungen und subjektive Motivationen
Linda Mülli will wissen, was early career workers in der UN angesichts prekärer Beschäftigungsverhältnisse und mangelnder Perspektiven motiviert – eine Frage, die sie vor allem auf Basis der Selbstbeschreibungen ihrer 20 Interviewpartner*innen beantwortet. Die Auswertung der Gespräche bildet das Herzstück der empirischen Analyse. Vignetten, in Form von field notes, führen anschaulich in jedes Kapitel des Buches ein. Sie selbst befindet sich in einer Doppelrolle: Als UN-Praktikantin ist sie Teil der workforce, als Doktorandin beobachtet sie die Organisation und ihre (temporären) Mitarbeiter*innen. Zusätzlich nimmt sie an Führungen durch die Hauptquartiere teil, um einen „tourist gaze“ (S. 39) auf die UN zu bekommen. Bei der Auswertung ihres Materials kombiniert Mülli die eigenen Innen- und Außensichten gewinnbringend und reflektiert ihre jeweilige Position. Sie untersucht die „intertwined professional and personal backgrounds of international civil servants with a transnational mobility approach“ (S. 24). Um den Homo UN nicht nur empirisch, sondern auch theoretisch zu fassen, stützt sie sich auf eine beeindruckende Fülle an Literatur aus der Organisationsanthropologie, der Anthropologie der Arbeit, der Biografie- und der Mobilitätsforschung, deren teils komplexe Annahmen sie jederzeit verständlich vorstellt.
Wie Mülli in ihrem Buch eindrücklich herausarbeitet, sind sich die Angehörigen des privilegierten Prekariats ihrer Situation sehr wohl bewusst. Einmütig bezeichnen sie die Beschäftigungspolitik der UN als falsch und heuchlerisch, immerhin setzt sich die Organisation unter anderem für faire Arbeitsbedingungen in der ganzen Welt ein. Gleichzeitig versuchen alle Informant*innen, die eigene, individuelle Motivation als „unique“ gegenüber der der anderen abzugrenzen und sie damit als besonders zu kennzeichnen. Dabei nehmen die Mitarbeiter*innen in den country offices ihre Kolleg*innen in den Hauptquartieren bereits als andersartig wahr – allerdings nicht gerade im positiven Sinn. So erzählt ein JPO über seine peers in Wien und Genf, diese seien „not real UN people [...]; they are just doing it for lifestyle“ (S. 104).
Die Autorin ist mit der in Interviews unvermeidlichen Gleichzeitigkeit von „counter narratives“ keineswegs überfordert, sondern interpretiert die „orchestrated practices of telling and presenting oneself“ (S. 175) auch als Folge der berühmten Recruitment-Prozesse der UN. Denn weil die Auswahlverfahren mittlerweile derart standardisiert seien, bedienten sich auch die Bewerber*innen der immer gleichen Codes. Diejenigen, die nicht in die Raster passten, scheiterten schon früh. Aus organisationssoziologischer Sicht birgt dies meines Erachtens ein nicht geringes Risiko für den für internen Wandel: Immerhin haben die mehr oder weniger jungen Einsteiger*innen das größte Potenzial, die Institution zu verändern – umso entscheidender ist eine diverse Zusammensetzung dieser Gruppe. Daher frage ich mich: Wie kann eine Reform der UN möglich sein ohne neue, kritische Perspektiven der eigenen Mitarbeiter*innen auf ihre Arbeit? Die Forschung zur Global Governance hat in diesem Zusammenhang immer wieder auf die wichtige Rolle der boundary work durch international civil servants hingewiesen.
Privileged Precarities schließt ein Forschungsdesiderat in den Untersuchungen sowohl zu den Vereinten Nationen im engeren wie auch zu internationalen Organisationen im weiteren Sinne. So fragen Analysen internationaler Bürokratien zwar zunehmend nach der Zusammensetzung des staff, allerdings lassen sie dabei häufig Fragen der Motivation außer Acht. Oder sie nehmen die Zusammensetzung des staff als bereits gegeben an, ohne sich weiter mit dessen Zustandekommen zu befassen.
Beschreibung des Homo UN
Diversität, so macht Müllis Studie deutlich, wird in der UN hauptsächlich über die Kategorien Gender und Herkunft hergestellt, andere Unterschiede (class, economic and social capital) gibt es nicht – und kann es nicht geben. Gerade in den Schweizer und österreichischen Hauptquartieren gelten aufgrund des Schengen-Raumes sogenannte passport privileges. Die Möglichkeit, Homo UN zu werden und zu bleiben, hängt eben auch zu einem großen Teil vom Reisepass und einer sozialen Absicherung durch das (familiäre) Umfeld ab. Denn gerade am Anfang der Karriere ist es entscheidend, sich zwischen den Verträgen im jeweiligen Land aufhalten zu können und somit auf Abruf bereit zu sein (S. 239). Man muss sich also nicht nur kurze bis längere Phasen der Beschäftigungslosigkeit leisten können, sondern aufgrund eines (europäischen) Passes auch mehr oder weniger permanent vor Ort verfügbar sein. Damit macht Müllis Studie einmal mehr klar, dass der Einstieg in die UN vor allem denen vorbehalten ist, die aus gesicherten und häufig kosmopolitischen Milieus stammen.
Es geht hauptsächlich darum, die Organisationskultur der UN überzeugend – und möglichst schlagkräftig – wiederzugeben: „Having ‚anything‘ to say seems to be the dominant position rather than adding value to a debate.“ (S. 185)
Der Homo UN setzt sich zusammen aus Symboliken, Ritualen und visuellen Praktiken, die wiederum wichtig sind für den Fortbestand der Organisation selbst. Mülli versteht die UN als „a work environment where immaterial assets such as knowledge, networks, information or communication as well as emotional experience, are not only produced but also desired by its employees“ (S. 295). Es geht darum, die Codes schon zu kennen, schnell zu lernen, richtig zu lesen und überzeugend zu verkörpern. Anknüpfend an Bourdieu: Wer hat den UN-Habitus wann und wo gelernt? Kann er überhaupt erlernt werden oder muss das soziale Kapital schon vor dem Einstieg in die Organisation vorhanden sein? Die Interviews lassen keinen Zweifel an der Relevanz des sozialen und kulturellen Kapitals. Es bestimmt schon lange vor dem Einstieg in die Arbeitswelt über die Möglichkeit des Zugangs und ist essenziell, um im System UN zu bestehen. Nach Aussage der Gesprächspartner*innen Müllis herrscht im Arbeitsalltag eine „performative culture“ (S. 185), das heißt, es geht hauptsächlich darum, die Organisationskultur der UN überzeugend – und möglichst schlagkräftig – wiederzugeben: „Having ‚anything‘ to say seems to be the dominant position rather than adding value to a debate.“ (ebd.) Wer einen Anschlussvertrag erhalten will, muss schließlich in Meetings auf sich aufmerksam machen. Es bleibt die Frage, wie die individuellen Narrative durch die Struktur der Weltorganisation bedingt werden.
Mülli attestiert der UN eine moralische Pflicht, ihre Mitarbeiter*innen fair zu beschäftigen. Die Forschung zu internationalen Institutionen bestätigt sie in dieser Forderung: Nur wenn die UN ihre Werte auch als Arbeitgeberin überzeugend umsetzt, kann sie als internationale Organisation Anerkennung und Legitimation erwarten. Warum hält die UN dennoch seit Jahren an den prekären Beschäftigungsmodellen fest? Hierzu nimmt das Buch leider keine Stellung, weshalb weiterführend interessierte Leser*innen einen Blick in die Forschung zu globaler Ungleichheit in und durch internationale Institutionen werfen müssen.
Nach Aussage der Autorin soll die Studie die gegenwärtige Selbstwahrnehmung der Informant*innen abbilden; darüberhinausgehende Verallgemeinerungen will Mülli dezidiert vermeiden (S. 132). Auch wenn das Buch es schafft, dass die Leser*innen Parallelen zu anderen Phänomenen aus den Arbeitsrealitäten gut ausgebildeter, motivierter und mobiler junger Menschen ziehen, wäre der ein oder andere Blick Müllis über den Tellerrand der UN durchaus wünschenswert und – der Qualität ihrer Arbeit nach zu urteilen – erkenntnisreich gewesen.
Ein Generationenproblem?
Während sie sich im Hier und Jetzt von einem befristeten Vertrag zum nächsten hangeln, nehmen Müllis Informant*innen für den Traum von einer erfüllenden und sinnhaften Arbeit Kredite auf und kellnern nach ihrem eigentlichen Arbeitstag noch in Wiener Bars. Das Buch leistet damit eindeutig einen Beitrag zum Verständnis des „double-edged sword of intrinisic motivation and readiness for self-exploitation for a ‚good cause‘“ (S. 295). Hier zeigt sich die Anwendbarkeit und Übertragbarkeit der Erkenntnisse aus Müllis Arbeit: Nicht nur die early career workers, sondern auch die young academics kämpfen um ihre individuelle Agency inmitten des privilegierten Prekariats. Mülli entwickelt den Homo UN in Anlehnung an Bourdieus Homo academicus, der erst vor Kurzem wieder unter dem Hashtag #ichbinHanna zum Ausdruck kam. Eine weitere Parallele ist die zunehmende Ökonomisierung der jeweiligen Institution – bei der UN die Kooperationen mit der Privatwirtschaft, bei der Wissenschaft die Abhängigkeit von Drittmitteln.
Aber besteht die Handlungsmacht der Betroffenen nur darin, dass sie sich – wohlgemerkt zusätzlich zur eigentlichen Arbeitszeit und natürlich unentgeltlich – gegen die eigene Prekarisierung engagieren? Angesichts der Wucht, mit der #ichbinHanna und #ichbinReyhan die individuellen Umstände, Geschichten und Erfahrungen prekärer akademischer Beschäftigung in Deutschland öffentlich gemacht haben, stellt sich die Frage, inwieweit wir es hier womöglich mit einem spezifischen Generationenproblem (der aktuell 30- bis 40-jährigen) zu tun haben. Es spricht einiges dafür, dass sich der sogenannte Nachwuchs weiterhin und zahlreich für die gute Sache ausbeuten lässt. Vielleicht müssen sich aber auch die UN und die hiesige Hochschullandschaft angesichts attraktiver Alternativen in der freien Wirtschaft mittelfristig auf Rekrutierungsprobleme einstellen.
Müllis eindrückliche Darstellung und Aufbereitung der Gegebenheiten in der UN lassen die Leserin unweigerlich die eigenen Privilegien, aber auch die eigene Bereitschaft zu prekärer Arbeit prüfen.
Die scharfe Beobachtung und genaue Beschreibung der Arbeitsrealitäten in den UN-Headquartern und die Leichtigkeit, mit der Mülli ihre Erkenntnisse theoretisch unterfüttert, machen Privileged Precarities zu einem unverzichtbaren Werk, vor allem auf den Leselisten all derjenigen, die sich mit der UN als Forschungsobjekt oder als Arbeitgeberin beschäftigen. Was das Buch so besonders macht, ist, dass Müllis eindrückliche Darstellung und Aufbereitung der Gegebenheiten in der UN die Leserin unweigerlich die eigenen Privilegien, aber auch die eigene Bereitschaft zu prekärer Arbeit prüfen lassen. Und so bleibt uns am Ende der Lektüre die grundsätzliche Reflexion überlassen, ob es gerechtfertigt ist, dass wir für eine idealistische Arbeit – sei es in der UN, bei einer NGO oder an den Universitäten – das privilegierte Prekariat in Kauf nehmen. Und, wenn ja, wie lange sich unter diesen Arbeits- und Lebensbedingungen die hehren Ziele von Integrität, Professionalität und Respekt für Diversität als Werte in unserer Arbeit überhaupt aufrechterhalten lassen.
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Henriette Liebhart.
Kategorien: Arbeit / Industrie Globalisierung / Weltgesellschaft Gruppen / Organisationen / Netzwerke Wissenschaft
Zur PDF-Datei dieses Artikels im Social Science Open Access Repository (SSOAR) der GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gelangen Sie hier.
Empfehlungen
Prototyp der wirtschaftswissenschaftlichen Großforschung
Rezension zu „Primat der Praxis. Bernhard Harms und das Institut für Weltwirtschaft 1913–1933“ von Lisa Eiling
Made in Germany
Rezension zu „Dreihundert Männer. Aufstieg und Fall der Deutschland AG“ von Konstantin Richter
Frieden als Prozess
Rezension zu „Über Kriege und wie man sie beendet. Zehn Thesen“ von Jörn Leonhard
