Sebastian Dute | Rezension | 12.04.2022
Der Antagonismus der Partikularwillen
Rezension zu „Das politische Bewusstsein“ von Geoffroy de Lagasnerie
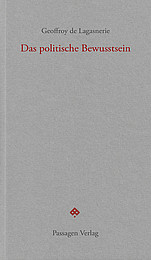
Gerade die Klassiker der Politischen Theorie leben von mythischen Erzählungen: Thomas Hobbes lässt mit dem Leviathan bekanntlich ein Seeungeheuer über die Einhaltung der Gesetze wachen, bei John Rawls trennt ein geheimnisvoller Schleier des Nichtwissens die Menschen von ihrer zukünftigen gesellschaftlichen Stellung und schon in der aristotelischen Polis herrscht mit dem zoon politikon eine ganz und gar eigenartige Kreatur. Wie einem Vertreter*innen der Zunft jedoch schnell versichern, stehen hinter solchen Figuren handfeste Konzepte, mit denen sich unser politisches Zusammenleben beschreiben und gestalten lässt. Und tatsächlich treten in den kanonischen Schriften an die Stelle der Dichtungen alsbald Begriffe wie „Gesellschaftsvertrag“, „Staatsbürger“ oder „Volkssouveränität“. Was aber, wenn diese Termini genauso wenig mit der Realität korrespondieren wie die Geschichten und Figuren, die zu ihrer Veranschaulichung dienen sollen? Die provokante Antwort von Geoffroy de Lagasnerie: Dann wären wir im Grunde nie politisch gewesen.
De Lagasneries neues Buch trägt den Titel Das politische Bewusstsein und liegt nach der französischen Erstveröffentlichung 2019 nun in deutscher Übersetzung vor. Darin will der Pariser Philosoph und Soziologe, der sich selbst einmal als „radicalisateur“ bezeichnete,[1] unsere politische Sprache nicht nur analysieren, sondern regelrecht transformieren. Sie sei bevölkert von totalisierenden Kategorien, mystifizierenden Narrativen und allzu abstrakten Begriffen, die einem dezidiert „soziologischen Blick auf die Wirklichkeit“ (S. 20) nicht standhielten und verzerrend wirkten. Das ausgegebene Ziel des Buches ist somit ein „realistisches Verständnis unserer politischen Lage und unseres Verhältnisses zum Staat, zum Gesetz, zu uns selbst und den anderen“ (S. 37).
Eine reduktionistische Theorie der Politik
Dafür arbeitet de Lagasnerie im ersten Teil die methodischen Grundzüge einer reduktionistischen Theorie der Politik heraus, die die verzerrenden Abstraktionen der traditionellen Schriften zugunsten stichhaltiger Beschreibungen der politischen Wirklichkeit verabschieden soll. Gewissermaßen als Ursünde der mythologischen Formen im modernen politischen Denken macht er die Vertragstheorie des schon genannten Hobbes aus, in der die Menschen aus Furcht vor Schädigung durch die anderen ein staatliches Gemeinwesen errichten und dessen Oberhaupt dazu autorisieren, sie zu regieren. De Lagasneries Einwand gegen Hobbes’ Konzeption, in der die politische Herrschaft auf einem Akt der Anerkennung durch die Beherrschten beruht: Da es der Unterwerfung niemals explizit zugestimmt habe, stehe das politische Subjekt in Wahrheit in keinerlei konstitutivem Zusammenhang mit der herrschenden Ordnung. Dass Hobbes seine Herleitung der Staatsmacht obendrein als historisch-empirische Beobachtung ausgebe, mache aus seiner politischen Theorie einen Trick zur Legitimation staatlicher Souveränität. Dabei löst de Lagasneries Rekonstruktion das Werk des Vertragstheoretikers allerdings aus seinem historischen Kontext des englischen Bürgerkriegs und der Kolonialisierung Nordamerikas vollends heraus und unterschlägt zudem dessen Beteuerung, Naturzustand und Vertragsschluss seien theoretische Konstruktionen zur Erklärung der Gemeinschaftsbildung.
Anstatt von den Subjekten zu verlangen, ihre soziale Stellung und persönlichen Interessen aufzugeben, um sich auf eine abstrakte Allgemeinheit zu verpflichten, muss eine realistische Analyse der Politik politische Phänomene auf ihre soziale Wirklichkeit reduzieren.
Für de Lagasnerie hat Hobbes „Gewohnheiten und Reflexe“ (S. 21) in den Diskurs eingeführt, die unser Nachdenken über Politik noch heute prägen, unter anderem indem sie einen scheinbar autonomen Diskurs konstituieren, der sich von sozialen, ökonomischen und moralischen Realitäten abgekoppelt glaube.[2] Anstatt von den Subjekten zu verlangen, ihre soziale Stellung und persönlichen Interessen aufzugeben, um sich auf eine abstrakte Allgemeinheit zu verpflichten, müsse eine realistische Analyse der Politik politische Phänomene auf ihre soziale Wirklichkeit reduzieren. Dazu bedürfe es einer theoretischen Sprache, die in der Lage sei, „den Abstand zwischen den Wörtern und den Dingen zu beseitigen“ (S. 38). Für de Lagasnerie bedeutet sein Programm, das sprachphilosophisch etwas reaktionär anmutet, die mystifizierenden Abstraktionen des politischen Diskurses einzutauschen gegen reale Abstraktionen, „die auf gültigen sozialen Kräften und ontologischen Kriterien basieren“ (S. 84). Stichhaltig seien nur solche Begriffe, die von handfesten sozialen Antagonismen im Inneren jeder Ordnung ausgehen und diese nicht verschleiern oder harmonisieren: „Es gibt soziale Identitäten, ausgeübte Macht, Herrschaftssysteme. Es gibt soziale Klassen, Minderheiten, Fraktionen. Aber es gibt nichts, das darüber hinausgeht. Es gibt kein Staatswesen, keinen Bürger, keine Gemeinschaft. Wir sind nichts anderes als das, was wir sind.“ (S. 62)
Damit scheint de Lagasnerie für einen ziemlich ungenierten soziologischen Positivismus zu werben, der dem politischen Diskurs die Wahrheit über sich selbst sagen soll. Und gegen allzu idealistische Theorien der Politik und des Politischen, die keinen Bezug zur sozialen Praxis haben und sich in scholastischen Spielereien verlieren, kann man sein Plädoyer durchaus unterstützen. Äußerst fraglich bleibt jedoch, ob derartige Verzerrungen wirklich der gesamten Denktradition inhärent und ihre Begriffe damit strukturell zur Mystifizierung verdammt sind. Ebenso kann man de Lagasnerie nur beipflichten, wenn er darauf pocht, „die politischen Institutionen als Teil des Spiels sozialer Kräfte und ihrer Konflikte zu begreifen“ (S. 46). Doch fragt man sich gleichzeitig, wer denn im Gegenzug einen so radikalen „Autonomismus“ (ebd.), der die Politik als vollkommen isolierte Sphäre begreift, tatsächlich vertritt – die zur Beweisführung herangezogenen Autor*innen (neben den genannten unter anderen Carl Schmitt und Hannah Arendt) tun es bei genauerem Hinsehen jedenfalls nicht.
Staat und Subjekt
Im zweiten Teil des Buches treten die Vorzüge und Grenzen von de Lagasneries reduktionistischem Ansatz, den er zunächst am Untersuchungsgegenstand des Staates veranschaulicht, noch deutlicher zutage. Für den soziologischen Blick auf die Wirklichkeit steht hier Léon Duguit Pate. In Duguits Untersuchung vom Beginn des 20. Jahrhunderts besteht der Staat lediglich aus den in ihm handelnden Individuen, das heißt aus den Regierenden, die anderen Individuen unter Androhung materiellen Zwangs ihren Willen aufdrängen.[3] Hieran anknüpfend sind politische Beziehungen für de Lagasnerie in letzter Instanz nicht mehr und nicht weniger als interindividuelle Verhältnisse. Im Falle einer Konfrontation mit der Ordnung bleibe nach Abzug der institutionellen Vermittlungen nur noch der irreduzible Antagonismus verschiedener Partikularwillen – mit der entscheidenden Besonderheit, „dass der eine [Partikularwille] es geschafft hat, Gesetz zu werden, sich des repressiven Staatsapparats zu bemächtigen, um sich mir aufzuzwingen“ (S. 93).
De Lagasneries dezisionistische Auffassung des politischen Geschehens, mit der er sich gegen idealisierende Vorstellungen von Staatsgewalt ausspricht, birgt Inkonsistenzen und Nachteile. Zum einen ist nicht einzusehen, warum eine dezidiert soziologische Perspektive ausgerechnet das Individuum und seinen Einzelwillen als gegeben hinnehmen soll. Zwar weist de Lagasnerie den Verdacht des Individualismus von sich, wenn er die soziale Logik betont, die in der politischen Praxis der Individuen am Werk sei. Über einen vagen Verweis auf deren „ethische[] und soziale[] Orientierungen“ (S. 96) beziehungsweise ihre „moralischen, wirtschaftlichen usw. Überlegungen“ (S. 132) geht sein Bekenntnis jedoch nicht hinaus. Zum anderen fällt de Lagasnerie hinter wesentliche Einsichten namentlich der materialistischen Staatstheorie zurück, wenn er den Staat definiert als „Apparat […], dessen sich Partikularwillen bedienen, um sich durchzusetzen“. (S. 92) In diesem repressiv-instrumentellen Verständnis fallen Staatsapparat und -herrschaft in eins, was die Analyse staatlicher Macht unnötig verkürzt.[4]
Für de Lagasnerie liegt die genuin politische Erfahrung gerade nicht im Handeln, sondern ist vielmehr eine „erlittene Interaktion“ (S. 110).
Eine überzeugendere Neubestimmung gelingt de Lagasnerie mit seiner Skizze einer Theorie der Subjektivierung, die implizit an die diesbezüglichen Konzeptionen von Louis Althusser und Jacques Rancière anknüpft. Auch im Verhältnis des Subjekts zur politischen Ordnung vermutet er ein „vertragstheoretisches Unbewusstes“ (S. 138): Das politische Subjekt trete in den kanonischen Texten zumeist als ein aktives und tätiges auf, das nicht nur Verträge schließt, sondern auch an Debatten und Abstimmungen teilnimmt, auf der Straße demonstriert oder eine Revolution anzettelt. Für de Lagasnerie liegt die genuin politische Erfahrung aber gerade nicht im Handeln, sondern ist vielmehr eine „erlittene Interaktion“ (S. 110). Da persönliche Neigungen nur selten mit der Regierungspraxis übereinstimmten, bestünden die politischen Verhältnisse aus Konfliktsituationen, in denen die Rechtsordnung dem Subjekt einen Willen aufzwinge, der ihm fremd sei.
Das lenkt die Aufmerksamkeit von den repräsentativen Orten der Politik auf die Randbereiche der sozialen Welt, an denen de Lagasnerie das politische Subjekt par excellence lokalisiert: Der „von der Polizei festgenommene Mensch“ (S. 112) verdeutlicht die Kluft zwischen dem persönlichen und dem Gesetz gewordenen Willen, weshalb ihn der Autor zum Ausgangspunkt der Reflexion über Politik erklärt. Zur paradigmatischen Szene der politischen Subjektivierung macht er den buchstäblichen Schlag des Polizisten oder der Polizistin. In dieser Extremform hat die politische Erfahrung ein unverkennbar leibliches Moment, die Einschränkung von außen wird als physischer Zwang spürbar. Auch wenn Gewalterlebnisse dieser Art das eigentliche Wesen der Politik am anschaulichsten zeigen, so sei die ihnen zugrunde liegende politische Erfahrung – die „Tatsache, immer festgenommen werden zu können“ (S. 114, meine Herv., S.D.) – trotz gradueller Unterschiede allgemeingültig. Schließlich seien wir alle qua Geburt auf ein Staatsgebiet geworfen, mit einer Nationalität versehen und einem Gesetz untertan gemacht.
Negativismus
Die „Äußerlichkeit des Subjekts vor der Rechtsordnung“ (S. 121) spitzt de Lagasnerie in der Folge weiter zu. Angeleitet von den politischen Analysen der Black Panther Party, in deren spezifischer historischer Erfahrung er ein Wesensmerkmal des Politischen ausmacht, definiert er die politischen Beziehungen als „Beziehungen zwischen Kolonisatoren und Kolonisierten“ (S. 127). Im Konflikt mit der Rechtsordnung erfahre sich das Subjekt, so de Lagasneries kühne Pointe, als besetztes Gebiet, „das die Legitimität der Annexion nicht anerkennt, die andere durch den Staat […] vollziehen“ (ebd.). Ausgehend von der äußersten Äußerlichkeit der Kolonie unterzieht de Lagasnerie weitere Begriffe einer Relektüre. Das Gesetz etwa erscheint dem reduktionistischen Blick als ein „Dispositiv[], das einigen bestimmten Individuen Macht verleiht, die, weil sie bestimmte Positionen besetzen, sich seiner bedienen, um ihre ethischen Entscheidungen und Orientierungen durchzusetzen“ (S. 104); Souveränität zeige sich konsequenterweise als die „Verfügbarkeit der Rechtsordnung für die Ausübung einer spezifischen Herrschaft“ (S. 105).
Gerade in der Diskussion der theoretischen Grundbegriffe, zu denen im Laufe des Buches auch der zivile Ungehorsam und die Unterscheidung zwischen legitimer und illegitimer Gewalt treten, wird der strategische Einsatz des Buches am deutlichsten. Die neue Sprache, die de Lagasnerie zur wahrheitsgetreuen Erfassung politischer Phänomene anstrebt, soll nicht zuletzt denjenigen präzisere Werkzeuge an die Hand geben, die die bestehende Ordnung in der Praxis anfechten. Um die eigene Stellung in der sozialen Wirklichkeit zu erkennen und die politischen Verhältnisse richtig zu erfassen, müsse man zunächst die dezisionale Logik Letzterer anerkennen:
„Politisches Handeln bedeutet Gewaltausübung gegenüber anderen Individuen, mit denen wir gegen unseren Willen und gegen den ihren zusammenleben und die Grund haben, die Legitimität unseres Willens nicht anzuerkennen.“ (S. 181)
Daher müsse die politische Grundfrage eine Selbstverständigung darüber sein, welche (staatlichen) Mittel zur Konfliktaushandlung man selbst zu rechtfertigen bereit sei.
Für die theoretische Diskussion wiederum sind de Lagasneries Ausführungen dort am ertragreichsten, wo er für eine Art politiktheoretischen Negativismus plädiert, der nicht den ideellen Regelfall der pflichtbewussten Bürgerin und des funktionierenden Gemeinwesens an den Anfang der Reflexion stellt. Das Wesen und die Funktionsweise einer politischen Ordnung sind mit de Lagasnerie ausgehend von den Momenten der Störung und Verweigerung zu denken, die die Kluft zwischen nicht miteinander übereinstimmenden Partikularwillen sichtbar machen: „Wir müssen vom Verbrechen und vom Verbrecher ausgehen, von seiner Subjektivität und seinem Leben, um einen Begriff des Gesetzes, des Rechts und des Staats zu konstruieren.“ (S. 112) Immer wieder lenkt de Lagasnerie den Blick aber auch auf eine weniger drastische Form der Uneinigkeit, nämlich die Untätigkeit. Er thematisiert nicht zuletzt die Erfahrung derjenigen Subjekte, die das politische Geschehen, dem sie unterworfen sind, mit einer Mischung aus Indifferenz und Resignation aus der Ferne beobachten und es schlicht hinnehmen – die also „einfach da sind“ (S. 141).
Dass die Wirklichkeit der politischen Erfahrung im Regelfall einer eher passiven Logik gehorcht, die sich auf verschiedene Weisen ausdrücken kann, ist die wohl produktivste Anregung des Buches. De Lagasneries negativistische Neubestimmung des politischen Subjekts als „Zuschauer/Besetztes-Gebiet“ (S. 146) ernst zu nehmen, könnte für die theoretische Reflexion über Politik durchaus lohnend sein – aller Provokationen zum Trotz.[5]
Fußnoten
- Dia-logues Podcast, Dia-logues#03 – Geoffroy de Lagasnerie – L’intégral [15.2.2022], 15.11.2019.
- Dies gilt de Lagasnerie zufolge sogar für in emanzipatorischer Absicht entworfene Theorien, die den fiktiven Charakter der politischen Kategorien durchaus in Rechnung stellen, wie die radikale Demokratietheorie von Chantal Mouffe und Ernesto Laclau. Vgl. dies., Hegemonie und radikale Demokratie. Zur Dekonstruktion des Marxismus, hrsg. und übers. von Michael Hintz und Gerd Vorwallner, Wien 1991; Ernesto Laclau, On Populist Reason, London / New York 2005.
- Léon Duguit, L’état. Le droit objectif et la loi positive [1901], Paris 2003.
- Wenn etwa Louis Althusser andere Institutionen der bürgerlichen Gesellschaft wie die Schule oder die Kirche als ideologische Staatsapparate in seine Untersuchung miteinbezieht, so operiert auch er mit sehr abstrakten Ideen, die es aber dennoch schaffen, ihren Gegenstand zu entmystifizieren. Ders., Ideologie und ideologische Staatsapparate [1970], in: ders., Ideologie und ideologische Staatsapparate, 1. Halbbd., hrsg. von Frieder Otto Wolf, Hamburg 2010, S. 37–102.
- Der Diskussion mit den Teilnehmer*innen des Forschungskolloquiums Sozialphilosophie von Prof. Martin Saar an der Goethe-Universität Frankfurt am Main verdankt diese Rezension hilfreiche Hinweise und Anregungen.
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Henriette Liebhart.
Kategorien: Demokratie Gesellschaftstheorie Gewalt Politische Theorie und Ideengeschichte Psychologie / Psychoanalyse Staat / Nation
Zur PDF-Datei dieses Artikels im Social Science Open Access Repository (SSOAR) der GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gelangen Sie hier.
Empfehlungen
Existenzfragen der Demokratie
Rezension zu „Über Freiheit“ von Timothy Snyder
Die Personifizierung der Krise
Rezension zu „Die konformistische Revolte. Zur Mythologie des Rechtspopulismus“ von Leo Roepert
Sebastian Dute, Hans Cord Hartmann
Fit für die Zukunft
Bericht von der Tagung „Transformationen des Politischen. Radikaldemokratische Theorie für die 2020er Jahre“ vom 20. bis 22. Oktober 2022 am Freiburger Institute for Advanced Studies
