Christian Dayé | Rezension | 15.05.2023
Der Nachhall französischer Kolonialsoziologie
Rezension zu „The Colonial Origins of Modern Social Thought. French Sociology and the Overseas Empire“ von George Steinmetz
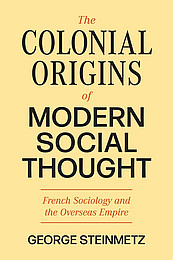
Das zu besprechende Buch, The Colonial Origins of Modern Social Thought. French Sociology and the Overseas Empire des US-amerikanischen Soziologen George Steinmetz, markiert einen Kulminationspunkt in der Karriere seines Autors – eine Stelle, an der zuvor entwickelte Gedankengänge zusammengeführt und in ihrem Zusammenwirken fruchtbar werden sollen. Die Analyse von Kolonialismus und Imperialismus sowie die Rolle der Soziologie in diesen Herrschaftsformen,[1] die Blindheit positivistischer Sozialwissenschaften und die Suche nach epistemologischen Alternativen,[2] die Forderung nach und die Förderung einer historischen Soziologie[3] ebenso wie die Nutzung und Erweiterung Bourdieu’scher Ansätze beim Schreiben von Soziologiegeschichte[4] – diese Themen kennzeichneten das bisherige Schaffen des Vielschreibers, den das Hamburger Institut für Sozialforschung 2019 mit dem Siegfried Landshut Preis auszeichnete. In seinem jüngsten Buch treten sie in besonderer Klarheit zutage.
Die soziologische Forschung in und über Kolonien ist nicht Teil der offiziellen Geschichtsschreibung der Disziplin, ungeachtet ihrer tatsächlichen Größe und zeitgenössischen Bedeutung.
Steinmetz widmet sich darin der Verschränkung der französischen Soziologie mit dem Kolonialismus in Afrika. Die soziologische Forschung in und über Kolonien wurde, so argumentiert Steinmetz im ersten Teil seines Buchs („The Sociology of Colonies and Empires in the History of Sociology“, S. 1–49, Kapitel 1 & 2), vergessen und verdrängt. Sie ist nicht Teil der offiziellen Geschichtsschreibung der Disziplin, ungeachtet ihrer tatsächlichen Größe und zeitgenössischen Bedeutung. Um sich der Geschichte der französischen Kolonialsoziologie (und den Gründen ihrer Verdrängung) zu widmen, entwickelt Steinmetz einen spezifischen methodologischen Zugang, den er als neo-Bourdieu’sche historische Wissenschaftssoziologie (neo-Bourdieusian historical sociology of science, S. 17) bezeichnet. Diese beruhe im Kern auf Bourdieus Verständnis von sozialer Praxis, die konzipiert wird als Interaktion zwischen dem Habitus eines Individuums, seinen Positionen in bestimmten sozialen Feldern und seinem strategischen Verhalten innerhalb dieser Felder, um seine jeweilige Position zu verbessern.[5]
Das Vorhaben, die französische Kolonialsoziologie und ihre Auswirkungen auf den Raum der französischen (und internationalen) Sozialwissenschaften zu beschreiben, stößt, wie Steinmetz schreibt, auf die Schwierigkeit, dass über diese Dinge ein Mantel des Schweigens und Vergessens gebreitet wurde. Aus welchen Gründen auch immer sie entstanden sei (Steinmetz nennt derer fünf, S. 44–49): Diese disziplinäre Amnesie mache es erforderlich, in einem ersten Schritt die Rolle der Sozialwissenschaften im Kolonialismus als Forschungsstand zu konstruieren und zu legitimieren.
Dies geschieht in den an diesen ersten Teil anschließenden Abschnitten des Buchs. Teil II („The Political Context of Colonial Social Thought in Postwar-France“, S. 51–100, Kapitel 3, 4 & 5) schildert zunächst, wie die Kolonieverwaltungsorgane der Soziologie die Aufgabe zuschrieben, sich um Fragen der sozialen Wohlfahrt in den Kolonien zu kümmern – was diese auch bereitwillig, wenngleich aus eigenen Motiven, übernahm. Danach listet Steinmetz die bedeutendsten institutionellen Akteure und Organisationen auf, wobei er den Schwerpunkt hier auf Forschungs- und Lehreinrichtungen legt. Somit sind die zentralen Elemente und Gravitationspunkte des Felds der französischen Kolonialsoziologie genannt.[6]
Teil III („The Intellectual Contexts of Postwar French Sociology“, S. 101–168, Kapitel 6, 7 & 8) wendet sich der Beschreibung eines größeren Feldes zu, das die Ausrichtung der Kolonialsoziologie nachhaltig prägte, nämlich den Nachbardisziplinen der Soziologie und ihren im Kolonialreich zugedachten Aufgaben. Steinmetz bespricht die Geografie, die Rechtswissenschaften, die Wirtschaftswissenschaften, die psychologischen Wissenschaften, die Geschichtswissenschaften, Statistik und Demografie und die Anthropologie. Schließlich skizziert er auch noch breitere Tendenzen in der theoretischen und empirischen Ausrichtung der Nachkriegssoziologie: Hinwendung zur Feldforschung, stärkere Berücksichtigung historischer Perspektiven, schrittweise Entfremdung von der Idee wertfreier Forschung, wachsende Beschäftigung der Soziologie mit Staaten, Reichen und Kolonien.
Im vierten Teil („The Sociology of French Colonial Sociology, 1918–1960“, S. 169–228, Kap. 9 & 10) geht es, ausgehend von den in Teil II beschriebenen zentralen Elementen des Felds, um eine strukturelle Beschreibung der Kolonialsoziologie selbst. Diese erfolgt in zwei Schritten: Zunächst nimmt Steinmetz – ähnlich dem mittlerweile klassischen Referenztext von Turner und Turner[7] – eine institutionelle Analyse der französischsprachigen Soziologie (was einen Gutteil der belgischen Soziologie einschließt) vor, die die Entwicklung von Studierendenzahlen und Professuren angibt und die entscheidenden Publikationsorgane nennt. Er zeigt, dass das Feld der Kolonialsoziologie in den Grundzügen mit jenem der Gesamtdisziplin in Frankreich ident war; dieselben Mechanismen steuerten da wie dort die Verteilung von Anerkennung und anderer Ressourcen. Daran anschließend präsentiert das Buch eine Analyse der soziologischen Forschungspraxis in den Kolonien, die auch die Beteiligung französischer Soziolog:innen an Umsiedelungsprogrammen und die Beiträge einheimischer Soziolog:innen beleuchtet.
Vor dem somit beschriebenen Hintergrund schildert der abschließende Teil V („Four Sociologists“, S. 229–360, Kap. 11 bis 15) die Lebenswege und Karrieren von vier französischen Soziologen, wobei Steinmetz den Schwerpunkt auf deren Bezügen zu und ihrem Wirken in den afrikanischen Kolonien legt. Die Kapitel befassen sich mit Raymond Aron (geb. 1905 in Paris, gest. 1983 ebd.), Jacques Berque (geb. 1910 in Frenda, Algerien, gest. 1995 in Saint-Julien-en-Bornes, Frankreich), Georges Balandier (geb. 1920 in Aillevillers-et-Lyaumont, Frankreich, gest. 2016 in Paris) und Pierre Bourdieu (geb. 1930 in Denguin, Frankreich, gest. 2002 in Paris). Sich auf vier Akteure zu konzentrieren, ist eine zwangsläufig selektive Vorgehensweise. Die Kombination der biografischen Kapitel mit dem in den vorhergehenden Teilen erarbeiteten Wissen über die französische Kolonialsoziologie ermöglicht es den Leser:innen allerdings, diejenigen Mechanismen und Kräfte, die das Feld der französischen Soziologie in der Mitte des 20. Jahrhunderts charakterisierten und definierten, in einem umfassenderen Sinn nachzuvollziehen.
Das Schlusskapitel fasst die über das Buch hinweg entwickelten Thesen zusammen, darunter natürlich vor allem jene, die auch in seinem Titel angesprochen ist: nämlich dass die Etablierung beziehungsweise die Wiedererweckung der französischen Soziologie nach dem Zweiten Weltkrieg maßgeblich von dem Umstand geprägt ist, dass Frankreich eine Kolonialmacht war. Zum einen betraf dies die Ressourcen und den politischen Einfluss, die durch die Kooperation mit dem französischen Staat erschlossen werden konnten und die der Verankerung der Disziplin in Frankreich nutzten. Zum anderen konnte dadurch eine ganz bestimmte Tradition des Denkens erstarken, die sich von anderen zeitgenössischen Traditionen in der Soziologie vor allem dadurch unterschied, dass sie auf die Unerlässlichkeit eines historischen Blickwinkels bei der Beantwortung soziologischer Forschungsfragen beharrte. Neben diesem für die historische Soziologie wichtigen Umstand war es auch das Moment der Fremdheit, das der Debatte um die Bedeutung von Reflexivität in der sozialwissenschaftlichen Forschung ihre Richtung verlieh. Wenn für die Soziologin „die Vertrautheit mit der sozialen Welt das Erkenntnishindernis schlechthin darstellt“, wie Bourdieu, Chamboredon und Passeron an berühmter Stelle formulierten,[8] so war die Erfahrung des Fremdseins Vorbedingung jener Reflexivität, für die Bourdieu Zeit seines Lebens plädierte – im Anschluss an die anderen drei genannten Soziologen, aber auch unter (selektivem) Rückgriff auf französische Intellektuelle wie Gaston Bachelard, Georges Canguilhem und Michel Foucault.
An der Kolonialsoziologie und an George Steinmetz’ diesbezüglichen Thesen wird es kein Vorbeikommen mehr geben, wenn es um die Geschichte der französischen Soziologie geht.
George Steinmetz dürfte gelungen sein, was er sich vorgenommen hat: Den Kolonialismus als maßgeblichen Faktor der französischen Soziologiegeschichte zu etablieren. An der Kolonialsoziologie und an seinen diesbezüglichen Thesen wird es kein Vorbeikommen mehr geben, wenn es um die Geschichte der französischen Soziologie geht. Kritisieren könnte man allenfalls, dass der feldtheoretische Ansatz stärker entwickelt hätte sein können. Zwei Punkte fallen dabei unmittelbar ins Auge. In der Analyse hätte Steinmetz erstens den Konflikten innerhalb des Felds größere Aufmerksamkeit widmen können, und zwar auf Ebene sowohl der Akteure wie auch der Lehr- und Forschungsorganisationen. Auch wenn man, ganz im Sinne des neo-Bourdieu’schen Ansatzes, nicht jegliches Geschehen in der Geschichte der Soziologie durch Konflikte und Konkurrenzverhältnisse erklären kann, so gilt es doch, Konflikte systematisch zu kartografieren. Und zweitens würde die Darstellung an Übersichtlichkeit gewinnen, wenn Steinmetz das beschriebene Feld – optimalerweise in verschiedenen Stadien seiner Entwicklung – auch grafisch abgebildet hätte. Inspiration für die Darstellung unterschiedlicher Entitäten und Beziehungen hätte man bei techniksoziologischen Verfahren wie dem Systems Mapping holen können.
Doch das sind Kleinigkeiten angesichts der Gesamtleistung des Buchs, das zudem durch seine gute Lesbarkeit besticht. Es gelingt Steinmetz, komplexe Zusammenhänge detailgenau zu schildern, ohne jemals zu überfordern oder zu langweilen. Seine Sprachkompetenzen haben es ihm ermöglicht, Quellen auf Französisch und Deutsch heranzuziehen, was die Stabilität seiner Argumentation massiv stärkt. Auch in theoretischer und methodologischer Hinsicht handelt es sich um ein Werk, das Vorhandenes gut zueinander in Beziehung setzt, ohne ständig dem Irrlicht des Innovativseinmüssens hinterherzustolpern. Überdies bietet es viele Ansatzpunkte für weitere soziologiehistorische Forschungen und Analysen, etwa wenn es um die Rolle des Fremdseins und des epistemologischen Bruchs im Werk der Akteure selbst geht oder um die Gründe, warum die Kolonialsoziologie in der bisherigen Soziologiegeschichtsschreibung nicht vorkommt.
Fußnoten
- George Steinmetz, The Devil’s Handwriting. Precoloniality and the German Colonial State in Qingdao, Samoa, and Southwest Africa, Chicago, IL / London 2007; ders., A Child of the Empire. British Sociology and Colonialism, 1940s–1960s, in: Journal of the History of the Behavioral Sciences 49 (2013), 4, S. 353–378; ders. (Hg.), Sociology and Empire. The Imperial Entanglements of a Discipline, Durham, NC / London 2013.
- Timothy Rutzou / George Steinmetz (Hg.), Critical Realism, History, and Philosophy in the Social Sciences, Bingley 2018; George Steinmetz (Hg.), The Politics of Method in the Human Sciences. Positivism and Its Epistemological Others, Durham, NC / London 2005.
- George Steinmetz, Ideas in Exile. Refugees from Nazi Germany and the Failure to Transplant Historical Sociology into the United States, in: International Journal of Politics, Culture, and Society 23 (2010), 1, S. 1–27.
- George Steinmetz, Neo-Bourdieusche Theorie und die Frage wissenschaftlicher Autonomie. Deutsche Soziologen und der Imperialismus zwischen 1890 und 1945, in: Christian Dayé / Stephan Moebius (Hg.), Soziologiegeschichte. Wege und Ziele, Berlin 2015, S. 336–399.
- Sein Ansatz einer historischen Wissenschaftssoziologie gehe aber, so Steinmetz, über Bourdieu hinaus – daher die Vorsilbe „neo“. Steinmetz’ Ansicht nach erfordern sechs Aspekte der Bourdieu’schen Theorie Erweiterung und Ergänzung: (1) Die Einbettung sozialer Felder in allgemeinere Formen gesellschaftlicher Regulierung, dominanter kultureller Diskurse und Denkstile müsse herausgearbeitet werden. (2) Die sozialen Felder sollten auch an den realen geopolitischen Raum gekoppelt sein. (3) Im Bourdieu’schen Werk fehle eine Theorie des Subjekts, die es zu ergänzen gelte. (4) Ebenso mangele es an einer adäquaten methodologischen Fundierung der qualitativen Analyse von Text- und Bildmaterialien. (5) Die grundlegenden erkenntnis- und wissenschaftstheoretischen Prämissen der Bourdieu’schen Theorie(n) seien expliziert und angesichts jüngerer Entwicklungen – Steinmetz nennt den Kritischen Realismus und die postkoloniale Epistemologie – zu aktualisieren. (6) Und schließlich müsste, was weniger eine Kritik an Bourdieu und mehr eine Kritik der Rezeption seiner Ideen ist, wieder stärker in den Blick gelangen, dass die von ihm geforderte Reflexivität nicht auf das erkennende Subjekt abstellt, sondern auf die jeweiligen historischen Räume, in denen es verkehrt: „[S]uch reflective practice is not the same thing as confessional approaches taking the form ‚I am writing as an X or speaking as a Y.‘“ (S. 23)
- Er beschreibt die Pariser Ausbildungseinrichtungen Sciences Po, die École coloniale, die École national d’administration (ENA), das Centre des hautes études d’administration musulmane (CHEAM) sowie die Sixième section de l’école pratique des hautes études. Als forschungsrelevante Akteure führt er danach das CNRS, das Office de la recherche scientifique et technique outre mer (ORSTOM), der Conseil supérieur des recherches sociologiques outre-mer, das Institut français d’Afrique noire (IFAN) sowie das unter anderem von Marcel Mauss gegründete Institut d’éthnologie und das dem Institut angehängte Musée de l’homme an.
- Stephen P. Turner / Jonathan H. Turner, The Impossible Science. An Institutional Analysis of American Sociology, Newbury Park, CA / London / New Delhi 1990.
- Pierre Bourdieu / Jean-Claude Chamboredon / Jean-Claude Passeron, Soziologie als Beruf. Wissenschaftstheoretische Voraussetzungen soziologischer Erkenntnis, dt. Ausg. hrsg. von Beate Krais, übers. von Hella Beister, Berlin / New York 1991, S. 15.
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Henriette Liebhart.
Kategorien: Geschichte der Sozialwissenschaften Kolonialismus / Postkolonialismus Methoden / Forschung Wissenschaft
Zur PDF-Datei dieses Artikels im Social Science Open Access Repository (SSOAR) der GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gelangen Sie hier.
Empfehlungen
Was lehrt die Schule des Südens?
Folge 24 des Mittelweg 36-Podcasts
Prototyp der wirtschaftswissenschaftlichen Großforschung
Rezension zu „Primat der Praxis. Bernhard Harms und das Institut für Weltwirtschaft 1913–1933“ von Lisa Eiling
Ein Werk radikaler Gegenwärtigkeit
Nachruf auf Bruno Latour (1947–2022)
