Peter Wagner | Rezension | 16.12.2021
Die Kompassnadel zittert ein wenig, das ist normal
Rezension zu „Die Utopie des Sozialismus. Kompass für eine Nachhaltigkeitsrevolution“ von Klaus Dörre
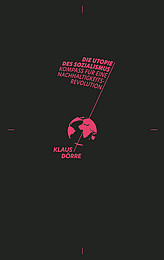
Die neue Bundesregierung, die in der letzten Woche ihr Amt antrat, will „Mehr Fortschritt wagen“, der sich aus einer Kombination von Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit ergeben soll. Man könnte meinen, dass Klaus Dörre damit höchst zufrieden sei, setzt sich seine „Nachhaltigkeitsrevolution“, für die er einen „Kompass“ zu entwickeln trachtet, doch aus liberal-demokratischen, sozialen und ökologischen Elementen zusammen. Dem ist aber keinesfalls so. Bereits kurz nach der Wahl im Oktober 2021 zeigte Dörre sich überzeugt, dass eine neue Bundesregierung eine „Nachhaltigkeitsrevolution [...] nicht in Gang setzen“ und es nur zu einem „modifizierte[n] Weiter-so“ kommen werde.[1]
Oberflächlich betrachtet lässt sich der Grund für Dörres Unzufriedenheit leicht erkennen. Seine Version der Nachhaltigkeitsrevolution ist verbunden mit einer Utopie des Sozialismus, so der Titel des zu besprechenden Buches, und es wird schwerfallen, den Regierungsmitgliedern ein derartiges Bekenntnis zu entlocken. Aber wo genau liegt der Unterschied? Warum besteht Dörre auf dem „S-Wort“, wie er es selbst nennt (S. 27 und passim)? Die merkwürdige Verkappung scheint die Marginalisierung des Sozialismus in der politischen Diskussion eher zu verfestigen als zu vermindern.
Im Hinblick auf Nachhaltigkeitsstrategien, insbesondere zum Stopp des Klimawandels, stellt Dörre den Innovationshoffnungen, die er als „Solutionismus“ bezeichnet,[2] sein Plädoyer für die Überwindung des Kapitalismus gegenüber. Den Solutionismus predigt in der Tat eine große Zahl von Wirtschaftswissenschaftlern, und moderat problemerkennende Politiker – wie nicht zuletzt der neue Bundeskanzler Olaf Scholz – schenken den Versprechen allzu gern Glauben. In den Innovationshoffnungen drückt sich die meist wenig begründete Erwartung aus, dass wir in einer Kombination aus Markt und angewandter Wissenschaft technische Lösungen finden, die tiefgreifende soziale Veränderungen überflüssig machen. Anders als Dörre sollte man diesen Weg der Problemlösung nicht von vornherein und rundheraus ablehnen, aber er hat recht, wenn er schreibt, dass es in Anbetracht der Dringlichkeit der Lage und der Abwesenheit von konkreten und machbaren technischen Mitteln fatal wäre, einzig auf diese Strategie zu setzen.
Von der Einsicht, der Solutionismus betreibe Etikettenschwindel, gelangt der Autor unmittelbar zu der Schlussfolgerung, dass nur die Überwindung des Kapitalismus einen Weg aus der gegenwärtigen „epochalen ökonomisch-ökologischen Zangenkrise“ (S. 16 und passim, vor allem Kapitel IV) weist. Eine argumentative Verkettung von drei Elementen, wenn ich es recht sehe, führt ihn zu diesem Ergebnis. Zum ersten bezieht sich Dörre auf das Theorem, der Kapitalismus sei auf beständige Expansion angewiesen. Er stützt sich vor allem auf Rosa Luxemburgs Imperialismusanalyse und den Begriff der „Landnahme“, der mit globaler Ressourcenextraktion und Umweltzerstörung quasibildlich die gegenwärtige Ära zu kennzeichnen scheint. Dabei weitet er das Konzept der „Landnahme“ aus, im Sinne einer allgemeinen Tendenz zu Expansion, die vielfältige Formen annimmt. Der Kapitalismus sei einerseits auf Ausdehnung in nichtkapitalistische Sphären angewiesen und vernichte andererseits durch die Besetzung ebendieser Sphären seine eigene Existenzbedingung – dies ist die „Zange“ in ihrer allgemeinen Form. Gegenwärtig konkretisiert sich die beobachtete Zangenkrise im Zusammentreffen der beiden weiteren Elemente: einer Erschöpfung der Wachstumsdynamik, unter anderem auch durch zunehmende soziale Ungleichheit, und dem Erreichen planetarischer Grenzen. Aus diesem Zangengriff soll nun das Verlangen nach einer sozialistischen Transformation entstehen, so Dörre (S. 72).
Dass wir uns mittlerweile planetarischen Grenzen annähern beziehungsweise diese in den kommenden Jahr(zehnt)en zu überschreiten drohen, ist ziemlich offenkundig, während die Erschöpfung der Wachstumsdynamik durchaus bezweifeln kann, wer über die traditionellen westlichen Kernländer des Kapitalismus und Industrialismus hinausblickt. Den größten Widerspruch aber ruft der erste Schritt hervor, die Herleitung der Expansionsnotwendigkeit des Kapitalismus. Es ist hier nicht der Ort, das Theorem der Expansionsnotwendigkeit im Detail zu betrachten, aber einige Beobachtungen will ich doch vornehmen. Zwei wesentliche Aspekte fehlen in Dörres Analyse. Zum einen vermeidet er es, die planetarische Ausweitung des Kapitalismus von anderweitig angetriebener Ausbeutung der Natur zu unterscheiden. Seine kurzen Anmerkungen zum Staatssozialismus haben keine Auswirkung auf die Argumentation. Und imperiales Machtstreben begann schon lange vor dem Kapitalismus damit, Landnahmen vorzunehmen, wobei man immer weitere Grenzen überschritt, zunächst horizontale und seit dem späten 18. Jahrhundert zunehmend vertikale, insbesondere durch die Extraktion von Steinkohle.[3] Man gewinnt keine Einsichten dadurch, ‚den Kapitalismus‘ als Ursache für die Kolonisierung Amerikas seit dem 16. Jahrhundert oder selbst für die westliche Ausdehnung der Vereinigten Staaten im 19. Jahrhundert anzuführen.
Seit etwa 1800 nehmen die Kohlendioxidemissionen aufgrund der in der Tat kapitalistisch angetriebenen Industrialisierung zu. Als Marx diese Entwicklung analysierte, bezeichnete er allerdings die Bourgeoisie und nicht den Kapitalismus als Akteur. Dies führt zum zweiten Aspekt. Im Gegensatz zum weitverbreiteten Sprachgebrauch handelt ‚der Kapitalismus‘ nicht. Welchen Sinn kann etwa folgender Satz haben: „Der Kapitalismus muss sich ausdehnen, um zu existieren und seine Funktionsmechanismen zu reproduzieren“ (S. 52)? Was geschieht, wenn er es nicht tut? Dörre gehört zu jenen kritischen Denkern, die recht umstandslos ‚den Kapitalismus‘ für gesellschaftliche Probleme aller Art verantwortlich machen. Damit aber dreht er die eben noch kritisierte schlichte Logik des Solutionismus einfach um. Wo jener alle Lösungen von marktlich-technischer Innovation erwartet, sieht eine den Kapitalismus überhöhende Denkweise die Ursache allen Übels in ebenjenem. Es ist dann ein Solutionismus anderer Art, die allgemeine Lösung im Sozialismus finden zu wollen. Dörre gibt sich durchweg konzeptuell offen und gesellschaftspolitisch an Pluralität orientiert. Aber seine Argumentation findet ihre Bodenhaftung in der Kapitallogik, die auch bei ihm nichts von ihrer mystifizierenden Wirkung verloren hat.
Die Utopie des Sozialismus erscheint wie eine ungewöhnliche Mischung aus Schulungsunterlagen marxistischer Organisationen der 1970er-Jahre und Entwürfen zu einem demokratisch-ökosozialistischen Regierungsprogramm. In letzterer Hinsicht finden sich viele Überlegungen, denen man durchaus zustimmen kann, wenngleich es an Stringenz mangelt. Zu vieles scheint aus jener Zeit zu stammen, als das Wünschen noch geholfen hat. Das größere Problem jedoch ist Dörres nur scheinbar lockere Anknüpfung an den historischen Materialismus, die nicht nur auf der Suche nach historischen Entwicklungsgesetzen bleibt, sondern auch in einer abgeschwächten Form an dessen Heilserwartung teilhat. Nachdem sich frühere Prophezeiungen nicht bewahrheitet haben, so gilt nun die Digitalisierung als jener Schub der Produktivkräfte, der uns endlich die Verwirklichung des Sozialismus erlauben könnte.
Möglicherweise kann man Dörre hier aber auch anders lesen. In gewissem Kontrast zu seinem vorliegenden Text ist die Intention des Autors wohl nicht deterministisch und teleologisch, sondern imaginativ und handlungsorientiert. Die Vorstellung von Zukünften ist etwas, das dazu beiträgt, sie überhaupt möglich zu machen.[4] Und hier liegt Dörres Buch auf einer Linie mit der bereits erwähnten Koalitionsvereinbarung, die das Regierungshandeln der nächsten Jahre zu einem neuen Kapitel der generell vertrauten, aber erneuerungsbedürftigen Erzählung vom Fortschritt machen soll.[5]
Die Frage ist also die nach dem Ausmaß der erforderlichen Erneuerung. Blicken wir einen Moment zurück auf die Zeit Friedrich Engels’, an dessen Arbeiten sich Dörre orientiert und an dessen 200. Geburtstag er eingangs erinnert. Am Ende des 19. Jahrhunderts gab es Akkumulationskrisen, die zu einer Transformation des westlichen Kapitalismus führten. Damals überschritt man mit der Erdöl- und Erdgasförderung auch die zweite vertikale Ressourcengrenze (nach der Steinkohle, hundert Jahre früher); ein Ereignis, das erst heute die volle Aufmerksamkeit der Politik- und Sozialgeschichte findet. Es ist vor diesem Hintergrund Klaus Dörres Anliegen, die Nutzung biophysikalischer Ressourcen in die Geschichte von Kapitalismus und Sozialismus einzutragen, und dies ist hoch bedeutsam.
Allerdings bilden nicht nur die sich selbst unterminierende Expansion des Kapitalismus und die Grenzen des Planeten jene „Zange“; seit jener Zeit limitieren auch Arbeiterbewegung und Demokratie die Rentabilität kapitalistischer Produktion. Die „Große Beschleunigung“ der Ressourcennutzung nach dem Zweiten Weltkrieg, die maßgeblich zum Klimawandel geführt hat,[6] kann schlussendlich nur mit Blick auf die vorhergehende totalitäre Transformation einiger europäischer Gesellschaften verstanden werden. Die Eliten des 20. Jahrhunderts zogen daraus den Schluss, dass soziale Sicherheit eine Voraussetzung für gesellschaftliche Stabilität war, und schufen den ressourcenintensiven demokratischen Wohlfahrtsstaat.[7] Damals meinte man also, dass materielle Expansion eine notwendige Bedingung für Demokratie sei. Man könnte dies ergänzend zur Kapitallogik als Demokratielogik bezeichnen. Es bleibt weiterhin zu zeigen, dass – und wie – eine demokratische Gesellschaft den Wachstumspfad verlassen kann, ohne die eigenen Problemlasten auf andere Weltregionen und den Planeten insgesamt zu verlagern.
Klaus Dörre würde dem Vorgenannten wohl nicht grundlegend widersprechen. Allerdings springt seine Betrachtung vom Ende des 19. Jahrhunderts zum Beginn des 21., ohne die politischen Erfahrungen des 20. Jahrhunderts hinreichend einzubeziehen. Dies ist insofern überraschend, als er in der Einleitung eine „Selbstverortung“ vornimmt, die den hochpolitisierten Kontext der 1970er-Jahre aufruft, als die Verwirklichung eines demokratischen Sozialismus für (einige) westdeutsche Studierende eine naheliegende Möglichkeit zu sein schien. Auch der Rezensent mit ähnlichen Erfahrungen engagierte sich seinerzeit für die Verknüpfung von Demokratie, Sozialismus und Ökologie und sieht heute keinen Anlass, davon grundlegend abzuweichen. Im Gegenteil: Alles ist eher noch dringlicher geworden. Aber es ist zu einfach, die globalen gesellschaftlichen Umbrüche seit den 1970er-Jahren hauptsächlich auf die Expansionsnotwendigkeit des Kapitalismus zurückzuführen, um dieser eine umfassende, aber auch unscharfe Utopie des Sozialismus gegenüberzustellen. Es gilt stattdessen, diese gesellschaftlichen Veränderungen – und damit auch das eigene Scheitern – besser zu verstehen.
Fußnoten
- Klaus Dörre, Schicksalswahl: Alles muss anders werden, ändern soll sich wenig! [13.12.2021], in: Jacobin, 13.10.2021. Der Beitrag wurde mehrere Wochen vor der Regierungsbildung publiziert. Mir ist keine Stellungnahme Klaus Dörres zur Koalitionsvereinbarung selbst bekannt.
- Den Begriff entlehnt er von Evgeny Morozov, um das zu benennen, was zuvor als technological fix bezeichnet wurde. Generell mobilisiert Dörre alle üblichen Verdächtigen der gegenwärtigen kritischen Diskussion ökologischer Färbung. Dabei sind mit neuen Beiträgen oder Begriffen längst nicht immer neue Einsichten verbunden.
- Vgl. etwa Edward Barbier, Scarcity and Frontiers. How Economies Have Developed through Natural Resource Exploitation, Cambridge 2011.
- Jens Beckert, Imaginierte Zukunft. Fiktionale Erwartungen und die Dynamik des Kapitalismus, Berlin 2018.
- Ohne dafür konkrete Anhaltspunkte zu haben (oder auch nur gesucht zu haben), vermute ich, dass Robert Habeck der spiritus rector der Koalitionsvereinbarung – oder zumindest ihrer Rahmung – war. Immerhin gehörte die Konstruktion von Narrativen zu den früheren Haupttätigkeiten des Literaturwissenschaftlers und Schriftstellers. Für meinen eigenen Versuch zur Wiederaneignung des Fortschrittsbegriffs vgl. Peter Wagner, Fortschritt. Zur Erneuerung einer Idee, übers. von Sebastian Esch und Theresa Friedlmeier, Frankfurt am Main / New York 2018.
- Will Steffen / Wendy Broadgate / Lisa Deutsch / Owen Gaffney / Cornelia Ludwig, The Trajectory of the Anthropocene. The Great Acceleration, in: The Anthropocene Review 2 (2015), 1, S. 81–98.
- Samuel Moyn, Not Enough. Human Rights in an Unequal World, Cambridge, MA 2018.
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Henriette Liebhart.
Kategorien: Demokratie Digitalisierung Kapitalismus / Postkapitalismus Ökologie / Nachhaltigkeit
Zur PDF-Datei dieses Artikels im Social Science Open Access Repository (SSOAR) der GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gelangen Sie hier.
Empfehlungen
Die diffuse Angst, zu kurz zu kommen
Sechs Fragen an Eva von Redecker
Christoph Deutschmann, Hannah Schmidt-Ott
Wie geht es mit dem Wachstum bergab?
Folge 28 des Mittelweg 36-Podcasts
