Aaron Lahl, Frank Schumann | Rezension | 02.11.2023
Digitale Männerfantasien
Rezension zu „Die Mannosphäre. Frauenfeindliche Communitys im Internet“ von Jacob Johanssen
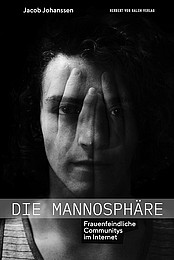
Im Juni 2023 richtete sich Maximilian Krah, aktuell Spitzenkandidat der AfD für die Europawahl 2024, mit einem knappen Video an eine ganz bestimmte Zielgruppe: junge Männer ohne Liebesglück.
„Jeder dritte junge Mann hatte noch nie eine Freundin. Du gehörst dazu? Schau keine Pornos. Wähl nicht die Grünen. Geh raus an die frische Luft. Steh zu dir. Sei selbstbewusst. Guck geradeaus. Und vor allem: Lass dir nicht einreden, dass du lieb, soft, schwach und links zu sein hast. Echte Männer sind rechts. Echte Männer haben Ideale. Echte Männer sind Patrioten. Dann klappt’s auch mit der Freundin.“[1]
Mit seiner eigentümlichen Vermengung banaler Lebenstipps (an die frische Luft gehen), spezifischer Geschlechtervorstellungen (echte Männlichkeit) und einer politischen Agenda (rechts, patriotisch) knüpft der AfD-Politiker zielsicher an Vorstellungen und Gefühlslagen an, die in maskulinistischen Internetsubkulturen – der sogenannten Mannosphäre – bereits seit längerer Zeit verbreitet sind. Zwar unterscheiden sich die üblicherweise zur Mannosphäre gezählten Communitys wie Pick-Up-Artists,[2] Men going their own way (MGTOW)[3] oder Incels[4] zum Teil in ihren Anliegen, dennoch eint sie die Sehnsucht nach einer dominanten Männlichkeit, mit der die User frustrierende Sexual- und Beziehungserfahrungen hinter sich zu lassen hoffen. Die jüngst auf Deutsch erschienene Studie Die Mannosphäre. Frauenfeindliche Communitys im Internet des Kommunikationswissenschaftlers Jacob Johanssen stellt einen Versuch dar, die in diesen Männlichkeitsforen vorherrschende affektive Dynamik zu erhellen – und damit nicht zuletzt auch die Attraktivität rechter politischer Angebote für sexuell frustrierte Männer zu erklären.
Im Unterschied zu anderen Arbeiten, die sich in jüngerer Zeit mit der affektiven Dimension der sexual- und geschlechterpolitischen Mobilisierungsstrategien rechter Strömungen beschäftigten,[5] konzentriert sich Johanssen in seiner Untersuchung hauptsächlich auf die in maskulinistischen Online-Communitys geteilten Fantasien und Weltbilder. Bezüge zu politischen Bewegungen sowie Parteien stellt er lediglich en passant her. Abgesehen davon hebt sich Johanssens Untersuchung von anderen Forschungsarbeiten durch ihre methodische und konzeptionelle Wahl ab, denn der Autor sucht die affektive Seite des Phänomens dezidiert mithilfe psychoanalytischer Konzepte zu erschließen. Unter Rückgriff auf Wilhelm Reichs Faschismusanalyse, Klaus Theweleits Männerphantasien sowie Elisabeth Young-Bruehls psychoanalytische Vorurteilstheorie stellt Johanssen die These auf, dass im Zentrum der online geteilten Fantasien eine „faschistische Form von affektiv-körperlicher Männlichkeit [steht], bei der es gleichsam um das Begehren nach und die Dominanz über Frauen geht“ (S. 71).[6] Ziel der gemeinsamen Inszenierung von Männlichkeit sei es, soziale Ohnmachtsgefühle zu kompensieren und eine fragile, unter permanenter affektiver Anspannung stehende Subjektivität zu stabilisieren (S. 73 f.).
Nach einer Einführung in den historischen und theoretischen Hintergrund der Studie widmet Johanssen verschiedenen Communitys der Mannosphäre je eigene Kapitel, in denen er das bereits genannte Hauptargument am jeweiligen Beispiel entfaltet. Er analysiert YouTube-Videos von einschlägigen Alt-Right-Influencern, Einträge in Incel- und MGTOW-Foren, die Manifeste, die Anders Breivik und (der unter Incels gefeierte) Elliot Rodger vor ihren Mordanschlägen verfasst haben, sowie Beiträge aus der um Masturbations- und Pornografieabstinenz bemühten NoFap-Community.[7] Zwar bietet Johanssens Buch damit einen guten Einblick in die heterogenen Subgruppen der Mannosphäre und wartet zuweilen mit interessanten Ansatzpunkten auf, um der affektive Bindungskraft der Gruppen auf den Grund zu gehen. Seine Deutungen wissen allerdings nicht immer zu überzeugen, was an dem mitunter oberflächlichen Umgang mit Quellen (siehe unten), einem teilweise unklaren Argumentationsgang und Unsauberkeiten in der Rezeption psychoanalytischer Theorien liegt.[8] Überhaupt vermittelt das Buch den Eindruck, übereilt und unter Zeitdruck entstanden zu sein.
Wir möchten im Folgenden drei Aspekte von Johanssens psychoanalytischem Ansatz herausgreifen und näher diskutieren: seine Auslegung des Fantasiebegriffs, seine Aktualisierung von Theweleits Konzept des Körperpanzers sowie sein Interpretationsverfahren, das für uns den Schwachpunkt seiner Untersuchung darstellt.
Männerfantasien zwischen Körper und Diskurs
Aus dem deutschen Titel des Buches ist ein für Johanssen zentrales Konzept verschwunden, das im englischen[9] noch am Anfang steht: die Fantasie. Johanssen versteht die Online-Communitys der Mannosphäre als virtuelle Räume, in denen die User ihre Fantasien zirkulieren lassen und sich wechselseitig bestätigen (S. 37). Fantasien sind für ihn einerseits in Anknüpfung an Freud imaginäre Inszenierungen einer Wunscherfüllung, worin die fantasierende Person die Rolle der Protagonistin oder des Protagonisten spielt. Andererseits – und damit geht Johanssen über psychoanalytische Ansätze im engeren Sinne hinaus – verortet er Fantasien an der Schnittstelle zwischen dem Diskursiven und dem Körperlich-Affektiven. Johanssens Annahme, dass die Communitys der Mannosphäre eine strukturelle Affinität zu rechtsradikalen oder faschistischen Bewegungen aufweisen, verknüpft beide Perspektiven: Die Mannosphärenmänner greifen in ihren imaginären Inszenierungen immer wieder auf Narrative neuerer rechter Bewegungen zurück, um damit für sie bedrohliche affektive Regungen zu kontrollieren.
Auf der diskursiven Seite weisen die von Johanssen untersuchten Fantasien Überschneidungen mit Motiven auf, die häufig in rechten Erzählungen anzutreffen sind: So handelt es sich bei ihnen vornehmlich um Opfer- und Ermächtigungsszenen, die um eine symbolische Kastration kreisen (S. 40). Damit ist der reale oder auch nur imaginierte Verlust von männlichen Privilegien gemeint, den die User für ihre sexuelle Frustration verantwortlich machen. In gewisser Nähe zu Ansätzen, die den jüngeren Erfolg rechter Parteien und Bewegungen mit einer soziokulturellen Liberalisierung erklären,[10] führt Johanssen dieses Verlusterleben auf drei Entwicklungen zurück: auf die „sexuelle Revolution“ von 1968, die vor allem weibliche Sexualität sichtbarer gemacht habe (S. 84), auf eine von feministischen Bewegungen maßgeblich vorangetriebene Selbstbestimmung und Gleichberechtigung von Frauen (S. 89) und schließlich auf einen wirtschaftlichen Strukturwandel, in dessen Folge klassische männliche Industrie- und Handarbeitsberufe abgewertet worden seien (S. 91). Die damit für bestimmte Männer einhergehenden sozialen Kränkungs- und Verlusterfahrungen ähneln strukturell rechten Verlustnarrativen, etwa der rassistischen Vorstellung einer Benachteiligung von Weißen (S. 95, S. 99, S. 114). Besonders an den Fantasien der Mannosphäre sei jedoch, dass in ihnen nicht primär Juden oder Migranten, sondern Frauen die Position des Anderen einnehmen würden (S. 24, S. 38). Ihre vermeintliche Macht stehe dem eigenen Glück im Weg, weshalb zur Wiederherstellung der phallischen Dominanz Rache geübt werden soll (S. 72).
Der digitale Körperpanzer
Die von Klaus Theweleit in seiner monumentalen Untersuchung der Memoiren von Freikorpssoldaten entwickelte These von einem „Körperpanzer“, der die Psyche des soldatischen Mannes zusammenhalte, dient Johanssen zur Erhellung der affektiv-körperlichen Seite der von ihm untersuchten Fantasien. Theweleit höchstselbst ruft uns sein Konzept im Vorwort des Buches in Erinnerung: Infolge „primär familiale[r] Eingriffe wie Prügel, Missachtung und Verhöhnung kindlicher Bedürfnisse, Verächtlichmachung von ‚Schwäche‘“ hätten die Freikorpssoldaten in ihrer Kindheit keine „libidinöse Besetzung der eigenen Körpergrenzen“ entwickeln und damit kein stabiles Ich im Freud’schen Sinne ausbilden können (S. 13). Erst in der sekundären Sozialisation in militärischen Einrichtungen wie etwa Kadettenschulen hätten sich die soldatischen Männer innerlich stabilisiert, da man ihnen dort mittels Drill und rigider Kontrolle gleichsam von außen „ein muskuläres Außen-Ich“ (ebd.), den besagten Körperpanzer, aufgeprägt hätte. Das Ich der soldatischen Männer bleibe infolgedessen allerdings stets von „Befehl und Gehorsam“ (ebd.) abhängig, um die weiterhin von Innen und Außen drohende Fragmentierung abzuwenden.
Johanssen behauptet, dass auch die User der Mannosphäre einen Körperpanzer ausbilden, wobei das Internet heute eine ähnliche Sozialisationsfunktion übernehme wie seinerzeit das Militär für die Freikorpssoldaten.[11] Angelehnt an die Konstruktion Theweleits konzipiert Johanssen den digitalen Körperpanzer ferner als zugleich körperlich und mit der Umwelt verschaltet: So wie für die Freikorpssoldaten etwa die Truppe oder die Waffen als sekundäre Ich-Grenzen dienten, nutzten die Mannosphärenmänner ihre digitalen Communitys, um eine Abgrenzung von anderen und damit eine psychische Stabilisierung zu erlangen (S. 288). Wegen der in der sozialen Wirklichkeit erlebten sexuellen Frustration und Hemmung bleibe der digitale Körperpanzer aber (wie vor ihm schon der militärische) porös; ihn bedrohten sowohl die unkontrollierbaren, ‚flutenden‘, produktiven Kräfte des Unbewussten als auch die mit diesen Kräften assoziierte, als gefährlich erlebte weibliche Sexualität – wie Johanssen in Bezugnahme auf Theweleit (und dessen Inspirationsquellen Reich, Gilles Deleuze und Félix Guattari) ausführt. Um diese Gefahren abzuwenden, brächten die User diverse Abwehrmechanismen in Stellung, allen voran frauenfeindliche Posts und Gewaltfantasien. Diese würden es erlauben, die innere Spannung in einem Akt der Enthemmung abzuführen, ohne dass die abgewehrten Wünsche dafür bewusst werden müssen.
Die Übertragung der Thesen Theweleits ist also recht weitgehend. Allerdings dient der digitale Körperpanzer laut Johanssen nicht dazu, „Psychosen abzuwehren“ (S. 74). Damit distanziert sich der Autor nicht nur von Theweleit, sondern implizit auch von dessen an Margaret Mahler angelehntem Modell der Primärsozialisation. Theweleit nahm an, dass sich die „nicht zu Ende geborenen“ Freikorpssoldaten aus der symbiotischen Verschmelzung mit der Mutter nicht hatten befreien können, wofür er seinerzeit neben den erwähnten erzieherischen Eingriffen auch eine „‚verschlingende‘ Emotionalität mütterlicherseits“ verantwortlich machte.[12] Solche Spekulationen über verschlingend-emotionale Mütter, in denen Theweleit – wie kritisch bemerkt wurde[13] – den Fantasien der Freikorpssoldaten folgte, statt sie zu dekonstruieren, umgeht Johanssen und konzentriert sich auf die Sekundärsozialisation durch das Internet. Die Abkehr von den psychoseätiologischen Theorien Theweleits führt allerdings zu einer theoretischen Inkonsistenz. Denn im glatten Widerspruch dazu, dass er den Körperpanzer nicht als Bollwerk gegen eine Psychose verstehen will, betont er unentwegt, der Körperpanzer halte ein „fragmentiertes“ beziehungsweise von „Auflösung“ oder „Desintegration“ bedrohtes Ich zusammen (z.B. S. 74, S. 77, S. 175 f., S. 288, S. 296). Was diese Ich-Auflösung anderes als ein psychotisches Phänomen wäre, erschließt sich in seinen Ausführungen nicht.
Psychoanalytisch interpretieren
Johanssen erhebt in seiner Untersuchung nicht nur den Anspruch einer „detaillierte[n] analytische[n] Auseinandersetzung mit tatsächlichen Daten“ (S. 284), das heißt den Posts, Videos und Manifesten der Mannosphärenmänner. Auch bemüht er sich um einen reflexiven Umgang mit den Quellen. So schreibt er an verschiedenen Stellen über seine ambivalenten Gefühle, etwa seine partielle Identifikation mit dem Erleben von Incels (S. 51), aber auch den Widerwillen, sich auf die Ideologien dieser Männer einzulassen (S. 285). Mehrfach äußert er sich zudem zu seiner eigenen privilegierten Position und betont die in seinen Augen unvermeidliche „Reproduktion von Sexismus und Patriarchat, da ich schlicht ein weißer Mann bin“ (S. 54).
Obwohl ein psychoanalytischer Ansatz gut geeignet scheint, die Melange aus Frauenhass, sexueller Frustration und Begehren nach einer dominanten Männlichkeit in der Mannosphäre zu untersuchen, können Johanssens Interpretationen insgesamt wenig überzeugen. Häufig bleiben sie oberflächlich und theorielastig. Als Material dient den Kapiteln meist nur eine geringe Anzahl an Originalzitaten, was Johanssen damit begründet, den betreffenden Ideologien nicht zu viel Raum geben zu wollen (S. 52). Gerade hier hätte er sich jedoch an Theweleit orientieren können, dem es mit seiner Collagetechnik auf faszinierende Weise gelungen war, das Denken der Freikorpssoldaten selbst sprechen zu lassen und es zugleich auseinanderzunehmen. Johanssen dagegen versäumt es mitunter selbst bei den wenigen zitierten Originalquellen, deren Gehalt herauszuarbeiten.
Exemplarisch seien hier zwei Posts aus der MGTOW-Bewegung genannt (S. 183 f.). Im ersten wird deutlich, dass bei der Entscheidung zum männlich-separatistischen Lifestyle auch ökonomische Motive eine Rolle spielen können: Der Beiträger arbeitet für 16 Dollar die Stunde und erwähnt, er wolle das Geld lieber für sich behalten, als es „mit einer Freundin zu teilen“ (S. 184). Der zweite Post erzählt eine wenig glaubwürdige Idealgeschichte über die positiven Folgen einer Abkehr von Frauen und gibt darüber hinaus noch einen interessanten Einblick in die mögliche (zur NoFap-Logik konträr laufende) Rolle der Masturbation als Autonomisierungspraxis gegenüber ambivalent begehrten Frauen:
„[...] nahm ich 100 Pfund ab, wurde reich, lernte 3 weitere Sprachen, schloss das College ab, hörte auf, Drogen zu nehmen und jetzt ist mir nie langweilig. [...] Ich hole mir einen runter und mache mit meinem Leben weiter, wenn ich einen Drang verspüre. [...]“ (S. 184)
Johanssen zitiert die Posts in voller Länge, geht dann allerdings nicht weiter auf sie ein, sondern schließt direkt mit generalisierenden, theoriegeleiteten und abstrakten Überlegungen in Bezug auf die ganze MGTOW-Bewegung an. Mit teilweise dürftigen Begründungen erfahren wir dann, dass MGTOWs „erstens zwanghaft und zweitens hysterisch“ seien (S. 198), dass sie „den unbewussten Wunsch [hätten], ihre Eltern zu töten“ (S. 205) und dass sie „[w]ie Kinder [...] die Welt in Gut und Böse ein[teilten]“ (S. 207).
Paradoxerweise ist es gerade Johanssens Verwendung psychoanalytischer Theorien, die seinen reflexiv-psychoanalytischen Anspruch im Umgang mit den Quellen unterläuft. Statt sich feinanalytisch auf das Material einzulassen, geht er immer wieder direkt zur Theoriesubsumtion über, wobei die Interpretationen nicht selten wie Diagnosen und Aburteilungen klingen. Die Distanz, die Johanssens Interpretationsweise zum Gegenstand aufbaut, wird dann noch vergrößert, wenn er die Mannosphärenmänner alle paar Seiten als sexistisch und rassistisch bezeichnet. Solche Verurteilungen mögen zwar in der Sache korrekt sein, führen im Kontext der Materialanalyse aber zu vorschnellen Vereindeutigungen. Es verwundert vor diesem Hintergrund nicht, dass einige von Johanssens generalisierenden Urteilen einer genaueren Prüfung nicht Stand halten, wie etwa die Behauptung, es gäbe in der NoFap-Bewegung „keinen Raum“ für den Gedanken, „dass der Pornokonsum ein Symptom für etwas anderes sein kann (z.B. Beziehungsprobleme oder psychische Probleme)“ (S. 252).[14]
So können sich Leserinnen und Leser schließlich eines bestimmten Eindrucks nicht erwehren: Johanssens Buch ringt mit der unheimlichen Faszination, welche die Mannosphäre nicht zuletzt deswegen hervorruft, weil sie verführerische Antworten auf verbreitete sexuelle Konflikte von Männern bietet. Statt diese ambivalente Faszination auszuarbeiten, wehrt der Autor sie weitgehend ab, indem er psychoanalytische Theorien instrumentell einsetzt und die Mannosphärenmänner an den Pranger stellt. Die somit negierte Nähe zum Gegenstand scheint allerdings auf einer anderen Ebene wiederzukehren: In seiner dekontextualisierten Verwendung wissenschaftlicher Theoreme, den generalisierenden Schnellschüssen und wiederholten Selbstvergewisserungen weist das Buch zuweilen erstaunliche formelle Ähnlichkeiten zu den in ihm analysierten Posts auf.
Fußnoten
- Siehe https://www.tiktok.com/@maximilian_krah/video/7246324156394933530 [26.9.2023].
- So bezeichnen sich selbsternannte Verführungskünstler.
- Dies sind antifeministische Männergruppen, die die Abwendung von Frauen propagieren.
- Damit sind unfreiwillig zölibatär lebende heterosexuelle Männer gemeint, die ihren sexuellen Misserfolg auf ihre nachteilige biologische Ausstattung zurückführen und sich in Selbstmitleid und Rachefantasien an den sie zurückweisenden Frauen ergehen.
- Etwa jüngst Birgit Sauer / Otto Penz, Konjunktur der Männlichkeit. Affektive Strategien der autoritären Rechten, Frankfurt am Main / New York 2023.
- Neben den drei erwähnten Ansätzen bezieht sich Johanssen im letzten Kapitel auf Jessica Benjamins relationale Theorie, mit der er – als „Hoffnungsschimmer“ (S. 282) zum Schluss – die Äußerungen der Mannosphärenmänner als entstellte Artikulation von Anerkennungswünschen zu deuten versucht.
- Den auch im deutschsprachigen Raum relevanten Pick-Up-Artists widmet Johanssen nur beiläufige Ausführungen (S. 35 f.).
- Ein Beispiel für die handwerklichen Fehler: So begegnet uns etwa der Freud’sche „Bemächtigungstrieb“ bei Johanssen als „Instinkt zur Beherrschung“ (S. 246). Zu seiner Illustration zitiert der Autor eine Passage bei Freud (in Eigenübersetzung und unter Angabe einer falschen Quelle), die nichts mit dem Bemächtigungstrieb zu tun hat, sondern das Betasten als vorläufiges Sexualziel beschreibt. Für die ungenaue Theorierezeption sei zudem auf Johanssens wiederholt in Anlehnung an Jessica Benjamin formulierte Kritik am „ödipalen Modell“ verwiesen, der ein reduktionistisches und teilweise fehlerhaftes Verständnis des Ödipuskomplexes zugrunde liegt. Wenn Johanssen etwa „Hass auf die Mutter“ oder „Neid auf den Mutterleib und die Reproduktionsfähigkeit der Frauen“ (S. 296) als angeblich ödipale Erklärungsmuster verwirft, scheint er diese mit psychogenetischem Denken überhaupt zu verwechseln. Die Behauptung, das ödipale Modell impliziere eine heteronormative Logik (ebd.), übergeht ferner Freuds Theorem des vollständigen Ödipuskomplexes, das an keiner Stelle im Buch auch nur erwähnt wird.
- Der Originaltitel lautet Fantasy, Online Misogyny and the Manosphere. Male Bodies of Dis/Inhibition.
- Vgl. etwa Pippa Norris / Ronald Inglehart, Cultural Backlash. Trump, Brexit, and Authoritarian Populism, Cambridge 2019.
- In Männerphantasien deutet Theweleit eine solche Aktualisierbarkeit der Körperpanzertheorie schon an: „Vielleicht ließe sich sogar zeigen, daß eine Technisierung des Leibs unter (verschiedener) Anwendung fortgeschrittener Produktionstechniken die Art und Weise bestimmt, in der der Körperpanzer der Angehörigen bestimmter Schichten in den jeweiligen Epochen zunimmt oder sich transformiert.“ Klaus Theweleit, Männerphantasien, Bd. 2: Männerkörper. Zur Psychoanalyse des weißen Terrors, Reinbek bei Hamburg 1980, S. 202.
- Ebd., S. 212.
- Sebastian Winter, Flut oder Stahl? Literaturessay zur Neuausgabe der „Männerphantasien“ von Klaus Theweleit [26.9.2023], in: Soziopolis, 8.1.2020; Rolf Pohl, Feindbild Frau. Männliche Sexualität, Gewalt und die Abwehr des Weiblichen [2004], Hannover 2019, S. 469 ff. Interessanterweise geht Theweleit in seinem Vorwort für Johanssen weder auf die Symbiosetheorie noch auf deren Kritik ein.
- Dies ist in einigen Fällen zwar sicher der Fall (vgl. Aaron Lahl, Männliches, Allzumännliches. Fallrekonstruktion zur psychischen Bedeutung von „NoFap“, in: Daniel Burghardt / Moritz Krebs (Hg.), Verletzungspotenziale. Kritische Studien zur Vulnerabilität im Neoliberalismus, Gießen 2022, S. 193–231), als Gesamturteil in Bezug auf diese Community aber unzutreffend.
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Henriette Liebhart.
Kategorien: Digitalisierung Gender Gruppen / Organisationen / Netzwerke Körper Medien Psychologie / Psychoanalyse
Zur PDF-Datei dieses Artikels im Social Science Open Access Repository (SSOAR) der GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gelangen Sie hier.
Empfehlungen
Zwischen Nähe und Distanz
Replik auf Aaron Lahls und Frank Schumanns Rezension zu „Die Mannosphäre. Frauenfeindliche Communitys im Internet“
Bekenntnis zum unfreiwilligen Zölibat
Rezension zu „Incels. Geschichte, Sprache und Ideologie eines Online-Kults“ von Veronika Kracher
Zur diagnostischen Gefühlskultur der Gegenwart
Rezension zu „Digitale Diagnosen. Psychische Gesundheit als Social-Media-Trend“ von Laura Wiesböck

