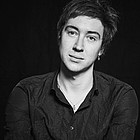Geoffroy de Lagasnerie, Marc Ortmann | Interview | 15.12.2022
„Für mich ist Schreiben ein politischer Akt“
Geoffroy de Lagasnerie im Gespräch mit Marc Ortmann
Lieber Geoffroy de Lagasnerie, Sie haben gerade Ihr neues Buch fertig gestellt – wie erging es Ihnen mit diesem Schreibprojekt?
Es war ein viel komplexerer Prozess als bei meinen anderen Publikationen, da es sich um ein besonderes Buch handelt. Die meisten Bücher, die ich veröffentlicht habe, versuchen, die Machtsysteme, die sich uns aufdrängen und dabei die verschiedenen Aspekte unseres Daseins einschränken, zum Gegenstand zu machen, indem sie atypische Lebensläufe oder Leben analysieren, also solche, die sich gegen die Machtsysteme oder außerhalb ihres Einflussbereichs definiert haben. In Logique de la création (2011) mache ich die intellektuellen Werdegänge von Foucault, Bourdieu, Deleuze und Derrida zum Ausgangspunkt einer Kritik des akademischen Systems und seiner Auswirkungen auf die Logik des Denkens. In Die Kunst der Revolte (2016) interessiere ich mich für die Gesten von Snowden, Assange und Manning,[1] um die Art und Weise zu hinterfragen, mit der unsere Rechtssysteme restriktive Denkweisen über Politik und Protestformen etablieren.
In meinem neuen Buch frage ich nach Lebensformen: nach dem, was wir sind und was wir sein könnten. Dabei stütze ich mich auf die Erfassung und Beschreibung einer Singularität. Diese Einzigartigkeit hat jedoch die Besonderheit, dass ich sie lebe und sie in meiner Biografie verankert ist: Es handelt sich um die freundschaftliche Beziehung zwischen Didier Eribon, Edouard Louis und mir.
Ich lebe mit Didier und Edouard in einer mehr als zehnjährigen Beziehung. Den Beginn unserer Freundschaft datieren wir auf September 2011. Damals hat sich etwas in unseren Leben verändert, ein tiefer Einschnitt zeichnete sich ab: Wir sind zusammen gereist, haben fast immer gemeinsam zu Abend gegessen, haben gemeinsam gearbeitet und nachgedacht, sind zu dritt in der Öffentlichkeit aufgetreten, haben unsere Geburtstage und traditionelle Familienfeste wie Weihnachten zusammen gefeiert und fast unser gesamtes Leben miteinander geteilt... Diese Beziehung ist das Zentrum unserer Existenz. Sie ist, wie eine nahestehende Person kürzlich sagte, eine lange, nie endende Diskussion. Aber sie ist auch, und vielleicht vor allem, der Rahmen unseres täglichen Lebens, unserer geteilten Emotionen und Erfahrungen, mit Ritualen, Orten, Zeiten und Zeitlichkeit, ein Ort der Begegnungen und Verbindungen mit anderen Menschen und anderen Welten. Es ist ein Beziehungsraum, in dem die Freundschaft zu einer Lebensweise geworden ist, das heißt gleichzeitig zu einer Kultur und einer Produktionsweise der Subjektivität.
Es gibt also einen explizit autobiografischen Teil in dem Buch: Ich frage mich, ob Freundschaft eine Lebensweise ist und wie sich die Beziehung zur Gesellschaft, zu Institutionen und zu anderen Menschen verändert, wenn man Freundschaft zum Mittelpunkt seiner Existenz macht. Aufgrund meiner eigenen Vertrautheit mit dem Objekt hatte ich anfangs einen fälschlichen Eindruck von Transparenz. Ich dachte, es würde genügen, unsere Geschichte zu erzählen, um sie zu dokumentieren. Ich schrieb also eine erste Version des Buches, die narrativ, biografisch, mit vielen Anekdoten und ohne expliziten theoretischen Diskurs oder vorheriges Theoretisieren war. Als ich sie jedoch noch einmal durchlas, wurde mir klar, dass ich mit diesem Ansatz eine naive Erzählung produziert hatte, die frei von Problemen und in gewissem Sinne sogar faktenfrei war. Ich verwechselte den Schein mit dem Sein. Ich sprach von nichts. Also legte ich das Manuskript beiseite und las ein Jahr lang soziologische (Simmel, Bourdieu etc.) und philosophische (Cicero, Derrida, Arendt etc.) Texte über Freundschaft und Liebe (Barthes) und über Utopie. Ich las Texte aus der freudomarxistischen Tradition und aus der Frankfurter Schule, außerdem die Memoiren von Simone de Beauvoir, Patti Smith und anderen.
Nach und nach wurde mir klar, welche Wahrheit in der Überzeugung steckt, dass es keine Untersuchung der Realität gibt, die ohne Philosophie, Spekulation und Fantasie auskommt. Und damit auch, wie gefährlich die positivistische und empiristische Illusion ist, die heute einen Großteil der sozialwissenschaftlichen Forschung beherrscht. Ohne Philosophie keine Probleme und ohne Probleme keine Fakten. Nach dieser Phase des Nachdenkens habe ich meinen gesamten Text umgebaut, um daraus eine soziopolitische Reflexion über Freundschaft und Lebensformen, aber auch über die Rolle der Beziehungsgestaltung im intellektuellen Schaffen zu entwickeln – sie beruht natürlich weiterhin auf einer Erkundung der Beziehung zwischen Didier, Edouard und mir.
Welche Rolle spielt das Schreiben in Ihrem Alltag? Wie muss ein Tag gestaltet sein, damit Sie schreiben können? Gibt es persönliche Vorbedingungen oder Rituale?
Ich misstraue dem Narzissmus von Schriftstellern, die ihre Schwierigkeiten beim Schreiben und ihre Rituale in Szene setzen. Ich würde sagen, dass es in meinem Fall ziemlich einfach ist: Ich hasse es zu schreiben, aber ich liebe es, umzuschreiben. Bei mir geht es also immer darum, so schnell wie möglich eine erste Version und einen groben Plan zu erstellen, auf deren Grundlage ich alles noch einmal überarbeiten kann. In der ersten Phase schreibe ich zwanghaft, auch wenn ich weiß, dass das, was ich schreibe, schlecht ist. Ich schreibe auf allen möglichen Medien und so schnell wie möglich: Ich tippe auf meinem Computer, manchmal ziemlich hektisch, wenn die Ideen schneller kommen, als meine Hände sie aufschreiben können; ich diktiere in mein iPhone, das heißt, ich nehme Sprachmemos auf, die ich dann abtippe... So bekomme ich schnell einen Gesamtüberblick über das Buch. Wenn die erste Version fertig ist, beginnt die Phase des Umschreibens, in der ich alles, was ich geschrieben habe, wieder aufgreife und es in die Form bringe, die das Buch am Ende haben soll.
Wie entstehen die Ideen für ihre Texte? Aus alltäglichen Situationen, öffentlichen Debatten oder beim Schreiben selbst?
Zweifellos ist der Grund, warum man unter Millionen möglicher Themen eines eher als ein anderes herausgreift, immer ein wenig willkürlich. Aber ich würde sagen, dass meine Bücher fast immer aus einem Unbehagen heraus entstanden sind: wenn ich in einem bestimmten Diskursfeld etwas am Werk sehe, das ich in Denken in einer schlechten Welt (2018)[2] als funktionale Kritik bezeichne. Damit meine ich Stellungnahmen, die eine Institution oder eine Macht angreifen und sich als kritisch oder sogar radikal darstellen, während sie in Wirklichkeit die grundlegenden Kategorien oder Sichtweisen bestätigen, die zum Funktionieren desjenigen Systems beitragen, gegen das sie sich angeblich stellen. Zum Beispiel greifen einige den Repressionsapparat als „Klassenjustiz“ an und hinterfragen die ungleiche Bewertung und Bedeutung von illegalen Handlungen – in Abhängigkeit von den Merkmalen des jeweiligen Straftäters –, ohne jemals kritisch über die Idee der Repression als solche und ihre Funktionsweise nachzudenken. Damit ratifizieren sie letztlich die Idee der Repression und ihre Notwendigkeit.[3] Oder diejenigen, die den Rückbau der zeitgenössischen Universität aufgrund externen Drucks und neoliberaler Logik kritisieren, ohne jemals die Effekte von Zensuren zu hinterfragen, die in die interne und autonome Funktionsweise der Universität und der Disziplinen eingeschrieben sind.[4] Ein weiteres Beispiel sind diejenigen, die die Mechanismen der derzeitigen politischen Systeme kritisieren, indem sie mythologische Kategorien wie „Volk“, „allgemeiner Wille“ oder „nationale Souveränität“ mobilisieren.[5]
Ich bin allergisch gegen funktionale Kritik. Denn die, die sie üben, tragen letztlich zum Funktionieren eines Systems bei, indem sie so tun, als würden sie es anprangern. Sie befinden sich daher in einer perversen Komplizenschaft mit den Mächten, die uns unterdrücken. Es sind die Diskurse, die uns einschließen und ersticken, während die Rolle des Denkens darin besteht, uns Perspektiven zu eröffnen und uns etwas frische Luft zu bringen. Ich versuche, die Grundlage für Untersuchungen zu legen, die ich im Umkehrschluss als oppositional bezeichne: über die Universität, Whistleblower, die Justiz, die Polizei, die Demokratie, die Kunst und so weiter. Ich will also genau die Bereiche untersuchen, die mir übersättigt mit funktionaler Kritik erscheinen.
In Ihrem Buch Denken in einer schlechten Welt und in dem Vortrag „The University and Its Critics“ haben Sie sich dafür ausgesprochen, dass Autor:innen ihr Schreiben bezüglich ihrer eigenen Verstricktheit in Macht und Gewalt reflektieren. Was bedeutet diese Forderung – generell und für Ihr eigenes Schreiben?
Für mich ist Schreiben ein politischer Akt und es ist notwendig, alle Aspekte dieser Aktivität politisch zu hinterfragen: ihre Modalitäten, ihre Objekte, ihre Medien. Schreiben bedeutet, sich zu engagieren, an der Welt teilzunehmen, und daher ist Schreiben nie neutral. Es darf niemals zu einer Art Routine werden, zu einem Selbstzweck, bei dem sich der Schriftsteller oder die Forscherin nicht mehr fragt, warum und für wen er oder sie schreibt. Andernfalls läuft man Gefahr, dass die eigene intellektuelle Tätigkeit letztlich nur ein Instrument zur Reproduktion kultureller oder akademischer Institutionen ist, das nichts hervorbringt.
Schreiben bedeutet für mich, dass ich versuche, eine Wirkung zu erzielen (was nicht das Gleiche ist wie öffentlicher Erfolg, ganz im Gegenteil). Aus diesem Grund ziehe ich die Buchform immer dem Artikel vor. Ich schreibe fast nie Artikel für peer-reviewed journals, da das Buch per Definition einen größeren und vielfältigeren potenziellen Adressatenkreis hat als ein Artikel. Das ist auch der Grund, warum ich nie dicke Bücher schreibe. Sie wirken oft einschüchternd und werden selten ganz gelesen, außer von ein paar Leuten, die die Zeit dazu haben. Ein Gedanke muss nützlich sein, er muss etwas bewirken, zirkulieren – das ist die Anforderung, die meine Schreibarbeit leitet.
Darum reicht Schreiben niemals aus. Es ist nur ein Aspekt einer umfassenderen Aktivität. Man muss auch in den Medien, in sozialen Netzwerken und auf Veranstaltungen präsent sein, in den großen Tageszeitungen veröffentlichen und jüngere Menschen ansprechen. Der auktoriale Ansatz ist umfassend und das Schreiben ist nur ein Modus in einer Reihe von Praktiken, die sich an kohärenten ethischen und politischen Werten orientieren müssen. Aus diesem Grund kann man meiner Meinung nach keine Theorie schreiben, die sich als emanzipatorisch begreift, und nur an den Aktivitäten des akademischen Feldes in seiner routiniertesten und ausgrenzendsten Funktionsweise teilnehmen, ohne sich jemals auf politisches Terrain zu begeben oder sich mit sozialen Bewegungen zu solidarisieren. Das macht keinen Sinn. Um mit Sartre zu sprechen: Es ist unauthentisch.
Haben Sie abschließend einen Ratschlag für diejenigen, die gerade mit dem Schreiben anfangen? Wie findet man seinen eigenen Stil und wie geht man Ihrer Meinung nach am besten mit den Zweifeln um, die mit dem Schreiben einhergehen?
Ich denke, das Wichtigste ist, dass man eine strategische und pragmatische Beziehung zum Schreiben hat. Mit strategisch meine ich, dass man immer für etwas und in Abhängigkeit von etwas schreiben sollte. Schreiben Sie nicht um des Schreibens willen, geben Sie sich kein Arbeitsthema ‚an sich‘, sondern legen Sie genau fest, mit welchen Diskursen Sie sich auseinandersetzen wollen und warum es wichtig ist, dies zum aktuellen Zeitpunkt zu tun. Mit pragmatisch meine ich, dass man beim Schreiben besessen von Effizienz sein sollte.
Ich überlege gerade, ein Buch zum soziologischen Denken zu schreiben und habe daher vor Kurzem den Briefwechsel zwischen Durkheim und Mauss erneut gelesen. Mir fielen die Stellen auf, an denen sich Durkheim über die Unfähigkeit von Mauss ärgert, seine Artikelserie zu beenden und ein Buch zu schreiben. Mauss verliert sich in seinem Material, er sucht immer weiter nach Dokumenten, denn er hat eine maßlose Vorliebe für Nuancen und Gelehrsamkeit. Durkheim sagt ihm, er solle dem entgegenwirken. Er schreibt: Habe immer das Ziel vor Augen, zu einem Ergebnis zu kommen.
Ich denke, das ist derselbe Rat, den ich jedem Autor geben würde, der mit dem Schreiben beginnt: Sei immer darauf bedacht, etwas zu erreichen, und sei immer darauf bedacht, effektiv zu sein. Tu Dir nicht selbst einen Gefallen. Das Wichtigste ist, dass Dein Buch zirkuliert, dass es gelesen wird und etwas bewirkt. Verschwende keine Energie. Arbeite gegen die dem Schreiben innewohnende Tendenz, sich einzuschließen, und gegen den damit verbundenen Narzissmus. Denn er führt oft dazu, dass Bücher geschrieben werden, die niemand liest, weil sie zu lang und einschüchternd sind und dadurch ihre Wirkung verlieren. Das Wichtigste ist, eine wirksame Form zu finden, ohne auf den theoretischen Anspruch zu verzichten.
Fußnoten
- Frz. Original: Geoffroy de Lagasnerie, L’art de la révolte. Snowden, Assange, Manning, Paris 2015.
- Frz. Original: Geoffroy de Lagasnerie, Penser dans un monde mauvais, Paris 2017.
- Vgl. Geoffroy de Lagasnerie, Verurteilen. Der strafende Staat und die Soziologie, übers. von Jürgen Schröder, Berlin 2017; frz. Original: ders., Juger. L’État pénal face à la sociologie, Paris 2016.
- Vgl. Geoffroy de Lagasnerie, Logique de la création. Sur l'Université, la vie intellectuelle et les conditions de l'innovation, Paris 2011
- Vgl. Geoffroy de Lagasnerie, Das politische Bewusstsein, übers. von Richard Steurer-Boulard, Wien 2021; frz. Original: ders., La Conscience politique, Paris 2019.
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Henriette Liebhart.
Kategorien: Care Lebensformen Öffentlichkeit Philosophie Wissenschaft
Zur PDF-Datei dieses Artikels im Social Science Open Access Repository (SSOAR) der GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gelangen Sie hier.
Teil von Dossier
Über Schreiben sprechen
Vorheriger Artikel aus Dossier:
„Schreiben hat einen kumulativen Charakter“
Nächster Artikel aus Dossier:
„Man muss eine Ethik des Schreibens haben“
Empfehlungen
Die Ehe als spezifische Lebensform?
Rezension zu „Die Ehe in Deutschland. Eine soziologische Analyse über Wandel, Kontinuität und Zukunft“ von Rosemarie Nave-Herz
Kritische Theorie, vierhändig
Nancy Fraser und Rahel Jaeggi versuchen sich an einer Erneuerung der Kapitalismuskritik
M. Laufenberg: Sexualität und Biomacht
Zur Sexualität der "Anderen" als "kontagiöse Sexualität"