Frank Eckardt | Rezension | 24.05.2023
Hochkultur statt Erholung
Rezension zu „Parks for Profit. Selling Nature in the City“ von Kevin Loughran
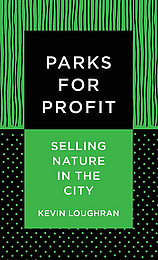
Inzwischen gehört die High Line in New York zum Standardprogramm jedes Touristen. Vor zwei Jahrzehnten galt die alte Eisenbahntrasse im ehemaligen Industrie- und Arbeiterstadtteil Chelsea noch als Geheimtipp; die Renaturierung durch eine Bürgerinitiative war mit viel Lob aus den Fachkreisen der Stadt- und Landschaftsplanung bedacht worden. Durch die Wiederaneignung der aufgegebenen Transportlinie ließ sich eine zentrale Fläche in der Stadt attraktiv gestalten, darüber hinaus realisierte man hier ein stadtplanerisches Konzept, das die Idee einer Stadt für alle umsetzte. Konkret bedeutet dies Begrünung, Kunst und eine spektakuläre Sicht auf die Ikonen der New Yorker Skyline, aber auch Bürgerbeteiligung, Nachhaltigkeit sowie kreative Quartiersentwicklung.
Die High Line hat Schule gemacht. Die Rückbesinnung auf Parks in der Stadt folgt dem Ruf nach mehr Grün und Entspannung, Naturerlebnis und Kunst im öffentlichen Raum, der mittlerweile nahezu überall zu hören ist. In seinem Buch über Parks for Profit. Selling Nature in the City fragt der US-amerikanische Soziologe Kevin Loughran, ob der Nutzen von Parks in heutigen US-amerikanischen Städten tatsächlich so groß ist, wie gemeinhin angenommen: „Post-Industrial parks like the High Line therefore seem like win-win propositions. Are they?“ (S. 6)
Für seine Dekonstruktion des Mythos der High Line und ihres vorgeblichen Erfolgs untersucht Loughran die gesellschaftliche Funktion der Renaissance städtischer Parks. Sein Buch versucht, an den Beispielen des Bloomingdale Trail/606 in Chicago und des Buffalo Bayou Park in Houston aufzuzeigen, dass die High Line keine Ausnahme bildet. Wie Loughran in der Einleitung hervorhebt, wirken die drei Parks auf lokal-spezifische Weise auf städtische Krisen ein. Die jeweiligen Krisen sind verknüpft mit dem Übergang in eine postindustrielle Stadtökonomie und mit den Machtverhältnissen vor Ort. Sie sind aber auch Ausdruck einer sozialräumlichen Reorganisation US-amerikanischer Metropolen nach dem Zweiten Weltkrieg. Loughran erkennt dabei eine doppelte Bewegung: zum einen den Umzug einer weißen Bewohnerschaft in die Vorstädte, zum anderen die langsame Rückeroberung der Innenstädte – kurz: Gentrifizierung –, die mit den 1980er-Jahren einsetzte. Seine Beschreibung der genannten Entwicklungen betont den verstärkenden Effekt von Stadtgestaltung und -planung; dementsprechend könne auch die Rolle der Parks nicht losgelöst betrachtet werden. Grünflächen und Parks, zumeist sogenannte small parks, sollten dem Abzug der (weißen) Mittelschicht in die Suburbia entgegenwirken.
Es ist eine selektive Nutzung des öffentlichen grünen Raums durch eine privilegierte Minderheit zu beobachten – häufig Touristen, weiß und auf jeden Fall der Mittel- und Oberklasse zugehörig.
Mit einer anschaulichen und sehr gut lesbaren Rekonstruktion der Planungsprozesse in den drei Städten gelingt es Loughran, die stadtökonomische Funktion der Parkgestaltung herauszuarbeiten, die er als In-Wert-Setzung von Nachbarschaften bezeichnet. Durch die assoziativ-räumliche Verknüpfung von Natur und Nachbarschaft entsteht Loughran zufolge eine Aura des Authentischen. Diese Authentisierung lässt sich als eine mehr oder weniger bewusste Strategie der Stadtplanung nachvollziehen. Natur verliert durch die urbane Instrumentalisierung ihre Naivität, der vormalige Anspruch, mehr Grünflächen für alle zu schaffen, gerät in den Hintergrund. Stattdessen ist eine selektive Nutzung des öffentlichen grünen Raums durch eine privilegierte Minderheit zu beobachten – häufig Touristen, weiß und auf jeden Fall der Mittel- und Oberklasse zugehörig. Die Effekte für die benachteiligte Nachbarschaft sind desaströs: Die Immobilienpreise steigen ins Gigantische und wo früher, in Zeiten der Totalsanierung (Urban Renewal) der 1960er-Jahre, Autobahnen die Stadt durchkreuzten, fungieren in Chicago und Houston mittlerweile Parkanlagen als städtebauliche Barrieren zwischen den ethnisch getrennten Stadtteilen. Der Mitbegründer der Friends of the High Line, Robert Hammond, hat es treffend auf den Punkt gebracht: „We were from the community. We wanted to do it for the neighborhood. Ultimately, we failed.“ (S. 172)
Die Parks sollen auf eine bestimmte Art genutzt werden – „high culture“ statt einfacher Rekreation; dies setzen die Städte planerisch, politisch und polizeilich durch. Flanieren als neue Praxis hat den früheren Aufenthalt in kleinen nachbarschaftlichen Parks abgelöst. Soziale Kontrolle, ein exklusives gastronomisches Angebot, kulturelle Veranstaltungen und auffällig gestaltete Sitzmöbel oder künstlerische Objekte haben die räumlichen Praktiken an Orten wie der High Line verändert. Die postindustriellen Parks sind nicht mehr für Menschen aus dem Viertel zur alltäglichen Nutzung gedacht, etwa zum Entspannen oder für Treffen mit anderen Bewohner*innen des Quartiers.
Die drei Beispiele, die Loughran überzeugend analysiert, sind wichtige Referenzen für die generelle Diskussion über die Bedeutung grüner Nachlassenschaften des Industriezeitalters. In der globalen Debatte um die Würdigung des industriellen Erbes dienen die drei Projekte oft als Best-Practice-Beispiele. Dadurch entsteht der Eindruck, das High-Line-Gelände könne ein Vorbild für jede Industrieruine sein. Die Parallele zur Heroisierung des Internationale Bauausstellung Emscher-Parks, mit dem die Kohle- und Stahlindustrie des Ruhrgebiets noch vor den US-amerikanischen Beispielen einen ähnlichen Ansatz im Umgang mit den Industriebrachen verfolgte, liegt auf der Hand. Wie in den USA erklärte man Zechen zum Weltkulturerbe und presste sie – durch Ästhetisierung, Naturinszenierungen und Historisierungen – in ein Konzept von Authentizität,[1] um den dringend notwendigen Image-Wandel für die ganze Region einzuleiten. Auch im deutschen Fall ist die Bilanz nüchtern: Die Zeche Zollverein mit ihrer Rem Koolhaas-Treppe und dem Schwimmbad in der Kokerei ist eine kunstkulturelle Insel im Essener Norden geblieben – eine Attraktion für Tourist*innen. Fragt jemand danach, was die Nachbarschaft davon hat?
Der offensichtliche Unterschied zwischen den US-Parks und dem Ruhrgebiet besteht aber darin, dass in Deutschland die Immobilienpreise in der direkten Nachbarschaft nicht gestiegen sind und es somit zu keiner Verdrängung kam. Die Gentrifizierung scheint sich vom Dortmunder Phönix-See nicht bis in den nahegelegenen Brennpunkt Hörde ausgebreitet zu haben. Doch der Vergleich verfälscht die Perspektive, wie Loughran, mit Bezug auf die Arbeiten von Benjamin Shepard und Greg Smithsimon,[2] argumentiert. Denn es gibt in allen Städten jene „under-used white elephants“ (S. 176), Parks, die wenig genutzt werden. Sie sind die stillen Reserven des Immobilienmarkts für Investitionsmöglichkeiten, die angezapft werden, sobald finanzielle Ressourcen sowie kulturelle Interessen dies erlauben und es lohnenswert erscheint. Die Städte konkurrieren in der Bereitstellung solcher ‚Potenziale‘ und leisten damit einem bestimmten Verständnis von öffentlichen Investitionen Vorschub: Auch wenn weit und breit kein Investor zu sehen ist, opfert man die Aufenthaltsqualität der Grünflächen und Parks. Damit ist natürlich längst nicht gesagt, dass alle Projekte genauso ‚erfolgreich‘ sein werden wie das glänzende Beispiel High Line.
Grünanlagen inszenieren den Parkbesuch als ein ästhetisches und pädagogisches Erlebnis und bestätigen auf diese Weise privilegierte Kulturpraktiken der Mittelschicht.
Kevin Loughran unterbreitet drei Vorschläge, um der von ihm skizzierten Entwicklung entgegen zu wirken. Der erste betont die Notwendigkeit, Parks als ein Thema der öffentlichen Gestaltung zu verstehen, anstatt ihre Planung Allianzen zu überlassen, die private Interessen verfolgen. Der Punkt dürfte vor allem für die Parkplanung in den USA relevant sein, wo private Investoren eine erhebliche Rolle spielen. Zweitens schlägt Loughran vor, die Verbindungslinien zwischen „race, capital, and the aethetics of nature“ (S. 181) zu dekolonialisieren. Damit zielt er auf die (subtile) Vorherrschaft weißer Mittelschichtsvorstellungen über Natur und Ästhetik, wodurch Unterschiede in den Gestaltungs- und Nutzungsvorstellungen von Parks überdeckt werden. Weil sich die Ästhetik – etwa im Gegensatz zur Aufenthaltsqualität – als universalistisches Prinzip der Parkgestaltung etabliert hat, sind die neuen postindustriellen Landschaften nicht in der Lage, das dringende Bedürfnis nach Ruhe und Erholung zu befriedigen. Darauf wären aber insbesondere Menschen mit geringem Einkommen in zu kleinen Wohnungen angewiesen. Stattdessen inszenieren die Grünanlagen den Parkbesuch als ein ästhetisches und pädagogisches Erlebnis und bestätigen auf diese Weise privilegierte Kulturpraktiken der Mittelschicht. Loughrans kritische Perspektive auf Parkgestaltung hat bislang noch nicht in den deutschen Diskurs Eingang gefunden, dabei ist sie sicherlich auch für die hiesige Landschaftsästhetik von Bedeutung. Alternative könnte man, Loughrans dritter Vorschlag, die Gebiete sich selbst überlassen, die Natur schlicht ihre Arbeit tun lassen. Somit würde kein Geld für den Erhalt einer inszenierten Landschaft verschwendet und man hielte keine rassistischen und ungleichen Räume instand.
Loughrans Buch ist eine notwendige Kritik an der oftmals oberflächlichen Betrachtung von ‚gelungenen‘ Beispielen der Neugestaltung postindustrieller Orte. Offensichtlich ist es wesentlich komplexer, diese Orte tatsächlich so zu gestalten, dass sie auch soziale Innovationen ermöglichen und vorhandene Ungleichheiten zu überwinden versuchen. Die Debatte darüber müsste auch in Deutschland endlich beginnen. Wie eine solche Analyse vorzunehmen ist, kann man in Parks for Profit anschaulich lernen.
Fußnoten
- Frank Eckardt, Interkulturalität in der „Authentischen Stadt“. Chicago, New Orleans und New York als Beispiele einer neuen Urbanität, in: Michael Wenzel (Hg.), Interkulturelle Schauplätze in der Großstadt. Kulturelle Zwischenräume in amerikanischen, asiatischen und europäischen Metropolen, München 2015, S.149–160.
- Benjamin Heim Shepard / Gregory Smithsimon, Beach Beneath the Streets. Contesting New York City's Public Spaces, New York 2011.
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Henriette Liebhart.
Kategorien: Arbeit / Industrie Kultur Kunst / Ästhetik Stadt / Raum
Zur PDF-Datei dieses Artikels im Social Science Open Access Repository (SSOAR) der GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gelangen Sie hier.
Empfehlungen
Reflexionen in den fiktiven Figuren des Pop
Rezension zu „Neon / Grau“ von Anna Lux und Jonas Brückner
Wo sind die Kühe hin?
Rezension zu „Countryside. A Report“ von Rem Koolhaas / AMO
