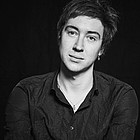Les Back, Marc Ortmann | Interview | 10.04.2024
Musik ist eine Form der Soziologie
Les Back im Gespräch mit Marc Ortmann
Les, Sie bezeichnen Ihr Schreiben als eklektisch. Was meinen Sie damit? Wie schreiben Sie als Soziologe?
Nun, ich nehme an, mein Schreiben ist eklektisch, weil ich verschiedene Formen des Schreibens praktiziere – Journalismus, Memoiren, Begleithefte für Musikalben, soziologische und kulturwissenschaftliche Essays, studentenorientierte Lehrbücher und ethnografische Forschungsmonografien. Eklektisch ist auch die Sammlung an Themen, über die ich schreibe – von Sozialtheorie, Rassismus und Multikultur über Sport, Musik und Populärkultur bis hin zum städtischen Leben, hier von Graffiti bis zu der Frage, wie die soziale Klasse die Weihnachtsdekoration in den Häusern beeinflusst. Ich erinnere mich, dass ich einmal von einem Kollegen gefragt wurde: „Les, wie schaffst du es, so viele verschiedene Arten von Texten zu verfassen?“ Meine Antwort war: „Nun, ich schreibe nur auf eine einzige Art… ich schreibe menschenbezogen (people writing)!“
Anfang der 1980er-Jahre begann ich an der Goldsmiths University of London mit dem Studium der Anthropologie oder der sogenannten Sozialanthropologie. Wie meine Freunde Gareth Stanton und Parminder Bhachu gehöre ich zur ‚verlorenen Generation‘ der britischen Anthropologie. Wir wurden als Sozialanthropologen ausgebildet, haben aber in Großbritannien nie in dieser Disziplin gearbeitet. Bis heute denke ich, dass der anthropologische Fokus das Herzstück meiner Arbeit als Soziologe darstellt. Claude Lévi-Strauss hat seine eigene Antwort auf diese Frage im dritten Band der strukturalen Anthropologie, in Der Blick aus der Ferne (1985), festgehalten. Der Wert der Anthropologie besteht ihm zufolge darin, die Engstirnigkeit des westlichen Denkens aufzubrechen und die kulturelle Vielfalt zu betonen, die im Hinterland der menschlichen Existenz zu finden ist. Die Aufgabe der Ethnografie – abgeleitet von dem griechischen Wort ethnos für „Rasse, Volk, Nation“ und grapho für „ich schreibe“ – bestand darin, Porträts der verschiedenen menschlichen Kulturen und Kosmologien anzufertigen und zu vergleichen. Wie Lévi-Strauss jedoch bemerkte, blieb eine Ambiguität im Kern dieser Version der anthropologischen Berufung bestehen, nämlich zwischen dem Wunsch, die Vielfalt der Menschheit zu erfassen, und dem Gefühl, dass es auch Ähnlichkeiten und geteilte Strukturen gibt.
Ich möchte die Überlegungen von Lévi-Strauss nutzen, um Ihre Frage danach, wie ich schreibe, zu beantworten. Anstatt nach großen Unterschieden zu suchen, um diese zu vergleichen, bin ich der Meinung, dass die [soziologische, M.O.] Praxis – oder das, was ich die Kunst des Zuhörens, Lernens, Erzählens und Zeigens genannt habe – gut geeignet ist, um zu verstehen, wie sich Kulturen miteinander vermischen, sich voneinander entfernen und in bestimmten Kontexten verortet sind, während sie über Ort und Zeit hinweg in Beziehung zueinander stehen. Das Nahe beinhaltet immer den Blick aus der Ferne, aber nicht ganz so, wie Lévi-Strauss das gemeint hat.
Das neuerdings wiedererwachte Interesse an der Ethnografie hat sowohl Bestürzung als auch Begeisterung ausgelöst. Tim Ingold hat darauf hingewiesen, dass es den Anschein hat, als würden Verweise auf die Ethnografie überall auftauchen. ‚Ethnografisch‘ ist zu einer sehr ungenauen Vorsilbe für fast alles geworden: ethnografische Begegnung, ethnografische Feldforschung, ethnografische Methode, ethnografischer Film, ethnografische Theorie und Autoethnografie. Er beklagt, dies sei zu einem „modischen Ersatz für das Qualitative“ geworden. Seiner Argumentation nach wird die Ethnografie zu stark vereinfacht und auf ein positivistisches Instrument reduziert, um die Konturen und diskreten Formen der menschlichen Kultur zu ermitteln und zu behaupten, diese wirklich zu kennen. Schludrige Verwendung verrät schludrige Vorgehensweise. Dies ist nicht das, was Ingold unter einer „ordentlichen, streng anthropologischen Untersuchung“ versteht.
Meiner Ansicht nach spricht er eine wichtige Warnung an Forschende aus, wenn er zu mehr Präzision in unserer Sprache und bei unseren Zielsetzungen aufruft. Seine Betonung, die Anthropologie sei eine Art des Lernens, die sich nicht auf das beschränkt, was wir ‚im Feld‘ tun, ist für meine Arbeit als Schriftsteller relevant. Vielleicht hat er recht, dass die Ethnografie – als Schreiben über Menschen oder, wie ich es nennen möchte, als Schreiben mit Menschen oder vielleicht einfach nur als menschenbezogenes Schreiben (people writing) – eine angemessenere Form erhalten muss.
Ich spüre eine Sehnsucht bei den Student:innen, in globalem Maßstab zu denken. Sie wollen Wege finden, um die komplexen Zusammenhänge zu verstehen, die sich vor ihren Augen, aber auch in ihrem Leben abspielen. Außerdem glaube ich, dass junge Menschen frustriert sind von dem, was sie als engstirnige politische Kultur empfinden, die, wie Zygmunt Bauman sagt, von „starken Männern und Frauen“ wie Donald Trump und Marine La Pen propagiert wird, deren Antwort auf eine Welt der getrennten Verbundenheit (divided connectedness) darin besteht, Mauern zu errichten und sich hinter diese zurückzuziehen. Es gibt noch etwas anderes, das den ungenierten Provinzialismus der Post-Brexit-Ära in Großbritannien befremdlich macht. Kommentator:innen wie Melanie Phillips applaudieren einer Rückkehr zum ‚Kirchturmdenken‘, und die frühere Premierministerin Theresa May lädt uns fröhlich dazu ein, zu ihr in die Einzäunung eines sepiagefärbt Little Englandism zu kommen. Der Widerstand gegen all dies lässt die Reihen unserer Studiengänge wachsen, ebenso wie die Energie junger Menschen, die sich zu dem hingezogen fühlen, was Paul Gilroy eine planetarische oder bewegende „offshore-blaue“ humanistische Neugier nennt.
Von der Neugier zurück zum Schreiben: Was halten Sie von Schreibroutinen? Haben Sie welche?
In der Tat, ich bin fasziniert von den Routinen und Ritualen von Schriftsteller:innen. Meine eigenen sind unbeständig. Alle Ratgeber über das Schreiben von Büchern heben die Bedeutung von Routine, Disziplin und Produktivität hervor. Gute Beispiele sind Bücher wie Paul Silvias How to Write a Lot (2007) oder Helen Swords Air & Light & Time & Space (2017). Sie betonen, wie wichtig es ist, praktische, routinemäßige und affektive Strukturen zu schaffen, um die Anzahl der auf unseren Festplatten gespeicherten Textdateien zu erhöhen. Ich halte diese Bücher für unglaublich hilfreich, aber manchmal haftet ihnen auch ein Hauch von Puritanismus an. Das akademische Leben an der modernen Universität ist manchmal so chaotisch, es erfüllt die Bedingungen für Routine nicht. Ich finde, wir müssen uns die Zeit zum Schreiben stehlen, wo immer wir dazu die Gelegenheit haben. Deshalb scheinen mir mittlerweile Zwischenräume – unterwegs, im Zug oder im Flugzeug – viel günstiger. Zudem besteht mein Brotberuf zunehmend aus reiner ‚Textverarbeitung‘ als Lesender und Schreibender. Wenn das Telefon lautlos gestellt ist und die E-Mail-Benachrichtigungen ausgeschaltet sind, beginnt für mich heutzutage das Schreiben.
Welche Qualen sind für Sie mit dem Schreiben verbunden und wie gehen Sie damit um?
Ja, ich denke, wir können es mit den Qualen auch übertreiben... Sie helfen uns, unsere Kreativität glamouröser und gepeinigter zu machen. Ich finde es wirklich schwer, mit dem Schreiben zu beginnen. Allein der Anfang ist manchmal eine große Anstrengung. In meinem aktuellen Job, der eine große administrative Verantwortung mit sich bringt, ist die Zeit zum Schreiben sehr knapp – sie ist wirklich gestohlene Zeit. Ich habe noch nie an einem Schreibworkshop oder einer Schreibwerkstatt teilgenommen, aber ich kann mir vorstellen, dass es unglaublich hilfreich ist, von Leuten umgeben zu sein, die sich alle gegenseitig sagen: „Okay, jetzt halt die Klappe und schreib!“
Ich selbst bin ein Autodidakt... Das liegt zum Teil daran, dass ich in einem Haushalt aufgewachsen bin, in dem es keine Bücher gab und es undenkbar war, Schriftsteller zu werden oder fürs Lesen und Schreiben bezahlt zu werden. In dieser kleinbürgerlichen Welt, in der die Menschen handwerklichen oder gewerblichen Arbeiten nachgingen, gab es außer Einkaufslisten und Geburtstagskarten keine etablierten Konventionen oder Beispiele für das Schreiben. Wie viele andere Intellektuelle aus der Arbeiterklasse musste ich mir selbst beibringen, wie man mit der Öffentlichkeit kommuniziert. Aus diesem Grund sind öffentliche Bibliotheken für mich immer noch ein Heiligtum. Der Glasgower Komiker Billy Connolly hat es auf den Punkt gebracht: „Die Leute sagen oft, dass Fußball und Boxen die Auswege aus der Arbeiterklasse sind und dass sie dein Ticket raus aus dieser Art von Leben sind, wenn du es verlassen willst. Aber für mich ist die Bibliothek der Schlüssel. Dort befindet sich der Fluchttunnel.“ Für mich ist auch das Schreiben so, es ist das Licht am Ende des Tunnels. Ja, es gibt die Qualen, aber Schreiben kann auch eine Rettung sein. Ich glaube, wenn man mit seinem schriftstellerischen Selbst verbunden bleibt – und Gott weiß, wie schwer es ist, dies praktisch und kreativ zu tun –, dann sehnt man sich danach, im Moment des Schreibens ein neues Selbstgefühl zu entwickeln. Die Bibliothek und das Lesen sind der Fluchttunnel, wie Billy sagt, aber das Schreiben schafft einen heimeligen Ort im Lichte unseres besten Verständnisses der Natur der Dinge.
Stichwort Lesen: Verändern sich die Texte, die Sie lesen, für Sie, wenn sie in Ihr eigenes Werk eingeflossen sind?
Ja, auf jeden Fall. Die Bücher erweitern und verkleinern sich dadurch zugleich. Die Stimmen und Einsichten der Autor:innen werden irgendwie zu Figuren in der Geschichte, die ich erzählen möchte. Das ist es, was ich mit Vergrößerung meine. Im Gegensatz dazu wehren sich die Bücher manchmal gegen die Rolle, die ich ihnen in meiner Geschichte zuweise. Sie weisen zurück, widersprechen mir und bestehen darauf, dass ich das Drehbuch umschreibe. Ich lese sie erneut und sie fordern mich auf, sie neu zu bewerten. Antonio Gramscis Gefängnishefte sind für mich so ein Fall. Ich dachte, ich wüsste, was er mit der Idee des ‚organischen Intellektuellen‘ meinte, aber später wurde mir klar, dass meine Charakterisierung doch nicht ganz richtig ist. Für Gramsci sind organische Intellektuelle eher Funktionäre der herrschenden Macht als ‚Gossensoziologen‘ (gutter sociologists) von unten. Gramsci raunzt mich aus dem Text an: „Du hast es falsch verstanden!!!“ Das ist der Moment, wenn die Ideen in diesen Büchern herabgesetzt werden und sie auf eine faire Behandlung bestehen.
Gegen Ende seines Lebens schrieb John Berger eine schöne Reflexion über die Praxis des Schreibens. Sie wurde 2014 im Guardian veröffentlicht. Für ihn geht es beim Schreiben um „die Ahnung, dass etwas erzählt werden muss und dass, wenn ich nicht versuche, es zu erzählen, die Gefahr besteht, dass es nicht erzählt wird“. Der Streich, den uns die Sprache spielt, besteht in der Vorstellung, dass Sprache als Medium und die Intentionen von Autor:innen übereinstimmen. So verhält es sich aber überhaupt nicht. Manchmal werden die neuen Wörter, die wir schreiben, von den bestehenden abgelehnt. Berger beschreibt das so: „Nachdem ich ein paar Zeilen geschrieben habe, lasse ich die Worte wieder in die Kreatur ihrer Sprache zurückgleiten.“ Manchmal werden die neuen Wörter in die ‚Plauderei‘ (confabulation) des bestehenden Textes aufgenommen. Ein anderes Mal passen sie einfach nicht und werden gebeten, durch die Tür mit der Aufschrift „delete“ zu gehen. Berger schlussfolgert: „Die Wörter fechten den Gebrauch an, den ich ihnen gegeben habe. Sie stellen die Rollen, die ich ihnen zugewiesen habe, infrage.“ Was Berger anstrebt, ist Übereinstimmung und Harmonie, oder das, was er als „leises Gemurmel einer vorläufigen Zustimmung“ bezeichnet. Das ist es, was ich mir von der Bricolage des Lesens und Schreibens erhoffe, dieses übereinstimmende Geflüster aller Wörter auf der Seite.
Sie haben unter anderem den Einfluss der Musik auf Soziolog:innen untersucht. Welche Bedeutung hat die Musik für die Erforschung des Sozialen? Gibt es für Sie auch eine Beziehung zwischen Musik und Schreiben?
Nun, Soziolog:innen haben sehr oft ein außerakademisches Leben als Musiker:innen. Der kürzlich verstorbene Howard S. Becker entwickelte seine soziologische Sichtweise des Lebens als Pianist in den Chicagoer Jazzclubs der 1940er-Jahre. Seine berühmten Ideen über „labelling“ und „deviance“ entstanden allabendlich in den Clubs von Chicago, wo Polizisten mit Kriminellen interagierten. Ebenso gibt es eine Verbindung zwischen Emma Jacksons Leben als Bassistin der britischen Popband Kenickie und ihrer feministischen Punk-Soziologie. Musizieren zu lernen bedeutet, das hat Antoine Hennion gezeigt, in eine Kultur mit ihren Regeln, Sprachen und Ritualen einzutauchen, weshalb er meint, dass Musik eine Form der Soziologie ist. Wer Musiker:in werden will, studiert also implizit Soziologie; wenn das zutrifft, dann würde ich behaupten, dass es auch umgekehrt der Fall ist.
Ich habe gerade eine Studie über Soziolog:innen abgeschlossen, die auch Musiker:innen sind, und darüber, was sie aus ihrem Musiker:innenleben lernen. Es bietet ihnen ein Interpretationsinstrument oder eine praktische Form der Erkenntnis. Dies gilt nicht nur für diejenige Soziologie, die sich eher am geisteswissenschaftlichen Ende des disziplinären Spektrums befindet, sondern auch für Wissenschaftler:innen, die die Soziologie als rein empirische Wissenschaft betrachten. Das Erlernen der Notation oder musikalischer Kommunikationsformen, die nicht aus Worten aufgebaut sind, ist auch eine Schulung in den unausgesprochenen und dennoch strukturierten Aspekten der Kultur. Eine Ausbildung im nonverbalen und nichtdiskursiven Bereich kann die Aufmerksamkeit für das Fühlen, die Berührung steigern und die Fähigkeit fördern, sich auf das soziale und kulturelle Leben einzustimmen. Sie führt auch zu einer Wertschätzung der Art und Weise, wie Improvisation und Interaktion den Kern der Choreografie des Lebens und der Inszenierung von Kultur bilden.
Musiker:in zu sein ist auch ein Ansporn, den Campus zu verlassen. Das war es für mich als semiprofessioneller Gitarrist (journeyman guitarist) immer. Es ist eine Visitenkarte und ein Pass in viele andere soziologische Gebiete, für die die einzige Zugangsvoraussetzung darin besteht, eine Melodie spielen zu können – oder nicht. Das ist an und für sich ein schönes Geschenk und eine Chance. Es bedeutet, dass man regelmäßig auf alternative Wertesets und Vorstellungswelten trifft.
Ich behaupte nicht, dass das Musikerdasein der einzige Weg ist, die Gesellschaft besser zu verstehen. Musik als Beruf hat auch nicht von Natur aus etwas Befreiendes. Mein Argument ist, dass alle Kulturschaffenden ein Hinterland für ihr Handwerk brauchen, das die Vorstellungskraft nährt, sei es zur Erholung oder zum Schaffen. Der Druck, der auf akademische Autor:innen – insbesondere auf junge Wissenschaftler:innen – ausgeübt wird, führt dazu, dass der doppelte Zwang der Spezialisierung und der Professionalisierung die Fähigkeit einschränkt, sich inspirieren zu lassen, indem man den Campus verlässt. Haben wir dafür überhaupt Zeit, könnte man berechtigterweise fragen. Wer den Anforderungen des Campus nachkommt, also lehrt, Bücher schreibt und veröffentlicht, dem bleibt sicherlich nicht genügend Zeit zum Üben.
Die Kraft der Musik besteht darin, uns auf die unausgegorenen, noch nicht vorhandenen oder utopischen Bewegungen der Fantasie aufmerksam zu machen. Musik hat ebenso die Kraft, nicht nur das zu beschwören, was ist, sondern auch das, was gewesen sein könnte. Das ist der Grund, warum sie für uns als Schriftsteller:innen gut sein könnte. Einen solchen Soundtrack zu haben, führt unser Denken aus der Stille heraus und in neue Richtungen, zukünftigen Worten entgegen. Manchmal, wenn ich beim Schreiben nicht weiterkomme, nehme ich einfach die Gitarre und spiele etwas. Das löst zwar nicht jedes Problem, das ich im Kopf habe, aber irgendwie schafft es die Musik, mein Denken zu befreien und mir Zeit zu geben, damit mir die richtigen Worte kommen können.
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Henriette Liebhart.
Kategorien: Anthropologie / Ethnologie Kultur Kunst / Ästhetik Universität
Zur PDF-Datei dieses Artikels im Social Science Open Access Repository (SSOAR) der GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gelangen Sie hier.
Teil von Dossier
Über Schreiben sprechen
Vorheriger Artikel aus Dossier:
Bücher aus einem anderen Blickwinkel betrachten
Nächster Artikel aus Dossier:
Nachdenken über die ästhetische Form von Ideen
Empfehlungen
Indian Fair and European White
Rezension zu „Skin Colour Politics: Whiteness and Beauty in India“ von Nina Kullrich
A new kind of citizenship? Hipster zwischen Wunsch und Wirklichkeit
Rezension zu „Hipsterism. A Paradigm for Modernity“ von Tara Semple