Nele Noesselt | Rezension | 09.03.2021
Chinas langer Marsch zum dritten Weg
Rezension zu „Enterprises, Industry and Innovation in the People's Republic of China“ von Alberto Gabriele
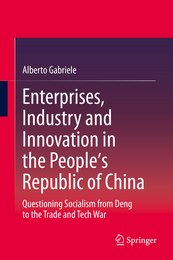
Mit seiner Monographie zur industriellen Transformation der Volksrepublik China in den letzten 40 Jahren legt Alberto Gabriele eine umfassende Analyse der nationalen Innovationssysteme und der Restrukturierung und Reform der chinesischen Industriesektoren vor. Der Autor verfügt über 30 Jahre Arbeitserfahrung als UN-Wirtschaftsexperte in New York und Genf mit zahlreichen Stationen in Afrika, Asien sowie Lateinamerika. Seine Forschungsschwerpunkte umfassen Entwicklungsprozesse des internationalen Handels und der Industriepolitik im Allgemeinen – sowie die Entwicklungs- und Transformationswege der kommunistischen Ein-Parteien-Systeme China, Kuba und Vietnam im Speziellen.
Gabrieles Analyse des Wandels des chinesischen Industriesektors stützt sich auf Datensätze der Weltbank und das China Statistical Yearbook, erweitert um westlichsprachige Sekundärliteratur. Die Abhandlung ist abstrakt-chronologisch und zugleich thematisch untergliedert. Die Einleitung liefert einen fakten- und zahlenbasierten Überblick über das allgemeine Wirtschaftswachstum der postmaoistischen Volksrepublik China, die Entwicklung im Bereich Handel und Finanzen, die Funktion ausländischer Direktinvestitionen, die Felder Forschung und Entwicklung (Research & Development, R&D) sowie Innovation wie auch über die Erfolge Chinas im Bereich der Reduzierung absoluter Armut.
Hierauf folgt eine fokussierte, differenzierte Analyse der Dekollektivierung, Restrukturierung und Privatisierung im ruralen und urbanen Sektor. Dabei betont Gabriele die zentrale Rolle des Haushaltsverantwortlichkeitssystems im Bereich des agrarischen Sektors und die Motorwirkung von Township and Village Entreprises (TVEs) für die Anfangsphase des nach 1978 einsetzenden chinesischen Wirtschaftsbooms. Die chinesischen TVEs, wie Gabriele hervorhebt, zeichneten sich durch eine starke Heterogenität und hochgradige informelle Anpassungsfähigkeit an lokale Strukturen und Entwicklungskontexte aus. Gerade dies ermöglichte, wie der Autor anhand ausgewählter empirischer Fallbeispiele der Sekundärliteratur untermauert, die schnelle Orientierung in Richtung marktwirtschaftlicher Grundmuster und die generelle lokale Produktivitätssteigerung. Auch die Regelung, dass Produktionseinheiten nach Erfüllung der vorgegebenen Quoten ihre „Überproduktion“ auf dem „freien“ Markt verkaufen und Gewinn erzielen durften, war ein zentraler Faktor, mit dem Anreize für eine schnelle Produktionssteigerung gesetzt wurden. Die TVEs, die Inkubatorzellen der flexiblen Industrialisierung im ruralen Raum, verloren über die Zeit in einigen Regionen jedoch ihren Katalysatoreffekt, nicht zuletzt da im Zuge der Urbanisierung Teile des ruralen Raumes in einen neuen urbanen Sektor überführt, TVEs teils privatisiert oder sogar aufgelöst wurden.
Den TVEs stellt Gabriele die Staatunternehmen (State-Owned Enterprise, SOE) gegenüber und diskutiert die verschiedenen Phasen der Restrukturierung und Reform mit dem Ziel der marktorientierten Effizienz- und Produktivitätssteigerung – unter besonderer Berücksichtigung der Rolle der SASAC (State-owned Assets Supervision and Administration Commission), einer Sonderkommission des chinesischen Staatsrats zur Koordination und Kontrolle der Modernisierung der Staatsunternehmen. Die Reformen und Modernisierungspläne nach 1978 hatten die Großbetriebe der staatlichen Schlüsselindustrie(n) im Blick, kleinere Staatsunternehmen wurden privatisiert – wie der Slogan zhua da fang xiao („die Großen halten, die Kleinen freilassen“) dokumentiert.
In Anlehnung an die Arbeiten von Szamosszegi und Kyle sowie die Studien von Scissors beleuchtet Gabriele die Probleme der Abgrenzung zwischen Privat- und Staatsunternehmen in der VR China und unterstreicht die Entstehung marktorientierter Unternehmensformen mit Hybridcharakter.[1] Er operiert hierbei mit der Sonderkategorie des „nicht-kapitalistischen marktorientierten Unternehmens“ (Non-Capitalist Market-Oriented Entreprise, NCMOE). Die Reformbeschlüsse des 3. Plenums (2013), auf die er in diesem Zusammenhang indirekt verweist, sehen vor, dass ein Teil der von Staatsunternehmen erwirtschafteten Überschüsse abgeführt und in den Ausbau der Sozial(versicherungs)systeme investiert werden soll. Dies und die generelle Bedeutung staatseigener Unternehmensformen für Systeme, die sich formal dem Sozialismus verschrieben haben und auf staatsgelenkte Innovation setzen, sichern den Fortbestand der als systemrelevant eingestuften chinesischen Staatsunternehmen, bei denen es sich de facto um Monopole handelt.
Der zweite Teil des Buches widmet sich dem nationalen Innovationssystem der Volksrepublik China und der Priorisierung von Wissenschaft und Technologie (Science and Technology, S&T) im Zuge der chinesischen Wirtschaftsreformen (beginnend bereits, wie Gabriele zeigt, während der Mao-Ära). In der post-maoistischen Reformära, insbesondere aber mit dem Eintritt in das 21. Jahrhundert sind im Auftrag der chinesischen Zentralregierung Programme, Leitlinien und Aktionspläne erarbeitet worden, welche darauf abzielen, die VR China als weltweit führendes Zentrum der innovativen Entwicklung neuer Technologien zu positionieren. Dies dokumentiert nicht zuletzt der 2006 veröffentlichte 15-Jahres-Plan für Wissenschaft und Technologie, der das Jahr 2020 als Eckdatum für die Etablierung eines verbesserten nationalen Innovationssystems festlegt.
Die ambitionierte Strategie des Staatsrats Made in China 2025 etabliert die Grundlagen für eine Umsteuerung von Imitation und auftragsbasierter Zulieferung für den Weltmarkt hin zu Innovation und eigenständiger Produktentwicklung. Gabriele beleuchtet die Rolle, die den verschiedenen privaten und staatlichen Akteuren bei der Umsetzung dieser Strategien und beim Ausbau der Innovationskapazitäten zukommt. Staatliche Universitäten und Forschungseinrichtungen spielen dabei eine Schlüsselrolle, Staatsunternehmen leisten einen wichtigen Beitrag im Bereich Forschung und Entwicklung – Innovation ist nicht auf den privatwirtschaftlichen Sektor beschränkt.
Insbesondere im IT- und AI-Bereich sind chinesische Unternehmen weltweit erfolgreich; die VR China verzeichnet einen rapiden Anstieg chinesischer „AI unicorns“ (Start-ups mit einem Marktwert von über 1 Milliarde US-Dollar). Wie Gabriele gestützt auf die vorliegende Literatur zu Chinas führenden IT-/AI-Unternehmen darlegt, sind nicht alle von diesen rein im privatwirtschaftlichen Sektor zu verorten. ZTE beispielsweise wird von Milhaupt und Zheng mit Blick auf die Eigentumsstrukturen als Staatsbetrieb, mit Blick auf die Managementstrukturen hingegen als Privatunternehmen eingestuft. Das Oszillieren zwischen Staatskapitalismus und sozialistischer Marktwirtschaft und die Hybridität der chinesischen Eigentumsformen und Unternehmensstrukturen in den verschiedenen Transformationsphasen der Reformära greift Gabriele in seinen dem Buch angefügten essayistischen Bestandsaufnahme des chinesischen Sozialismus abschließend auf – immer wieder darauf verweisend, dass diese Prozesse noch nicht final abgeschlossen seien und keine abschließende Klassifizierung und Kategorisierung vorgenommen werden könne. Der Handelsdisput und Wettbewerb zwischen Washington und Peking um die weltweite Führungsrolle in den Bereichen Technologie und Innovation bilden nur einen vieler Faktoren, die den globalen Erfolg chinesischer AI Unicorns ausbremsen und die Innovationskräfte des Systems nachhaltig schwächen könnten.
Gabrieles Untersuchung liefert einen kaleidoskopischen Blick auf die – oftmals hybriden – Unternehmens- und Eigentumsstrukturen der post-maoistischen VR China. Die Rekonstruktion der Transformation und Reform der chinesischen Unternehmenssektoren erfolgt gestützt auf Statistiken und illustrierende Miniaturen ausgewählter empirischer Fallbeispiele. Die in Teilen akribische Aufarbeitung statistischer Daten bietet dem Leser einen vertieften Einblick in die Realität des chinesischen Markt-Sozialismus / Markt-Kapitalismus; die Detailaufarbeitung erschwert allerdings passagenweise den Lesefluss. So verlangt die Auseinandersetzung mit dem dargebotenen Zahlenmaterial und den komplexen Argumentationsketten eine intensive, konzentrierte Lektüre.
Das Buch ist zudem primär für Leser geeignet, die bereits über Grundkenntnisse des chinesischen Wirtschaftssystems und die Entwicklungsstufen der Politischen Ökonomie der VR China verfügen – denn Gabriele verzichtet auf eine Einbettung in den Kontext ihrer politischen Geschichte und setzt voraus, dass die Leser mit dem Grundaufbau des Ein-Parteien-Systems vertraut sind. Vorsicht ist zudem bei einzelnen Quellenverweisen auf (englische) Texte chinesischer Autoren geboten – hier scheint es im Text gelegentlich zu Konfusionen mit Blick auf den Nachnamen gekommen zu sein (der chinesische Premierminister etwa heißt weiterhin Li mit Familiennamen, Keqiang ist der Vorname).
Da der Autor durchweg zahlenbasiert argumentiert, wäre zudem eine kritischere Auseinandersetzung mit den Widersprüchen und Unstimmigkeiten zwischen den verschiedenen Datensätzen (und den diesen unterliegenden Erhebungsverfahren) wünschenswert gewesen – wobei die Annahme eines in sich (weitgehend) kohärenten Datensatzes in den Tabellen und Übersichten des vorliegenden Bandes wiederum auch einen relativ schnellen Einstieg in das Verständnis der Grundlagen des chinesischen Transformationsprozesses ermöglicht. Der sozialwissenschaftliche Mehrwert des Buches liegt insbesondere darin, dass die von Gabriele vorgelegte präzise und datengesteuerte Analyse ökonomischer Prozesse und Strukturen eine abstrakte, objektivierende Sicht auf die komplexen Entwicklungen in China liefert (und Polit-Diskurse ebenso wie etwaige Ideologeme ausklammert).
Es bleibt abzuwarten, welche neuerlichen Umsteuerungen mit dem für 2021 in Planung befindlichen 14. Fünf-Jahres-Plan der VR China erfolgen werden. Auch das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahlen vom November des letzten Jahres und die hieraus resultierenden Implikationen für die sino-amerikanischen Beziehungen könnten in den kommenden Monaten Auswirkungen auf den chinesischen Wirtschaftstransformationsprozess und den weiteren Ausbau des nationalen Innovationssystems entfalten. Nichtsdestotrotz: Ungeachtet möglicher Neuorientierungen des chinesischen Wirtschaftsmodells bleibt Gabrieles Analyse lesenswert, da sie einen vertieften Einblick in die vielschichtigen Facetten der chinesischen Industrie- und Innovationsmuster seit 1978 unternimmt und dabei axiomatische Grundmuster der für China so charakteristischen pragmatischen Flexibilität identifiziert.
Fußnoten
- Vgl. Andrew Szamosszegi / Cole Kyle, An Analysis of State-owned Enterprises and State Capitalism in China, in: U.S.-China Economic and Security Review Commission, 26.10.2011, https://www.uscc.gov/research/analysis-state-owned-enterprises-and-state-capitalism-china (8.3.2021); Derek Scissors, China’s SOE Sector Is Bigger Than Some Would Have Us Think, in: East Asia Forum, 17.5.2016, https://www.eastasiaforum.org/2016/05/17/chinas-soe-sector-is-bigger-than-some-would-have-us-think/ (8.3.2021).
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Samir Sellami.
Kategorien: Arbeit / Industrie Sozialer Wandel Wirtschaft
Zur PDF-Datei dieses Artikels im Social Science Open Access Repository (SSOAR) der GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gelangen Sie hier.
Empfehlungen
Deutschlands Wege in die Moderne
Rezension zu „From Old Regime to Industrial State. A History of German Industrialization from the Eighteenth Century to World War I“ von Richard H. Tilly und Michael Kopsidis
Die netten Nationalisten von nebenan
Rezension zu „Le vote FN au village. Trajectoires de ménages populaires du périurbain“ von Violaine Girard
Die bäuerliche Welt von Gestern
Rezension zu „Ein Hof und elf Geschwister. Der stille Abschied vom bäuerlichen Leben in Deutschland“ von Ewald Frie
