Lilian Hümmler | Rezension | 15.02.2022
Von struktureller Entstimmlichung und Scham
Rezension zu „Sprechen und Schweigen über sexualisierte Gewalt. Ein Plädoyer für Kollektivität und Selbstbestimmung“ von Lilian Schwerdtner
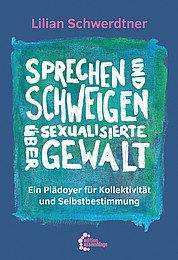
Feministische Mobilisierungen wie Un violador en tu camino oder #MeToo thematisieren in den vergangenen Jahren lautstark und quer über den Globus die Omnipräsenz sexualisierter Gewalt. Neben Forderungen nach dem Schutz von Betroffenen prangern die Akteur:innen vor allem die mangelnde gesellschaftliche Verantwortungsübernahme an. Hier hakt Lilian Schwerdtner mit ihrem Buch Sprechen und Schweigen über sexualisierte Gewalt ein. Sie fokussiert Formen sprachlicher Gewalt, die vermeintlich unbeteiligte Dritte – nach der sexualisierten Gewalt – gegenüber Betroffenen ausüben. Die von der Autorin vielfach betonte strukturelle Dimension dieser sprachlichen Gewalt ermöglicht gesellschaftstheoretische Analysen ausgehend von sexualisierter Gewalt, was insbesondere aus soziologischer Perspektive sehr zu begrüßen ist.
Das Buch gliedert sich in fünf Kapitel, die von einer Einleitung und einem Schluss gerahmt sind. Das erste Kapitel führt zunächst in den umfangreichen Komplex um sexualisierte Gewalt und Rape Culture ein, gibt den Leser:innen hilfreiche analytische Instrumente wie Verletzungsoffenheit und Verletzungsmacht (Popitz und Butler) an die Hand und stellt die theoretischen Grundlagen (maßgeblich Butler und Langton) kurz dar. Im Folgenden sind die drei sprechakttheoretischen Ebenen im Anschluss an John L. Austin strukturgebend: der lokutionäre Sprechakt, das heißt die Formulierung von verständlichen Worten (Kap. 2); der illokutionäre Sprechakt, ergo der vollzogene Sprechakt in der sozialen Interaktion (Kap. 3); schließlich der perlokutionäre Sprechakt, folglich die Wirkung oder auch Effekte der Äußerung (Kap. 4). Basierend auf Austins sinnvoller analytischer Trennung zeigt Schwerdtner im Anschluss an die Philosophin Rae Langton, wie auf allen drei Ebenen Betroffene sexualisierter Gewalt zum Schweigen gebracht oder auch entstimmlicht werden: durch „Nicht sprechen können oder nicht sprechen wollen“ (S. 41 ff.) (lokutionär); durch fehlendes Zuhören oder, mit Christina Thürmer-Rohr, durch die „achtlosen Ohren“ der Zuhörer:innen (illokutionär); und durch die Instrumentalisierung ihrer Erzählungen beziehungsweise deren Einhegung in dominante Opferdiskurse (perlokutionär).
Nachdem sie die unterschiedlichen Ebenen sprachlicher Gewalt nachvollziehbar herausgearbeitet hat, nennt Schwerdtner im fünften Kapitel Bedingungen und Beispiele für gelingendes Sprechen über sexualisierte Gewalt. Somit überführt die Autorin die Ergebnisse ihrer vorangestellten Analysen in feministische Leitlinien, etwa „Benennbarkeit bzw. Verfügbarkeit klarer Worte“ (S. 124 f.), „Das Schweigen der Betroffenen hören“ (S. 129 f.) oder – simpel und radikal zugleich – „Kollektivität statt Isolation“ (S. 134). Auch wenn ihr uneingeschränkter Enthusiasmus für DefMa und für #MeToo – die beiden Beispiele für gelingendes Sprechen – etwas oberflächlich erscheint, besticht die gut strukturierte Übersicht in diesem letzten inhaltlichen Kapitel durch Praxisorientierung und Verständlichkeit für ein breites Publikum.
Schwerdtner verdeutlicht die immense Tragweite sprachlicher Gewalt, die trotz ihrer großen Bedeutung für die Betroffenen nur selten systematisch betrachtet wird.
Lilian Schwerdtner löst ihren Anspruch, dem Schweigen und Sprechen über sexualisierte Gewalt mehr Aufmerksamkeit zu widmen und insbesondere deren gewaltvolle Elemente kenntlich zu machen, überzeugend ein und bietet damit Anknüpfungspunkte für zahlreiche Betroffene mit ihren Erfahrungen. Sprachliche Gewalt bedeutet im Kern, dass ihnen sowohl konkrete Einzelpersonen als auch die Gesellschaft als Ganze Handlungsmacht absprechen: „Betroffene von sexualisierter Gewalt werden durch diese Formen sprachlicher Gewalt einer zweiten Gewalterfahrung ausgesetzt, die, wie bereits die erste Gewalterfahrung, auf die Aberkennung ihres Status als sozial anerkannte und handlungsfähige Subjekte zielt (oder sich zumindest so auswirken kann).“ (S. 40) Schwerdtner verdeutlicht hiermit die immense Tragweite sprachlicher Gewalt, die trotz ihrer großen Bedeutung für die Betroffenen nur selten systematisch betrachtet wird.
Darüber hinaus lenkt Schwerdtners Ansatz den Blick auf einen höchst relevanten, aber häufig zu wenig beachteten Aspekt sexualisierter Gewalt – weg von der interpersonalen Ebene zwischen Betroffenen und Täter:innen hin zu einer strukturellen Entstimmlichung, die auch und gerade alle vermeintlich Unbeteiligten einbezieht. Diese Verschiebung der analytischen Perspektive ermöglicht eine Gesellschaftskritik, die von den Betroffenen ausgeht: „Ihr Körper und ihre Psyche sind die Orte der Gewalt und widerlegen damit die Selbstvergewisserung einer Gesellschaft, sexualisierte Gewalt in ausreichendem Maße zu bekämpfen.“ (S. 15)
Zusätzlich zu den sprechakttheoretischen Erkenntnissen versammelt die Autorin zentrale Ereignisse (etwa die Kölner Silvesternacht 2015/2016), Debatten (etwa Sinn und Unsinn von Trigger-Warnungen) und Mobilisierungen (etwa #MeToo) der letzten Jahre in Deutschland. Außerdem stellt sie Ansätze vor, mit denen man sexualisierter und sprachlicher Gewalt entgegenzuwirken versucht (etwa DefMa), und bietet somit einen Überblick über derzeitige Auseinandersetzungen. Dabei schreckt sie nicht vor – berechtigter – Kritik an Praktiken innerhalb linker und feministischer Zusammenhänge zurück.
Umso mehr überrascht die in Teilen fehlende Anknüpfung an geschlechtertheoretische Überlegungen und Konzepte, etwa hinsichtlich der patriarchalen Trennung von Privatheit und Öffentlichkeit, die Aktivist:innen und Wissenschaftler:innen bereits seit den Anfängen der Frauenforschung umfassend kritisieren.[1] Schwerdtner jedoch unterscheidet nach wie vor zwischen öffentlichem Sprechen, das auf politische Veränderungen abziele, und privatem Sprechen, das Heilungspotenzial bereithalte. Zwar belässt sie die Trennung beider Bereiche „bewusst etwas im Vagen“ (S. 11), denn sie sieht und benennt durchaus Schnittmengen wie Soziale Medien oder Selbsthilfegruppen. Dennoch bleibt die Gegenüberstellung von politisch-öffentlichem und heilsam-privatem Sprechen bestehen (S. 11, S. 128 f., S. 133 f.), was – gerade im Kontext sexualisierter Gewalt – hinfällig erscheint. Wenn wir unter Politik im weitesten Sinne die Aushandlung von Regeln des Zusammenlebens verstehen, wie können dann Gespräche über Gewalterfahrungen privat sein? In der gesellschaftlichen Öffentlichkeit kursieren detaillierte Skripte von Aufdeckungserzählungen inklusive Opfernarrativen sowie Täter:innenschutz. So gesehen ist auch das vermeintlich private Sprechen immens politisch, denn einerseits laufen private Gespräche immer Gefahr, diese Skripte zu reproduzieren; andererseits können nur in geschützteren Gesprächssituationen solche Skripte überhaupt umgeschrieben werden: durch aktives und achtsames Zuhören, Beistehen und Tee Kochen, gemeinsames Weinen und Lachen, aber auch durch das Schmieden von Plänen zur Gegenwehr. Und andersherum: Auch die öffentliche Äußerung – ob Zeitungsartikel schreiben oder Parolen skandieren – kann Linderung verschaffen und somit die Heilung fördern.
Als ähnlich irritierend wie die Unterscheidung öffentlich/privat erweist sich Lilian Schwerdtners unkritische Bezugnahme auf das geschlechtertheoretisch umstrittene Konzept der „Selbstbestimmung“. Und das, obwohl sie ihre machtkritischen Überlegungen durchaus überzeugend präsentiert und sich an vielen Stellen als feministisch bewandert, um nicht zu sagen: versiert, erweist. So führt sie mit Bezug auf Linda Martín Alcoff und Rona Torenz nachvollziehbar aus (S. 85 f.), warum Konzepte wie „sexuelle Einvernehmlichkeit“ und „Konsens“ in patriarchalen Strukturen als mindestens ambivalent zu verstehen sind. Wie aber kann unter dieser Prämisse Selbstbestimmung im Handeln von Betroffenen uneingeschränkt möglich sein?
Kritikwürdig erscheint schließlich, wie wenig differenziert die Autorin einen weiten Gewaltbegriff verwendet. Die Vorteile liegen auf der Hand und sind wahrlich nicht zu unterschätzen: Ein weiter Gewaltbegriff ermöglicht jene Momente der Kollektivierung von Betroffenen, die unter anderem für die immense Schlagkraft sorgten, die feministische Mobilisierungen in den letzten Jahren entwickeln konnten. Die Vielgestaltigkeit erlebter Gewalterfahrungen – von vergeschlechtlichter Arbeitsteilung bis Feminiziden – macht die Komplexität von geschlechtsbezogener Gewalt sichtbar. Gerade dann ermöglichen Differenzierungen nicht nur eine schärfere Analyse, sondern auch intensivere Formen der Kollektivierung. Statt in juristischer Manier verschiedene Gewaltformen voneinander abzugrenzen, wäre eine Unterscheidung anhand der Effekte für Betroffene vermutlich sinnvoller, denn nicht jede Vergewaltigung traumatisiert und nicht jede Belästigung kann leichtfertig weggesteckt werden. Eine solche Differenzierung widerspräche keiner Einordnung in ‚das große Ganze‘ – die Gleichzeitigkeit von engem und weitem Gewaltbegriff ist also durchaus denkbar und möglich.
Im Anschluss daran ließe sich die gesellschaftstheoretische Einordnung von Scham und Beschämung in Bezug auf sexualisierte Gewalt schärfer konturieren, die Lilian Schwerdtner nur am Rande streift und letztlich widersprüchlich konzeptualisiert. Nachvollziehbar zeigt sie mit den moralphilosophischen Überlegungen von Hilge Landweer und Christoph Demmerling, dass der Affekt der Scham ein soziales Moment hat. Er setzt die Anerkennung gesellschaftlicher Normen voraus, die sich beim Normenverstoß im dadurch überhaupt erst hervorgerufenen Schamgefühl artikuliert (S. 57 f.). Dass eine patriarchale und heteronormative Gesellschaft die ‚Falschen‘ beschämt oder dazu aufruft, ihre Scham zu überwinden, ist, so bedauerlich und ungerecht es auch erscheint, nur folgerichtig.
Scham ruft nicht Auseinandersetzung, sondern Abwehr hervor, daher ist Beschämung kein sinnvoller Ansatz – umgekehrt ist die Ablehnung von Beschämung noch lange kein Täter:innenschutz.
Wenig zielführend ist es nun, wenn die durchaus berechtigte Kritik an der gesellschaftlichen Beschämung der Betroffenen darin resultiert, dass man andere Positionen im Gewaltakt auffordert, sich zu schämen. Denn wenn sich anstelle der Betroffenen wahlweise die Täter:innen (S. 59) oder die Mitwissenden (S. 61) schämen, sofern sie das nicht eh schon tun, führt dies leider weder zu einer aktiven Reflexion des eigenen Handelns noch zur Übernahme von Verantwortung für konkrete Gewaltakte und erst recht nicht zu strukturellen gesellschaftlichen Veränderungen. Scham ruft nicht Auseinandersetzung, sondern Abwehr hervor, daher ist Beschämung kein sinnvoller Ansatz – umgekehrt ist die Ablehnung von Beschämung noch lange kein Täter:innenschutz. Trotz ihrer moralischen Forderungen, wer sich schämen sollte, erkennt Schwerdtner selbst die „ausgesprochen dysfunktionale[n] Auswirkungen [von Scham], wenn sich dadurch wiederum das Schweigen und die Verschleierung der Gewalt vergrößern“ (S. 61).
Fraglich sind moralische Verurteilungen und Beschämungen von Täter:innen auch im Hinblick auf ihre Effektivität. So hat die argentinisch-brasilianische Anthropologin Rita Laura Segato[2] empirisch fundiert und schlüssig argumentiert, dass Sexualstraftäter – in Segatos Studie ausschließlich männlich und verurteilt – entgegen sozialer und allen voran feministischer Vorstellungen hohe moralische Standards vertreten, ja sich gar als Moralapostel gerieren. Einer patriarchalen und kapitalistischen Logik folgend – so ließe sich in Anlehnung an Rita Laura Segato und Silvia Federici[3] argumentieren – bedarf es der Disziplinierung weiblicher oder dissidenter Körper, vielfach mittels sexualisierter Gewalt.
Nimmt man Segatos Analysen ernst, sind Beschämung und moralische Verurteilungen unter den gegenwärtigen gesellschaftlichen Zuständen nicht zielführend. Konsequent ist vielmehr die Forderung nach einer patriarchats- und somit selbstkritischen Auseinandersetzung der Täter:innen, der Mitwissenden und der gesamten Gesellschaft. So schreibt Schwerdtner an anderer Stelle pointiert: „Alle Gesellschaftsmitglieder sind daher dazu angehalten, ihr eigenes Gewaltpotenzial, ihren Beitrag zu sexualisierter und sprachlicher Gewalt, zu reflektieren. […] Die meisten Menschen überschreiten zumindest gelegentlich, wissentlich oder unwissentlich, die Grenzen anderer.“ (S. 122 f.) Veränderte Sprechmodi, wie von Schwerdtner gefordert (u.a. S. 121), und einen Weg raus der Beschämung, hin zu einer aktiven Verantwortungsübernahme von Täter:innen und Mitwissenden, stellen hierfür äußerst sinnvolle Ausgangspunkte dar.
Fußnoten
- Einige der weitergehenden geschlechtertheoretischen Bezüge und Querverweise sind im Zuge der Buchpublikation vermutlich erläuternden Fußnoten gewichen, die das Leseverständnis erleichtern, was positiv hervorzuheben ist.
- Rita Laura Segato, Las estructuras elementales de la violencia. Ensayos sobre género entra la antropología, el psicoanálisis y los derechos humanos, Bernal 2003; diez., Wider die Grausamkeit. Für einen feministischen und dekolonialen Weg, übers. von Sandra Schmidt, Wien/Berlin 2021.
- Silvia Federici, Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria, Oaxaca 2013.
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Henriette Liebhart.
Kategorien: Feminismus Gender Gewalt Öffentlichkeit
Zur PDF-Datei dieses Artikels im Social Science Open Access Repository (SSOAR) der GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gelangen Sie hier.
Empfehlungen
Von der Schwierigkeit, Probleme zu benennen
Zwei Essaybände fragen nach den Voraussetzungen intersektioneller Kritik
Zukunft von Gender?
Feministische Kritik als Theoriediskurs und wissenschaftliche Reflexionsform
Kontingente Fundierungen
Über Feminismus, Gender und die Zukunft der Geschlechterforschung in neo-reaktionären Zeiten