Franziska Haug | Rezension | 02.06.2025
Wider die Kluft zwischen Materialismus und Queer Theory
Rezension zu „Queer Studies. Schlüsseltexte“ von Mike Laufenberg und Ben Trott (Hg.)
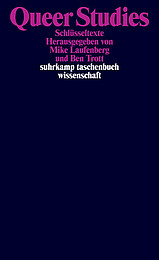
Einen fast 600 Seiten starken Sammelband zu lesen und in gebotener Kürze zu rezensieren, ist herausfordernd. Allein die Einleitung umfasst 100 Seiten und strotzt nur so vor theoretischen und historischen Verweisen, in denen die Leser:innen schnell der Überblick verlieren könnten – wäre die Form des Textes nicht schon ein Hinweis darauf, wie das System Queer Studies inhaltlich funktioniert. So tut man gut daran, sich von Umfang und Dichte des intellektuellen Verweissystems nicht abschrecken zu lassen. Denn der von Mike Laufenberg und Ben Trott herausgegebene Band Queer Studies. Schlüsseltexte löst nicht nur das ein, was er mit seinem Titel ankündigt: wichtige – und das heißt nicht unbedingt die bekanntesten – Schlüsseltexte der Queer Studies zusammenzustellen. Mehr noch setzt er entscheidende neue Akzente im Queer-Diskurs, der sich heute oftmals in einer hitzigen Gegenüberstellung zwischen Identitätspolitik/Kulturpolitik/Queerness auf der einen und Klassenpolitik/Materialismus/Feminismus auf der anderen Seite wiederfindet.
Die im vorliegenden Band versammelten Texte „demonstrieren den heterogenen und dynamischen Charakter“ (S. 8) dessen, was Queer heißt und was die Queer Studies mal waren, immer noch sind oder (wieder) sein könnten.
Sowohl die Auswahl der übersetzten Texte als auch die thematische Gewichtung der Einleitung erzählen die Genese der Queer Studies – entgegen dieser Lagerbildung – als immer schon verwoben mit sozialen, materiellen, leiblich-sexuellen, politischen und gesellschaftstheoretischen Fragen. Die Stoßrichtung von Laufenberg und Trott ist besonders wertvoll für eine queere linke Bewegung und Theorie: Statt die binären Linien zwischen beispielsweise Marxismus und Queer oder zwischen Arbeits- und Kulturkämpfen fortzuschreiben, „demonstrieren [die im vorliegenden Band versammelten Texte] den heterogenen und dynamischen Charakter“ (S. 8) dessen, was Queer heißt und was die Queer Studies mal waren, immer noch sind oder (wieder) sein könnten.
Zumindest in ihren Anfängen, so ließe sich mit diesem Band sagen, war Queer Theory nie „lediglich kulturell“ (S. 175). Darauf verweist bereits der Titel von Judith Butlers Text „Merely Cultural“ von 1996. Der Band folgt der darin von Butler beschriebenen Denkbewegung:
„Die Frage ist nicht, ob Sexualpolitik folglich dem Kulturellen oder dem Ökonomischen angehört, sondern wie die Praktiken des sexuellen Austauschs die Unterscheidung zwischen den zwei Sphären zunichtemachen.“ (S. 192)
Kevin Floyd – die Einleitung seiner für einen queeren Marxismus wegweisenden Monografie The Reification of Desire. Towards a Queer Marxism ist ebenso im Band vertreten – schließt sich Butler in der Vermittlung von Marxismus/Materialismus und Queer Studies an. Auf beide Texte gehe ich weiter unten noch einmal ausführlicher ein.
In ihrer Einleitung „Queer Studies: Genealogien, Normativitäten, Multidimensionalität“ führen Trott (Gastprofessor am Institut für Philosophie und Kunstwissenschaft der Leuphana-Universität Lüneburg) und Laufenberg (Professor für Soziologie mit dem Schwerpunkt Geschlecht und Sexualität an der Hochschule Fulda) nicht nur in die erstmalig auf Deutsch und größtenteils ungekürzt erscheinenden Texte ein, ihr Beitrag ist zugleich eine dichte, präzise und breite Übersicht zur Entwicklung und Neuakzentuierung der Queer Studies. Er ist damit prädestiniert für jedes Queer- und/oder Gender-Studies-Seminar. Nicht geeignet scheint mir der Einleitungstext allerdings für diejenigen zu sein, die außerhalb von akademischen Debatten Einführungen oder niedrigschwellige Einstiege in queeres Denken suchen.
Aufgeteilt ist die Einleitung in fünf Abschnitte mit wiederum kleinen Untergliederungen. Das erste Kapitel „I. Das queere Moment um 1990“ (S. 19–24) beschreibt die Anfänge der Queer Studies in ebenjener Zeit anhand von vier, für die Herausgeber wegweisenden Momenten wie beispielsweise der „Streit um den Status der Geschlechterdifferenz im (lesbischen) Feminismus“ (S. 11) oder die Kämpfe um schwule Sexualität, Promiskuität und während der HIV-/Aids-Krise. Bereits hier taucht ein sich durch die ganze Einleitung ziehendes Paradigma auf, das ich für das analytisch und politisch vielleicht wichtigste des Bandes halte: die Verbindung materialistischer und queerer Ansätze. So halten die Herausgeber mit der Materialistin Monique Wittig fest, dass „Kategorien des Geschlechts (und analog dazu der Klasse, der Sexualität, von race) nicht unabhängig von den Herrschaftsverhältnissen [existieren], die sie hervorbringen“ (S. 19). Für Wittig erzeuge die Unterdrückung das Geschlecht, nicht umgekehrt.
Der Abschnitt „II. Queere Genealogien“ (S. 24–51) zeichnet die Entwicklung des Begriffes Queer, des queeren Aktivismus und der Queer Studies historisch nach, widersteht dabei aber „traditionellen Ursprungsgeschichten“ (S. 39) und entwickelt stattdessen „eine Genealogie der Queer Studies aus einem ‚Gewirr […] ineinander verschachtelter Ereignisse‘“ (ebd.). Die „Bedeutung des Begriffes queer“ sei, so die Herausgeber in diesem Sinne, aus „vielfältigen und diffusen Verwendungen entstanden“ (S. 26). Neben den materialistischen Perspektiven ploppt ein weiterer Aspekt auf, der in der Queer-Debatte zwar absolut nicht neu ist, aber sowohl methodologisch wie auch analytisch in gegenwärtigen Auseinandersetzungen vernachlässigt wird: der Bezug auf (sexuelle, geschlechtliche, erotische) Nicht-Normativität und Nicht-Identität, auf das wirklich Queere, das Abweichende, das sich der Kategorisierung in Akronyme oder Begriffe entzieht.
„Queer Studies an den Universitäten“ (S. 29–32) und „What’s the Matter with Queer Studies?“ (S. 33–39) buchstabieren mit einer ungeheuren Materialfülle und unter Bezugnahme auf die im Band vertretenen Autor*innen den akademischen Rahmen der genannten Debatten aus. Herausstechend im Sinne des in diesem Band neu erarbeiteten Fokus der Queer Studies ist die Darstellung der geschlechterpolitischen Debatten der 1970er-Jahre im Abschnitt „Genealogien materialisieren: Queere Marxismen und die 1970er Jahre“ (S. 39–45). Darin machen Laufenberg und Trott auch die damaligen Verschränkungen der Queer Studies mit Aktivismus und praktisch-politischen Debatten im Kunst- und Kulturbereich sichtbar (S. 45–51). In diesem Debattenzeitraum werden Verbindungslinien zwischen Transgender/Transaktivismus und Marxismus/Kommunismus sichtbar;[1] beide Felder treten gegenwärtig in Theorie und Praxis oftmals als feindliche Lager auf.
Im Abschnitt „III. Hetero- und andere Normativitäten“ (S. 51–76) führen die Herausgeber in Anlehnung an Eve Kosofsky Sedgwicks wegweisende Arbeit Epistemology oft the Closet – die Einleitung ist unter der Überschrift „Axiomatisch“ im Band vertreten (siehe unten) – den Begriff der Heteronormativität als grundsätzliche Analysekategorie für ein Verständnis von Gesellschaft ein. Das vorletzte Unterkapitel „IV. Multidimensionalität: Intersektionalität und Queer-of-Color-Kritik“ (S. 76–84) behandelt neben den von mir genannten Neuakzentuierungen (Klasse, Materialismus, Sex) einen weiteren paradigmatischen Akzent des Bandes. Denn mit der Verzahnung von race und gender wird deutlich, dass intersektionale Debatten schon sehr früh die Queer Studies prägten. Oder anders gesagt: dass gerade die Analyse der mehrschichtigen und sich überschneidenden Unterdrückungsformen der Funktionsweise der Queere Theorie entspricht. Die Herausgeber stellen außerdem verschiedene identitätskritische Konzepte vor, was in Zeiten der bereits angesprochenen Kluft zwischen Identitätspolitik und sozialen wie ökonomischen Fragen eine hilfreiche Orientierung bietet.[2]
Im letzten Abschnitt der Einleitung „V. Zukünfte der Queer Studies: Aktuelle Problemfelder und kommende Genealogien“ (S. 85–99) werfen die Herausgeber ein Schlaglicht auf fünf Felder, die sie als „besonders produktiv und in diesem Sinne zukunftsträchtig“ (S. 86) für die Queer Studies erachten: (1) das Verhältnis von Queer Studies und Transgender Studies, (2) die Rolle und Relevanz von Sex und erotischen Praktiken, (3) das Verhältnis zur marxistischen und materialistischen Tradition, (4) die „Abkehr von Formen des ‚queeren Liberalismus‘ und der Homonormativität“ (S. 94) und (5) die Frage, ob oder wie sich Queer Studies als Area Studies verstehen lassen. Die Autoren schließen ihren Text mit dem Vorschlag, „eine globale Form der Queer Studies zu entwickeln, eine, die die Hybridisierung […] von Theorien und Analysen umfasst“ (S. 99).
Der Band versammelt insgesamt 12 Artikel, von denen ich drei etwas detaillierter vorstelle: Einer gewissen zeitlichen Chronologie entsprechend, ist „Axiomatisch“ von Eve Kosofsky Sedgwick der erste Schlüsseltext. Er ist eine gekürzte Version der Einleitung „Introduction: Axiomatic“ ihrer für die Queer Studies instruktiven, aber dennoch zu wenig beachteten Monografie Epistemology of the Closet (1990). Darin argumentiert Sedgwick,
„dass ein Verständnis von nahezu jedem Aspekt der modernen westlichen Kultur nicht bloß unvollständig, sondern auch in seiner wesentlichen Substanz in dem Maße beschädigt sein muss, wie es eine kritische Analyse der modernen Definition von homo-/heterosexuell nicht einbezieht“
und „dass der geeignete Ausgangspunkt für diese kritische Analyse die relativ dezentrierte Perspektive der modernen homosexuellen und antihomophoben Theorie ist“ (S. 100). Sexuelle Identität sei weder binär noch stabil, sie werde vielmehr durch soziale und materielle Diskurse sowie durch epistemologische Machtverhältnisse hervorgebracht. Außerdem kritisiert Sedgwick die reduktive Gleichsetzung von Homosexualität mit Pathologie oder politischer Devianz. Zentral ist ihr Begriff der „epistemologischen Nähe“, mit dem sie die affektiven und erkenntnistheoretischen Dimensionen sexueller Kategorien beleuchtet. Ihr Text ist insofern entscheidend für die Queer Studies, als er die heteronormativen Grundlagen von Wissen und Wissensproduktion selbst infrage stellt und damit die Möglichkeit eines subversiven, also queeren Denkens und politischen Handelns eröffnet.
Die Regulierung von Sexualität, so argumentiert Butler, erfülle eine zentrale Funktion im kapitalistischen Reproduktionszusammenhang, etwa durch die Normierung von Familie und vergeschlechtlichter Arbeit.
Judith Butlers Text „Lediglich kulturell“ basiert auf einem Vortrag auf der Rethinking-Marxism-Konferenz 1996 in den USA. Er spielt für die Neuakzentuierung, die der Band für die Queer Studies vornimmt, eine zentrale Rolle, weil er sich gegen eine bis heute bestehende Dichotomisierung in linken Theorien wendet: Kultur/Identität/Sexualität auf der einen und Materialismus/Klasse/Arbeit auf der anderen Seite. Butler kritisiert die Abwertung kultureller Kämpfe innerhalb der Linken als „bloß kulturell“ und widerspricht der Vorstellung, dass queere, feministische oder antirassistische Politiken sekundär gegenüber Klassenkämpfen seien. Mit Bezug auf Marx, Engels, den sozialistischen Feminismus, aber auch auf die Psychoanalyse zeigt sie, warum vermeintlich kulturelle Phänomene, wie beispielsweise Sexualität, nicht von materiellen Verhältnissen trennbar sind, im Gegenteil: Sie erweisen sich als konstitutiv für politische Ökonomien. Die Regulierung von Sexualität, so argumentiert Butler, erfülle eine zentrale Funktion im kapitalistischen Reproduktionszusammenhang, etwa durch die Normierung von Familie und vergeschlechtlichter Arbeit. „Das Ökonomische, das an das Reproduktive gebunden ist, ist notwendigerweise mit der Reproduktion der Heterosexualität verknüpft.“ (S. 189)
Der längste Text des ganzen Bandes ist Kevin Floyds „Die Verdinglichung des Begehrens. Über Kapital, Sexualität und die Situation des Wissens“, der die übersetzte Einleitung seines Buches The Reification of Desire. Towards a Queer Marxism (2009) ist. Darin greift er Butlers Kritik aus „Lediglich kulturell“ auf, formuliert aber die ökonomiekritischen Bezüge der Queer Studies anhand marxistischer Theorie noch einmal systematischer aus. So zeigt er zum Beispiel an Begriffen wie Verdinglichung und Totalität, wie kapitalistische Strukturen sexuelle Identitäten formen und gleichzeitig deren soziale Ursprünge verschleiern. Nach Floyd neigen kapitalistische Gesellschaften dazu, sexuelles Begehren zu „verdinglichen“, das heißt es als isolierte Identität zu behandeln, wodurch die komplexen sozialen und historischen Bedingungen, unter denen Begehren entsteht, verdeckt bleiben. In den Queer Studies eröffnet sein Ansatz eine kritische Perspektive auf die Verschränkung von Sexualität, Ökonomie und Wissen, die die materiellen Bedingungen queerer Existenz in den Blick nimmt. Damit trägt Floyd wesentlich zur Entwicklung eines ‚queeren Marxismus‘ bei, der die Trennung von Identitätspolitik und Kapitalismuskritik überwindet. Für ihn bedeutet „die Kluft zwischen Marxismus und Queer Theory“ (S. 424) nicht nur eine Schwächung linker, demokratischer Wissenschaft, sie stellt auch ein potenzielles Einfallstor für neokonservative bis rechte Theorien dar. Angesichts gegenwärtiger Gesellschaftsverhältnisse und einer stark in Lagern agierenden linken und queeren Szene ist diese Warnung aktueller denn je.
Roderick A. Fergusons Artikel trägt eine Queer-of-Color-Kritik in historisch-materialistische Diskurse ein; Ähnliches macht José Esteban Muñoz in „Desidentifizierungen performen“ stark, sein Ansatz ist antiessenzialistisch und materialistisch zugleich. Um das Verhältnis von Marxismus und Queerness geht es auch in „Queerer Marxismus in beiden Chinas. Marxismus, queerer Liberalismus und das Dilemma der beiden China“ von Petrus Liu. Hier wie auch in Gayatri Gopinaths Text „Unmögliche Begehren. Queere Diasporas und südasiatische öffentliche Kulturen“ sowie in Karma R. Chávez’ „Die differentiellen Visionen queerer Migrationsmanifeste“ kommt eine weitere Stärke des Bandes zum Tragen: einen queeren Internationalismus, Universalismus sowie queere Theorie und Bewegung auch außerhalb der USA und Europa sichtbar zu machen. Einen notwendigen, dezidiert lesbischen Akzent in queerer Bewegungsgeschichte setzt Ann Cvetkovich in „Das Erbe des Traumas, das Erbe des Aktivismus. Die Lesben bei ACT UP“. Robert McRuer betont mit seinem Text „Zwangsabilität und queere/behinderte Existenz“ einen im Kanon der Queer Studies bislang unterbelichteten Bereich. Lee Edelman plädiert in „No Future. Die Zukunft ist Kinderkram“ für das Festhalten an einer queeren Zukunftsperspektive trotz – oder vielleicht gerade wegen – politisch reaktionärer, konservativer und rechter Kräfte. Das politische Potenzial queerer Theorie befragt auch Cathy J. Cohen in „Punks, Bulldaggers und Welfare Queens. Das radikale Potential queerer Politik?“, sie legt einen kritischen Überblick zur Entwicklung Queerer Theorie und Bewegung vor.
Allein für die dichte, informierte, historisch genaue und gleichzeitig multidirektionale Einleitung ist das Buch zu empfehlen. Mit der erstmals deutschen Übersetzung starker Schlüsseltexte der Queer Studies leistet es darüber hinaus einen ungemein wichtigen Beitrag für eine fundiertere Diskussion darüber, was Queerness und Queere Theorie ist und in welche politischen Allianzen die Queer Studies angesichts der sich verschärfenden, reaktionären Verhältnisse weltweit eintreten müssten.
Fußnoten
- Um nur einige Titel zu nennen: Mario Mielis Towards a Gay Communism (ital. Orig.: 1977) oder Guy Hocquenghems Gay Liberation After May '68 (frz. Orig.: 1974) und Homosexuel Desire (frz. Orig. 1972).
- Eine Anmerkung zu Jasbir Puars queer-poststrukturalistischem Ansatz, den Laufenberg/Trott referieren, aber nicht kritisch kommentieren (S. 80–81): In Terrorist Assemblages. Homonationalism in Queer Times (2007) beschreibt Puar islamistische Selbstmordattentate als queere Körperpraxis („Queer Jihad“), plädiert für einen queeren Antizionismus und warnt vor Bündnissen zwischen queeren und säkularen Kämpfen. Im Sinne eines linken, antifaschistischen Queerfeminismus wäre an dieser Stelle ein kritischer Kommentar zu dieser Aufkündung universeller Solidarität mit allen Queers weltweit nötig.
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Henriette Liebhart.
Kategorien: Feminismus Gender Kultur Queer
Zur PDF-Datei dieses Artikels im Social Science Open Access Repository (SSOAR) der GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gelangen Sie hier.
Empfehlungen
Kontingente Fundierungen
Über Feminismus, Gender und die Zukunft der Geschlechterforschung in neo-reaktionären Zeiten
Von der Schwierigkeit, Probleme zu benennen
Zwei Essaybände fragen nach den Voraussetzungen intersektioneller Kritik
Michaela Müller, Ceren Türkmen
Feminisms Reloaded: Umkämpfte Terrains in Zeiten von Antifeminismus, Rassismus und Austerität
Jahrestagung der Sektion Frauen- und Geschlechterforschung in der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, Justus-Liebig-Universität Gießen, 3.–5. Dezember 2015
