Mechthild Bereswill | Rezension | 24.06.2025
Aufforderung zum kritischen Denken
Rezension zu „Diskreter Maskulinismus. Kritische Zeitdiagnosen“ von Eva Kreisky, herausgegeben von Marion Löffler
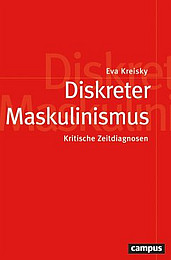
Die wissenschaftliche Analyse des vielschichtigen Verhältnisses zwischen Staat, Demokratie und Geschlechterverhältnissen ist bis heute nicht selbstverständlich. Auch wenn Politik mehrheitlich immer noch fraglos als vermeintlich neutrales Phänomen begriffen wird, haben sich gleichwohl Positionen etabliert, die diese androzentrische Verdeckung entlarven und grundsätzlich in Frage stellen. Das verdankt sich dem dynamischen, höchst reflexiven Wechselverhältnis zwischen feministischen Bewegungen und den geschlechtertheoretischen Differenzierungsleistungen von Wissenschaftler:innen. Für den deutschsprachigen Kontext wurde dieses produktive Bündnis maßgeblich durch die theoretischen Denkbewegungen und Forschungsaktivitäten der österreichischen Politikwissenschaftlerin Eva Kreisky reflektiert und vorangebracht.
Eva Kreisky starb am 14. August 2024, wenige Tage vor ihrem 80. Geburtstag. Das hier zu besprechende Buch Diskreter Maskulinismus. Kritische Zeitdiagnosen mit einer Auswahl ihrer Texte aus 25 Jahren Forschungsarbeit (1984 bis 2009) erschien am 18. September 2024. In ihrem Nachruf in den Feministischen Studien schreiben Birgit Sauer und Marion Löffler zur Veröffentlichung des Bandes:
„Es ist traurig, dass Eva Kreisky das nicht mehr erlebt hat. Weit trauriger ist aber für die feministische politikwissenschaftliche Community der Verlust eines kritischen und streitbaren Geistes und einer solidarischen Person.“[1]
Dieser kritische und streitbare Geist Eva Kreiskys wird in allen der hier zusammengetragenen Beiträge lebendig – in ihrer präzisen Begriffsarbeit ebenso wie durch ihre pointiert-ironische Sprache im Umgang mit den expliziten und impliziten Dimensionen von Politik und Geschlecht. Dabei verknüpft sie theoretische Genauigkeit im Hinblick auf Grundfragen der politischen Theorie mit ihrer wegweisenden Perspektive auf die autoritären Tiefendimensionen von Bürokratie und einer durch männerbündische Mechanismen stabilisierten, aus Kreiskys Sicht unvollständigen Demokratie.
Darauf deutet auch der Titel des Sammelbandes hin: „Diskreter Maskulinismus“. Mit diesem sprachlichen Bild, das auf subtile und zugleich geschickte Machtmechanismen von Zurückhaltung bis hin zur Geheimhaltung anspielt, bringt Eva Kreisky ihre geschlechtertheoretische Analyse bürokratischer und staatlicher Institutionen auf den Punkt. Deren männerbündische Organisationslogik basiert demnach auf Formen eines diskreten Maskulinismus, der Staat und Verwaltung durchwirkt und sich dabei zugleich den Anstrich des Neutralen gibt. So schreibt Eva Kreisky in einem der Aufsätze des Bandes, in dem sie ihr Konzept des diskreten Maskulinimus bereits 1997 zur Diskussion gestellt hat:
„Geschlecht soll unbedacht bleiben – nicht nur als weibliches, sondern viel mehr noch als männliches – denn mit seiner Visualisierung könnte eine prinzipielle Infragestellung zentraler Institutionen und Verfahrensweisen drohen, damit würde eine subkutane Erosion des harten autoritären Kerns politischer Institutionen eingeleitet.“ (S. 159, Hervorh. im Original)
In diesem Text bezeichnet die Autorin „politisch institutionalisierte Männlichkeit“ als genuinen „Gegenstandsbereich der Politikwissenschaft“ (S. 188). In welcher Weise und mit welcher thematischen Bandbreite Eva Kreisky ihre eigene Prämisse eingelöst hat, wird in den insgesamt 13 ausgewählten Beiträgen des Bandes nachvollziehbar.
In ihrem kurzen Vorwort hebt Birgit Sauer die große Bedeutung hervor, die Eva Kreiskys präzise politikwissenschaftliche Theoriebildung sowie ihr feministisches und wissenschaftspolitisches Engagement für die Entwicklung einer „geschlechterkritischen Politikwissenschaft“ (S. 8) haben. Sie betont, dass „sorgfältige Begriffsarbeit, ja Begriffsarchäologie“ (ebd.), geschlechtersensible Analysen und konkrete Politik für Eva Kreisky von Beginn an zusammengehörten. Dabei nennt Sauer ein konkretes Beispiel, an dem deutlich wird, dass Eva Kreisky bürokratische Institutionen zwar kritisch analysiert und hinterfragt, zugleich aber deren Wandel und Öffnung mit vorangetrieben hat: „Ihre geschlechtersensible Analyse der österreichischen Bürokratie war ausschlaggebend dafür, dass das österreichische Gleichbehandlungsgesetz 1979 in Kraft treten konnte.“ (S. 7)
Marion Löffler, die als Herausgeberin des Bandes fungiert, hebt in ihrer anschließenden, theoretisch sehr dichten Einleitung die Bedeutung der „Konzeption von Staat und Bürokratie als >Männerbund<“ (S. 9) hervor. Dieses von Eva Kreisky im Zuge ihrer langjährigen empirischen Forschung zur österreichischen Verwaltung entwickelte Konzept bildet den Bezugspunkt für die Auswahl der Beiträge des Bandes. Es sind Texte, die die „Produktivität ihrer Männerbund-Theorie als Forschungsprogramm aufzeigen und nachvollziehbar machen“ (S. 9). Löffler ordnet die Männerbund-Theorie als eine „kritische Zeitdiagnose“ (ebd.) ein, die wichtige Impulse für theoretisch fundierte Staats- und Politikanalysen setzt. „Eva Kreiskys Verfahren zielt auf das Freilegen und Benennen androzentrischer Verkürzungen und maskulinistischer Einschreibungen in Politik, die sich wie Sedimente in den politischen Institutionen festgesetzt haben.“ (S. 10)
Entsprechend verfolgt Kreiskys Theorie- und Forschungsprogramm in erster Linie das Ziel, die Verkrustungen demokratischer Institutionen zu entfernen und sie auf diese Weise für Demokratisierungsprozesse zugänglich zu machen. Demokratische Institutionen werden von ihr nicht grundsätzlich in Frage gestellt, sie sollen nicht abgeschafft werden. Im Fokus von Eva Kreiskys kritischer Institutionenarchäologie steht vielmehr die Frage nach der Demokratisierung auch von Bürokratie, verbunden mit der Überwindung männerbündischer Macht- und Herrschaftskonstellationen, deren diskrete Wirkung sich nicht nur darin zeigt, dass Frauen historisch aus der politischen Öffentlichkeit ausgeschlossen sind und sich den Zugang zum Feld der Politik hart erkämpfen mussten. Männerbündische Politikverhältnisse basieren vielmehr auch auf der vermeintlichen Neutralisierung von Geschlecht und einer damit einhergehenden mehr oder weniger subtilen Verallgemeinerung von Männlichkeit, verbunden mit autoritären Strukturen. So schreibt Marion Löffler: „Maskulinismus wirkt also diskret, aber deshalb nicht weniger schädlich für die Demokratie.“ (S. 10) Anschließend betont sie, die bereits länger zurückliegenden Zeitdiagnosen in den ausgewählten Texten würden für aktuelle „Tendenzen von Remaskulinisierung und demokratischem Rückbau“ (ebd.) sensibilisieren.
Eva Kreisky wird sowohl im Vorwort als auch in der Einleitung des Bandes als eine „Pionierin“ (S. 11) der Politikwissenschaft gewürdigt. Ihre wissenschaftliche Biografie führte von der Versicherungsmathematik über die Rechtswissenschaft schließlich zur Politikwissenschaft, zu deren Aufbau und weiteren Institutionalisierung in Österreich sie seit Beginn der 1970er-Jahre kontinuierlich mit hohem Engagement beigetragen hat. Eva Kreiskys Denken und ihr Engagement waren durch die politische Aufbruchstimmung der 1970er-Jahre geprägt. Sie sah in der sozialdemokratischen Regierung Österreichs ab 1970 eine Chance für Demokratisierung und Geschlechterpolitik. Doch gab sie sich keinen Illusionen hin, was die Grenzen der sozialdemokratischen Modernisierung betraf. Dabei stand sie dem Sozialdemokraten Bruno Kreisky (SPÖ), der von 1970 bis 1983 österreichischer Bundeskanzler war, auch persönlich nahe, war sie doch mit dessen Sohn Peter Kreisky verheiratet. Marion Löffler schreibt dazu, die SPÖ habe sich letztlich als „wenig offen für basisdemokratische Partizipation gezeigt“ und sei mit den Protestformen der Neuen Sozialen Bewegungen überfordert gewesen (S. 12). Sie schreibt: „Eva Kreiskys ambivalente Bilanz der Kreisky-Ära von 1998 ist Teil dieser Publikation“ (ebd.) und spielt damit auf einen Beitrag an, in dem Eva Kreisky das Verhältnis von Bruno Kreisky zu den Neuen Sozialen Bewegungen analysiert (S. 51–72).
Sowohl im Vorwort als auch in der Einleitung des Bandes wird hervorgehoben, dass theoretische Gründlichkeit, die kritische Arbeit mit und an Begriffen der politischen Theorie und die fortlaufende Auseinandersetzung mit konkreten politischen Entwicklungen das Werk von Eva Kreisky charakterisieren. Dies gilt nicht zuletzt im Hinblick auf die Analyse des neoliberalen Kapitalismus, der bestehende demokratische Verhältnisse aushöhlt sowie die Entwicklung von neuen Formen der Demokratie einhegt und gefährdet. Vor diesem Hintergrund zeigt sich in den vorliegenden Aufsätzen auch, welche Bedeutung eine kritische Solidarität mit sozialen Bewegungen für Eva Kreiskys Selbstverständnis als Wissenschaftlerin hat. Das skizzierte Wechselspiel zwischen präziser Theoriearbeit und konkreter Politik spiegelt sich facettenreich in den ausgewählten Beiträgen, wenn sich das theoretische Denken von Eva Kreisky im Zusammenhang von (heute bereits länger zurückliegenden) aktuellen politischen Konstellationen entfaltet.
Neben dem Vorwort von Birgit Sauer und der Einleitung Marion Löfflers umfasst der Band 13 Beiträge, die alle von Eva Kreisky als Alleinautorin verfasst wurden. Der älteste Text wurde 1984, der jüngste im Jahr 2009 publiziert. Die Entscheidung, nach 2010 erschienene Aufsätze nicht aufzunehmen, wird damit begründet, dass diese auch heute noch leicht zugänglich seien.
Die ausgewählten Beiträge sind vier thematischen Schwerpunkten zugeordnet: 1. Demokratisierung – Entdemokratisierung? 2. Männerbund und Bürokratie, 3. Maskulinismus und männliche Lebenswelten, 4. Ambivalenzen des Neoliberalismus. Ein Anhang enthält die Textnachweise und einen kurzen, von der Herausgeberin verfassten Abschnitt zur Biografie von Eva Kreisky. Der erste Schwerpunkt „Demokratisierung – Entdemokratisierung?“ (S. 27 ff.) umfasst drei Beiträge, von denen zwei grundsätzliche theoretische Einschätzungen und Reflexionen zu gesellschaftlichen Entwicklungen beleuchten, nämlich zum Verhältnis von „Neoliberalismus, Entdemokratisierung und Geschlecht“ (erstmals erschienen 2009, S. 27–49) und zu „Demokratie und Rechtstaat in Geschlechterperspektive“ (aus 2004, S. 73–90). Im letztgenannten Beitrag erläutert Eva Kreisky eine auch für die Gegenwart hochrelevante Differenzierung zwischen Demokratie und Rechtstaat, die aus ihrer Sicht insbesondere im deutschsprachigen Raum immer wieder „in eins gesetzt würden“ (S. 77). Sie betont, dass der Rechtsstaat konzeptuell auf die Sicherung von individueller Autonomie ziele, wohingegen Demokratie eine bestimmte Form von politischer Selbstorganisation anstreben würde (ebd.). „(Konstitutioneller) Rechtsstaat kann daher auch un- und überhaupt antidemokratisch sein. […] Limitierung von Staatsgewalt ist also nicht nur eine Frage des Rechts, sondern immer auch eine Frage des demokratischen Regimes.“ (ebd.) Im dritten Aufsatz aus dem Jahr 1998 reflektiert Eva Kreisky Demokratieentwicklung anhand eines konkreten Beispiels: Sie untersucht das Verhältnis des sozialdemokratischen Kanzlers Bruno Kreisky zu den neuen politischen Bewegungen (S. 51–72). Umgekehrt werden auch die Strategien der Neuen Sozialen Bewegungen im Umgang mit etablierten politischen Institutionen reflektiert, so dass dieser Text einen ausgezeichneten Einblick in eine von heute aus betrachtet widersprüchliche Phase des gesellschaftlichen Umbruchs und damit verbundene Dynamiken von Beharrung und Wandel gibt.
Dem zweiten Schwerpunkt „Männerbund und Demokratie“ (S. 93 ff.) sind vier Beiträge zugeordnet, die veranschaulichen, wie Eva Kreiskys Bürokratieforschung und ihre Männerbund-Theorie ineinandergreifen. Im Fokus steht dabei die Formulierung einer feministischen Staatstheorie. Damit werden grundlegende Impulse für die feministischen Politikwissenschaften und deren wissenschaftlichen Institutionalisierungsprozess gesetzt. Wieder veröffentlicht wird in diesem Abschnitt unter anderem ein sehr kurzer, thesenartig formulierter Text aus dem Jahr 1992 mit dem Titel Der Staat als >Männerbund< (S. 93–102). Die 13 Thesen basieren auf einem Vortrag, den Eva Kreisky 1991 im Rahmen einer ad hoc-Gruppe zu Politik und Geschlecht bei der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW) in Hannover hielt. Damit trug sie wesentlich zur Gründung der DVPW-Sektion Politik und Geschlecht bei (S. 18). Von heute aus gelesen verdichten sich in diesen Thesen Denkbewegungen zum Verhältnis von Männlichkeit und Staatlichkeit, deren Tiefenstrukturen Eva Kreisky in ihrem Werk fortlaufend analysiert. Wie grundlegend sie dabei staatliche Bürokratie als Element männerbündischer Politik in den Blick nimmt, verdeutlicht der zweite Beitrag in diesem Abschnitt aus 1984, in dem sie „den Bürokraten in uns und neben uns“ (S. 103–115) fokussiert. Dieser fast 40 Jahre alte Aufsatz regt gerade aufgrund seines deutlich erkennbaren Zeitkerns zum intensiven Nachdenken über die Rolle und die Organisationslogik von Verwaltungsbürokratien im 21. Jahrhundert an, auch unter Bedingungen der Digitalisierung, vor allem aber im Hinblick auf Beharrung und Wandel von Geschlechterverhältnissen und Geschlechterordnungen. Ein weiterer Text aus dem Jahr 1991 ist dem Thema „Bürokratisierung der Frauen: Feminisierung der Bürokratie“ gewidmet (S. 115–130). Im Mittelpunkt stehen hier Fragen zum möglichen Wandel bürokratischer Institutionen durch Frauenpolitik und durch den Einzug von Frauen in Verwaltungshierarchien. Der vierte Beitrag mit dem Titel Aspekte der Dialektik von Politik und Geschlecht (original: 1994, S. 133–154) zielt auf eine „Programmatik politikwissenschaftlicher Geschlechterforschung“. Eva Kreisky buchstabiert hier verschiedene Theorie- und Debattenstränge aus und reflektiert diese kritisch. So diskutiert sie die Grenzen von Androzentrismuskritik und hinterfragt Ansätze der politikwissenschaftlichen Frauenforschung, die Geschlecht funktionalistisch hinzu addieren statt „bestehende Logiken und Sichtweisen in Frage […] zu stellen“ (S. 138).
Die Prämisse, theoretische Konzepte ebenso zu hinterfragen wie gesellschaftliche Verhältnisse und undurchsichtige Zusammenhänge, wird in allen Beiträgen des Bandes nachvollziehbar. Die Überlegungen Eva Kreiskys bleiben dabei nicht programmatisch, sondern werden an konkreten Untersuchungsfeldern und Fragestellungen sowie mit Bezug zu den Folgen des neoliberalen Umbaus von Gesellschaften entfaltet. Dieser präzise und kritische Blick Eva Kreiskys zeigt sich entsprechend auch in allen Beiträgen des Bandes. Im Abschnitt mit der thematischen Klammer „Maskulinismus und männliche Lebenswelten“ reicht die Bandbreite der Aufsätze von dem oben bereits zitierten grundsätzlichen Text zum diskreten Maskulinismus über „Fußball als männliche Weltsicht“ (S. 215) bis hin zu einer Rekonstruktion der maskulinen Welt „des Joseph A. Schumpeter“ (S. 235).
In den Beiträgen des vierten und letzten Schwerpunkts (S. 265 ff.) werden die „Ambivalenzen des Neoliberalismus“ thematisiert. Versammelt sind drei Texte mit sehr unterschiedlichen Akzenten: Zunächst wird „Politik(er)beratung als neuer Beruf“ (S. 265 ff.) im Zusammenhang mit neoliberalen Entwicklungen diskutiert. Im zweiten Aufsatz untersucht Eva Kreisky das Verhältnis von Staat und Mafia am Beispiel „postsowjetischer Transformationen des Staatlichen“ (S. 305 ff.). Im letzten Beitrag (S. 349 ff.) wird der Zusammenhang von Neoliberalismus und Rechtspopulismus untersucht. Anlass hierfür ist die Konstellation in Österreich ab den 2000er-Jahren, in der die FPÖ mithilfe der christlich-konservativen ÖVP die Regierungsverantwortung übernehmen konnte. In diesem letzten Text wird die kritische Empörung einer Wissenschaftlerin spürbar, die einen bedeutenden Beitrag zu großen Fragen der politischen Theorie geleistet hat. Im Fokus ihres regen, im besten Sinne Unruhe stiftenden Denkens steht das Streben nach starken Formen von Demokratie, zu deren genuiner Aufgabe auch die Auseinandersetzung mit der sozialen Frage zählt, die angesichts der Entwicklungen, die Eva Kreisky im Jahr 2000 resümiert, „wieder zum zentralen Thema von Demokratie und neuer Handlungsformen gemacht werden muss“ (S. 394). Damit verbunden ist die sorgfältige Analyse der Mechanismen und Strategien des autoritären Populismus, um diesem entgegen treten zu können.
Alle dreizehn Aufsätze sind überaus lesenswert. Dabei ist es bei der Auswahl der Beiträge sehr gut gelungen, Wiederholungen weitgehend zu vermeiden. Gleichwohl ziehen sich bestimmte theoretische Denkfiguren und der kritische Fokus auf neoliberale Entwicklungen wie ein roter Faden durch die Aufsätze. Die Lektüre von Eva Kreiskys Texten ist voraussetzungsvoll. Sie erfordert Konzentration und die Bereitschaft, sich auf bereits zurückliegende politische Kontexte und komplexe theoretische Argumentationen einzulassen. Zugleich profitieren Leser:innen von den umfangreichen Erklärungen und Einordnungen jedes Beitrags, vom spürbaren Humor der Autorin und auch von der unverkennbaren Empörung über bestimmte politische Entwicklungen, die alles andere als demokratiefördernd sind. Es sind Texte, die in mehrfacher Hinsicht wider das soziale Vergessen wirken: Politische und wissenschaftliche Kämpfe werden in Erinnerung gerufen und reflektiert; autoritäre politische Entwicklungen, die bis in die Gegenwart wirken, werden geschlechtertheoretisch analysiert; Demokratie wird als ein gefährdetes und unvollendetes Projekt verteidigt. In diesem Sinn ist Birgit Sauer zuzustimmen, die in ihrem Vorwort schreibt: „Ihre Texte sind immer noch aktuell – auch kritisierbar; aber genau das war immer das Anliegen von Eva Kreiskys akademischer Arbeit: Keine Ruhe geben, immer kritisieren – nur so kann sich etwas verändern.“ (S. 8). Es empfiehlt sich, dieser Einladung zum kritischen Denken zu folgen. Die Beiträge des vorliegenden Bandes eignen sich darüber hinaus auch sehr gut für die Lehre und den Dialog mit Studierenden, weil es Eva Kreisky hervorragend gelingt, Grundfragen der politischen Theorie wie der feministischen Wissenschaft zueinander zu vermitteln.
Fußnoten
- Marion Löffler / Birgit Sauer, Nachruf auf Eva Kreisky, Feministische Studien (2024), 2, S. 324–327, hier S. 327.
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Stephanie Kappacher.
Kategorien: Demokratie Feminismus Gender Gesellschaft Politik
Zur PDF-Datei dieses Artikels im Social Science Open Access Repository (SSOAR) der GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gelangen Sie hier.
Empfehlungen
Gender Trouble und die Krise sozialer Reproduktion
Rezension zu "Antifeminismen. 'Krisen'-Diskurse mit gesellschaftsspaltendem Potential?" von Annette Henninger und Ursula Birsl (Hg.)
Michaela Müller, Ceren Türkmen
Feminisms Reloaded: Umkämpfte Terrains in Zeiten von Antifeminismus, Rassismus und Austerität
Jahrestagung der Sektion Frauen- und Geschlechterforschung in der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, Justus-Liebig-Universität Gießen, 3.–5. Dezember 2015
Kontingente Fundierungen
Über Feminismus, Gender und die Zukunft der Geschlechterforschung in neo-reaktionären Zeiten
