Hartmann Tyrell | Rezension | 15.02.2018
Das Narrativ von der Entzauberung der Welt
Hans Joas erzählt eine alternative Geschichte von der Entzauberung
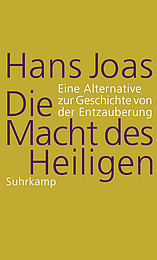
I.
Unter den deutschen Soziologen, die zugleich philosophischen Boden unter den Füßen haben, findet sich in den letzten Jahrzehnten kein zweiter, der sich ähnlich intensiv wie Hans Joas der Religion zugewendet hat und dies nicht als einer ihrer ‚Verächter’, sondern im Gegenteil: als Anwalt der „prinzipielle(n) Legitimität religiösen Glaubens“ unter den Gegebenheiten auch der ‚modernen Welt’ (S. 420). Auch innerreligiös-theologisch ist das, ist zumal Joas’ Theorem der ‚Selbsttranszendenz’ nicht ohne Resonanz geblieben. Andererseits finden sich unter den Religionssoziologen nur wenige, die ihre intellektuelle Sache ähnlich streitfreudig angehen, wie es Joas tut. Er ist ein Autor, der sich nicht scheut, vor der Terminologie seiner Kontrahenten Tafeln mit der „Warnung vor gefährlichen“ Begriffen aufzustellen (S. 336). Von den „gefährlichen Prozessbegriffen“ wird noch die Rede sein. Ohne Zweifel ist Hans Joas weit davon entfernt, ein irgendwie ‚parteiischer’ Autor zu sein, der seine intellektuelle Vor- und Mitwelt nach Freund und Feind scheidet. Gerade die wertvolle Literaturberichterstattung, die sein neues Buch an verschiedenen Stellen zu bieten hat, zeugt davon. Dennoch kann ich nicht ganz verhehlen, mich selbst als seinen Leser gelegentlich doch bei der Empfindung ertappt zu haben, er sei Ernst Troeltsch etwa durchweg gewogen, Max Weber hingegen zähle zu seinen Freunden nicht. Begleitempfindungen dieser Art habe ich natürlich im (negierenden) Sinne von Husserls Erfahrung und Urteil jeweils ‚durchgestrichen’.
„Dieses Buch stellt einen Versuch dar, einen der Schlüsselbegriffe des Selbstverständnisses der Moderne zu entzaubern: den der Entzauberung“ (S. 11). Der Satz steht programmatisch am Beginn des hier zu besprechenden Buches, und das Vorhaben, das Joas ankündigt, schließt an den energischen Widerspruch an, auf den in den letzten Jahren auch von seiner Seite die Säkularisierungsthese und der Säkularisierungsbegriff gestoßen sind. Unverkennbar hat diese Gegenrede die religionsbezogene Diskurslandschaft verändert, und die Arbeit an der Korrektur jener religionsabträglichen Selbstbeschreibung der Moderne findet ihre Fortsetzung nun in Joas’ kritischer Auseinandersetzung mit dem von Max Weber im Jahre 1913 auf den Weg gebrachten Narrativ von der „Entzauberung der Welt“. Dieses Narrativ tritt „nicht aggressiv religionskritisch“ auf (S. 280), aber es spricht der Moderne ihr religiöses Potential ab und ist eben darin ein Ärgernis. Und so geht es Joas nicht nur darum, die Selbstverständlichkeit zu erschüttern, mit der das Entzauberungsmotiv heute kommuniziert und fortgeschrieben wird, sondern zugleich darum, ihm „eine Alternative“ entgegenzusetzen, eine solche zumindest ‚zu skizzieren’ (S. 19). Es ist das siebte und Schlusskapitel des Buches, das diese Skizze liefert (S. 419 ff.). Eine anthropologisch fundierte „Theorie der Sakralisierung“ bietet den Ausgangspunkt dafür; erweitert wird sie ihrerseits um ein Theorienetzwerk, das Religion und Macht konzeptionell zusammenführt und aneinander bindet (S. 422 f.).
Das Buch, das an das reichhaltige Oeuvre seines Autors vielfältig anschließen kann, ist auf eine etwas ‚durchwachsene’ Art komponiert und strukturiert. Es setzt mit drei Kapiteln ein, die – verteilt auf drei unterschiedliche Disziplinen – eine Geschichte der Religionswissenschaft jenseits der Kritik der Religion entwerfen. Das führt teils weit ins Vorfeld von Ernst Troeltsch und Max Weber, teils an beide heran. Alle drei Kapitel rücken einen klassischen Autor in den Mittelpunkt, ziehen aber, was dessen Ideengut angeht, teils auf Vorarbeit, teils auf Weiterverarbeitung hin, auch andere Denker zu. Es beginnt mit David Hume, in dessen The Natural History of Religion von 1757 Joas den Anfang wissenschaftlicher, hier historischer Befassung mit Religion erkennt. Und es ist Johann Gottfried Herders historisch hermeneutische Weiterführung davon, die dann sehr einsichtig herausgestellt wird. Es folgt die Religionspsychologie, und ihr Held – auf dem Joas so sehr vertrauten Boden des amerikanischen Pragmatismus – ist William James. Ihm ist im Vorfeld Friedrich Schleiermacher und im Sinne der Weiterverarbeitung Josiah Royce beigegeben. Schließlich geht es, nun zeitgenössisch zu Troeltsch und Weber, um die Religionssoziologie, nämlich um die geschichtslos konzipierte Émile Durkheims. Dessen Elementare Formen des religiösen Lebens sind die maßgebliche Quelle von Joas’ Theorie des Sakralen und seiner „Anthropologie der Idealbildung“ und entsprechend kommen sie zur Sprache; mit in den Blick genommen sind hier Fustel de Coulanges, Durkheims Lehrer, und vor allem, das Rituelle betreffend, William Robertson Smith.
Auf die instruktiven und klug angelegten Eingangskapitel kann hier des Näheren nicht eingegangen werden, und die Kommentierung des Rezensenten muss sich so auf drei kurze kritische Anmerkungen beschränken. Zunächst: zum Kreis der Verfechter der These von der größeren Toleranz des Polytheismus im Verhältnis zum Monotheismus gehörte in seiner Natural History of Religion auch David Hume (S. 36). Jan Assmann hat darauf vor einigen Jahren Bezug genommen. Für Joas ist dies Anlass, das 18. Jahrhundert zu verlassen und im (noch) aktuellen Streit um Assmanns Die mosaische Unterscheidung Stellung zu beziehen (S. 41 ff.). Hier hätte er in der Wiedergabe von Assmanns Argument besser daran getan, nicht einfach zu sagen, für diesen sei, was den Monotheismus angeht, „die Wahrheitsorientierung […] ausschlaggebend“. Denn die Geltendmachung des Codes ‚wahr/falsch’ auf dem religiösen Gebiet und die Weiterungen davon im Verhältnis der Religionen zueinander waren hier die Pointe. Und es gewinnt einen eigentümlich apologetischen Akzent, wenn Joas sich anschließend über Seiten hin – jenseits der abrahamitischen Religionen und nachgerade ‚aufrechnend’ – über religiöse Gewalt und Intoleranz in Asien, in Indien, vor allem auf buddhistischem Boden auslässt. Der historiographische Kontakt zu Hume geht darüber verloren. Sodann: mit großem Interesse liest man im William James-Kapitel die rezeptionsbezogenen Darlegungen, die der Vorläuferrolle Schleiermachers nachgehen. Hier ist über „Schleiermacher als Quelle?“ zusammengetragen, was sich transatlantisch irgend finden ließ (S. 67 ff.). Ist man dann aber bei James selbst angelangt, so zählt (zulasten Schleiermachers) nur noch der „Unterschied“ zwischen beiden, und im Weiteren spielt Schleiermacher gar keine Rolle mehr, so dass man bezüglich der Rezeptionsangelegenheit am Ende zu sagen verführt ist: „viel Lärm um nichts“. Schließlich: dass Joas im Verhältnis zu Durkheim Fustel de Coulanges und dessen La cité antique von 1864 religionsgeschichtlich so nachdrücklich herausstellt, ist unbedingt verdienstvoll. Auch von Max Weber vermutet Joas, er habe Fustel gelesen, und stützt sich dabei auf bestimmte Passagen in der Religionssoziologie in Wirtschaft und Gesellschaft. Die dortige Nichtnennung von Fustel als Quelle verführt Joas dazu (S. 114, Anm. 67), sich den expliziten Plagiatvorwurf, den ein französischer Autor hier an die Weber’sche Adresse gerichtet hat, zueigen zu machen, obwohl ihm (Joas) doch vor Augen ist, dass in der Fragment gebliebenen ersten Niederschrift von Wirtschaft und Gesellschaft kaum irgendwo ordnungsgemäß zitiert oder Literatur aufgeführt wird. Im Literaturanhang von Webers Agrarverhältnisse im Altertum von 1909 findet sich der ordnungsgemäße Hinweis aber durchaus: „Für die soziale Seite der antiken Staatslehre Fustel de Coulanges’ geistvolle Arbeiten (speziell: ‚La cité antique: sehr – aber mit Vorsicht – lesenswert)“.[1]
Damit zum Fortgang des Joas’schen Buches, nämlich zum Kapitel 4 (S. 165 ff.), das im Zentrum des Ganzen steht und sich das Entzauberungsthema vornimmt. Unvermeidlich rückt es auch ins Zentrum dieser Rezension. Allerdings: das Kapitel ist zunächst mit Anderem befasst, denn Joas will Max Weber nicht das ganze Feld überlassen und stellt seiner eingehenden Darstellung und Kritik des Entzauberungsnarrativs einen umfangreichen Abschnitt voran, der sich Ernst Troeltschs großer historisch-soziologischer Darstellung des Christentums (in Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen, durchaus) widmet. Es geht Joas religionshistoriographisch für die Zeit um 1900 um zwei (ebenbürtige) „große Syntheseversuche“. Er stellt sie nebeneinander, führt den Leser aber nicht an das Gespräch heran, das die beiden Synthetiker zu Lebzeiten so lebhaft miteinander geführt haben. Für Troeltsch spricht mit Joas nicht zuletzt der Umstand, dass er in der ‚modernen Welt’ dem Christentum seine „Zukunftsmöglichkeiten“ durchaus zuerkannt habe (S. 279 f.).
Dem Kapitel 4 folgt, etwas überraschend, ein breit angelegter Forschungsbericht in Sachen ‚Achsenzeit’. Joas zieht ihn korrekterweise von Karl Jaspers her auf. Der Logik seiner Kapitelfolge aber hätte es vielleicht besser entsprochen, wenn er den Bericht vom Ausgangspunkt der Weber’schen Wirtschaftsethik der Weltreligionen und in Berührung mit der Entzauberungsthematik aufgenommen hätte, denn Webers mächtige Präsenz in der Achsenzeitdebatte, von Jaspers an, ist ja schwerlich bestreitbar. In Joas’ Buch bleibt sie indes im Hintergrund.[2] Umso nachdrücklicher sucht das Buch die Auseinandersetzung mit Weber im Kapitel 6 (S. 355 ff.), dem Kapitel, das den Kampf mit den „gefährlichen Prozessbegriffen“ aufnimmt. Hier sind es primär die Begriffe der ‚Rationalisierung’ und ‚Differenzierung’ und dies bezogen auf Webers vielleicht berühmtestes Textstück, die Zwischenbetrachtung. Joas liest den Text neu und ausdrücklich nicht im unter Soziologen gewohnten „Licht der Differenzierungstheorie“ (S. 376). Darauf wird unten näher einzugehen sein und ganz ebenso auf das siebte Kapitel (S. 419 ff.), das abschließend zurückfindet auf die Generallinie der Auseinandersetzung mit dem Entzauberungsnarrativ; hier hat es um die angekündigte „Alternative zur Geschichte von der Entzauberung“ zu gehen (S. 445). – Ich merke schon hier an, dass ich aus Platzgründen die drei abschließenden Kapitel nur kursorisch würdigen kann.
II.
Nachdem sich Joas von Hume, James und Durkheim her versichert hat, „dass eine empirisch kontrollierte und theoretisch konsistente, in diesem Sinne wissenschaftliche Erforschung der Religion in der Tat möglich ist“ (S. 165), wendet er sich den Anfängen der Religionssoziologie in Deutschland um 1900 zu: den „beiden großen Syntheseversuche(n)“ von Ernst Troeltsch und Max Weber. Wert legt er dabei weniger auf beider ‚Fachmenschenfreundschaft’ oder die ‚Schnittmengen’ von beider Werk, vielmehr auf „die tiefreichenden Unterschiede“, die sie trennt (S. 168). Sie liegen, wie es Joas sieht, nicht zuletzt in der Einschätzung der ‚religiösen Lage’ in der modernen Welt.
Auf Troeltschs Seite sind es, wie gesagt, speziell die Soziallehren[3], an die Joas sich bevorzugt hält. Dass gerade diese durch die Heidelberger Nachbarschaft in besonderer Weise beeinflusst sind,[4] muss Joas nicht irritieren, denn ihm ist es nicht darum zu tun, nur die großen Linien des Troeltsch’schen Buches nachzuzeichnen. Seine Intention ist es vielmehr, eine „implizite Methodologie“ (Hervorh. von mir; H. T.), wie sie Troeltsch „in seiner historischen Soziologie des Christentums“ praktiziert, sichtbar zu machen, sie „ans Licht zu heben“ (S. 171). Nun ist die Annahme oder Unterstellung einer solchen (sogar „recht verborgen“ genannten) Methodologie, der ein anderer Autor folgt, wenngleich er sie unexpliziert lässt, natürlich nicht unproblematisch, und das Geschäft, eine derartige Methodologie ex post zu explizieren, fordert eine eigene Methodik und hohe interpretatorische Sorgfalt. Ob Joas’ Tiefenexegese solchem Anspruch genüge tut, will ich dahingestellt sein lassen und lege es den Troeltsch-Fachleuten ans Herz, hier zu urteilen. Aber den sieben Schritten, mit denen Joas den Leser über das Troeltsch’sche Feld führt (S. 174 ff.), bin ich halbwegs willig gefolgt.
An zwei Stellen will ich allerdings doch Bedenken anmelden. Einerseits scheint es mir ziemlich dick aufgetragen, wenn Joas – ohne rechten Beleg dafür – Troeltsch mit einer eigenen, der Weber’schen gegenüber divergenten Handlungskonzeption ausstattet und diese, der Philosophensprache des frühen 21. Jahrhunderts folgend, mit dem Titel „‚expressivistisches’ Handlungsverständnis“ beehrt (S. 178 f.). Eröffnet wird das dem Leser mit einem bemerkenswerten „Ich behaupte“.[5] Immerhin: die Behauptung bringt Troeltsch zeitgenössisch in die größere Nähe zu Dilthey sowie zu dessen hermeneutischen Vorläufern um 1800. Es stellt sich dann überdies die erstaunliche Konsequenz ein, dass Troeltsch in Joas’ Augen ausgerechnet für ‚religiös-charismatische’ Angelegenheiten begrifflich weit besser gerüstet dasteht als Weber selbst (auch S. 195 ff., S. 202).[6] Anderseits: das Entzauberungsnarrativ, hat, wie es in Gebrauch ist, ähnlich der Säkularisierungsthese eine negative, religiös Verlust anzeigende Pointe, und nur zu gern wird die ‚Entzauberung’ als Generalformel für die religiös desillusionierte Befindlichkeit der Moderne aufgefasst. Darin liegt ihre Anstößigkeit für Joas. Troeltsch, den Theologen, dagegen sieht Joas frei von der Tendenz, die Moderne dem religiösen Glauben entgegenzusetzen. Im Gegenteil: dessen „historische Soziologie des Christentums“ nennt er im Vollzug des siebten Schritts „auch eine affirmative Genealogie eines modernen vitalen Christentums“ (S. 201).[7] Und der Rede ‚vom zeitgenössischen vitalen Christentum’, von der Troeltsch seinerzeit nichts ahnte, begegnet man von da an in Joas’ Buch des Öfteren. Sie ist doppelt zu beanstanden: Sie ist es zunächst wegen der ‚unbedachten’ Übernahme der Vitalitätsformel. Diese Formel, die dem Sprachgebrauch einer (heutigen) religionssoziologischen Forschungsrichtung entstammt, mit der Joas ansonsten nicht unbedingt sympathisiert, laboriert an der gänzlichen Unaufgeklärtheit dessen, was ‚religiöse Vitalität’ denn soziologisch eigentlich bedeuten soll. Vor allem aber: die optimistisch getönte Formel mag in Joas’ Sinne sein; der Sicht Ernst Troeltschs auf die ‚religiöse Lage’ seiner Zeit entsprach sie nicht. Ist Joas etwa Troeltschs Aufsatz Das Wesen des modernen Geistes von 1907 ganz unbekannt geblieben? Es heißt dort (und wird dort auch näher begründet): „Die moderne Welt ist eine schwere Religionskrisis, das kann nicht geleugnet werden“; sie ist in religiöser Hinsicht diese Krisis. Von dieser Gegenwart her stellt sich dann die Frage nach den „Zukunftsmöglichkeiten des Christentums“.
Damit auf Webers Seite, also auf die des begriffsschöpferischen Welterfolgs der ‚Entzauberung der Welt’ (S. 201 ff.)! Hier führt Joas den Leser zügig heran an Webers (durchaus uneinheitlichen) Gebrauch seiner Zauberformel; Joas schickt dem nur einige kürzere Anmerkungen voraus, die sich der Herkunft und dann auch der Rezeption des Weber’schen Entzauberungsbegriffs zuwenden (S. 208 ff.). Das ist hilfreich und fügt sich gut zusammen mit den entsprechenden Ausführungen, wie sie im Kontext der Max Weber-Gesamtausgabe Wolfgang Schluchter jüngst in seiner Einleitung zur Spätfassung der Protestantischen Ethik[8] zusammengestellt hat.[9] Joas tut dann zweierlei: Er begibt sich zunächst, vom Kategorienaufsatz von 1913 an, auf einen Weg, auf dem er dem Weber’schen Begriffsgebrauch von ‚Entzauberung’ detailliert nachspürt und jede einzelne Stelle sinnvergleichend unter die Lupe nimmt (S. 214 ff.). Dem lässt er den „Versuch einer Systematisierung“ folgen (S. 240 ff.). Man darf sagen: eine ähnlich gründliche und textnahe Auseinandersetzung mit Webers Entzauberungsbegrifflichkeit hat es bislang nicht gegeben. Allerdings ist diese Auseinandersetzung eine, die dem „einflussreichen, aber auch zutiefst problematischen Narrativ“ den wissenschaftlichen Kredit entziehen will (S. 206). Joas nennt die von ihm gewählte Strategie der Diskreditierung klar beim Namen. Er bestreitet dem Begriff seine Einheit: „Deckt man die begriffliche Uneindeutigkeit […] auf, zerfällt auch dieses Narrativ und verliert es seine Suggestivkraft“ (S. 207). Joas’ Kritik bezieht sich mithin vor allem auf den Weber’schen Wortgebrauch von ‚Entzauberung’; entwickelt wird sie dagegen nicht in der Auseinandersetzung mit dem, was Webers komplexe materiale Religionssoziologie – sei es typologisch-‚religionssystematisch’, sei es universalhistorisch-vergleichend – zur Sache zu sagen hat.[10]
Dass Max Webers Rede von ‚der Entzauberung der Welt’ nicht aus einem Guss ist und dass sie streckenweise ganz verschiedene historische Zeiten ins Auge fasst, zeigt sich schon, wenn man die religionssoziologischen Schriften gegen den berühmten Vortrag Wissenschaft als Beruf hält (S. 222 ff., S. 233 ff.). Solcher Vergleich führt in Übereinstimmung mit Wolfgang Schluchter zur Scheidung einer religionsgeschichtlichen ‚Entzauberung der Welt’ von einer durchaus anderen, die der Entwicklung der modernen Wissenschaft und Technik zugehört (S. 240 f.). Beides bleibt im Nebeneinander, wird bei Weber weder miteinander verknüpft, noch ins historische Verhältnis gesetzt oder sonst sachlich zusammengeführt. Die Entzauberungsformel bringt es zusammen, und man sieht schnell, dass hier nicht systematische Begriffsbildung am Werk war und kein systematischer Begriffsgebrauch vorliegt. Unbestritten aber war Weber die Formel wichtig und war es als kulturgeschichtliches Narrativ.
Joas hat aber nicht nur die Inkonsistenzen des Weber’schen Entzauberungsbegriffs im Sinn. Ohne dies dann systematisch zu entfalten, beansprucht er darüber hinaus, die ‚Entzauberung’ in drei verschiedenartige Prozesse zerlegen zu können, für die er die erklärtermaßen unschönen Namen „Entmagisierung, Entsakralisierung und Enttranszendentalisierung“[11] bereitstellt (S. 207, auch S. 255). Nimmt man diese Begrifflichkeit auf und geht man dem Vorschlag nach, so steht Entmagisierung der Sache nach bei Weber im Vordergrund: als ‚religionsgeschichtliche Entzauberung’. Bei dieser geht es nicht, wie vielfach missverstanden, um die Entzauberung ‚der Religion’, sondern um Entzauberung (d. h. Brechung der Magie) durch die Religion. Ich komme darauf noch zurück und wechsele zur Enttranszendentalisierung der Welt. Diese geht zusammen mit jener ‚Entzauberung der Welt’, die sich bei Weber mit der Genese der modernen Wissenschaft verbindet (S. 257 ff.).[12] Joas’ Rede vom Weber’schen „Pathos der Immanenz“ ist treffend (S. 259). Weniger treffend ist es, wenn er die Entzauberung mit dem zusammenführen will, was der Zeit um 1900 ihre Kultur- und Sinnkrise und ihr erklärtes Leiden an religiöser Desillusionierung war (S. 260 f.); Webers persönliche Sache war Letzteres nicht. Wo ‚Enttranszendentalisierung’ für die eigene Gegenwart in den ‚ernsten Blick’ genommen war, da lag ihm etwa die Rede von der ‚prophetenlosen’ eigenen Zeit deutlich näher. Bleibt die Entsakralisierung, die bei Joas entzauberungsbezogen blass bleibt und eigentlich ‚Profanierung’ heißen müsste.[13] Das hat seinen Grund auch darin, dass ‚das Heilige / das Sakrale’ bei ihm so sehr von Durkheim her bestimmt ist. Dieser kennt zwar das dem Sakralen entgegengesetzte Profane und die tiefgreifenden Ambivalenzen in der Relation beider. Profanierung (als solche) ist hier aber kaum im Blick. Alles soziologische Interesse gilt asymmetrisch der Seite des Sakralen. Dieses ist eben das jeder Gesellschaft jederzeit kollektiv Nötige. Die Kehrseite des Sakralen, dessen mögliches Verblassen oder gar sein Schwund sind für Durkheim, sieht man von seinem Blick auf die modernen Gesellschaft ab, eigentlich kein Thema. Das gibt Anlass, Joas den handlungsbezogenen Begriff ‚des Heiligen’ ans Herz zu legen, der bei Weber selbst, primär auf dem archaischen Feld von Religion und/oder Magie, zum Tragen kommt: das Heilige als „das spezifisch Unveränderliche“,[14], der Disponibilität und Abänderbarkeit im Handeln, weil ‚sakrosankt’, gänzlich entzogen. Weber spricht hier, im Sinne magisch-sakraler Gebundenheit, von Stereotypierung. Entzauberung/Entsakralisierung aber besagt dann die Brechung von Sakralscheu und Abweichungsangst, besagt Freigabe von Handlungsmöglichkeiten und Entbindung eben von den magisch-sakralen Fixierungen.
Es sei noch ein weiterer Entzauberungspassus zur Sprache gebracht, dem eine Sonderstellung zukommt und der bei Joas ausgiebig zur Sprache gebracht ist. Er gehört in den Weber’schen Kontext der Intellektuellenreligiosität und macht eine Bruchstelle zwischen Handlungs- bzw. Deutungssinn hier und metaphysischem ‚Sinn’ (zumeist in Anführungsstrichen:‚Sinn des Lebens’/’Sinn der Welt’ usw.) dort namhaft (S. 218 f.). In der Religionssoziologie in Wirtschaft und Gesellschaft[15] heißt es: „Je mehr der Intellektualismus den Glauben an die Magie zurückdrängt, und so die Vorgänge der Welt ‚entzaubert’ werden, ihren magischen Sinngehalt verlieren, nur noch ‚sind’ und ‚geschehen’, aber nichts mehr ‚bedeuten’, desto dringlicher erwächst die Forderung an die Welt und die ‚Lebensführung’ je als Ganzes, daß sie bedeutungshaft und ‚sinnvoll’ geordnet seien.“ Ich lasse die unterstellte je/desto-Mechanik beiseite und weise nur auf die eigentümliche Logik von umfassendem Sinnverlust hin, der dann jedoch – als Sache des religiösen Intellektualismus – eine metaphysische ‚Sinn’-Beschaffung aufs Ganze hin nach sich zieht. Gegen die Figur des totalen Sinnverlusts mobilisiert Joas zu Recht William James und sein Argument der immer schon sinngetragenen Welterfahrung des Menschen (S. 249 f.). Eine „wohlwollende Deutung Webers“ (S. 248) hätte sich aber von der Spannung zwischen Sinn (inklusive verstehbarem Handlungssinn) und (metaphysischem) ‚Sinn’ vielleicht doch zu Überlegungen anregen lassen, die diese Spannung in Kontakt bringen mit dem Gegenüber von ‚expressivistischem Handlungsverständnis’ hier und den Höhen der ‚Idealbildung’, wie sie Joas vor Augen sind, dort. Joas zieht es aber vor, Weber auf bloßem ‚Naturalismus’ (bzw. ‚Dualismus’, S. 231 ff.) sitzen zu lassen. Den macht sich Weber indes vor allem da und insoweit zueigen, als es ihm um die Beschreibung der ‚entzauberten’ Weltsicht spezifisch der modernen (Natur-)Wissenschaft zu tun ist (Stichwort „kausaler Mechanismus“).
Die Einheit, die Joas zum Zerfall bringen will, betrifft aber auch das Entzauberungsnarrativ in seiner durch die Jahrtausende hindurch wirkenden Geschichtsgestalt. Gegenstand der Kritik ist damit vor allem die religionsgeschichtliche Entmagisierung, genauer: die innere Einheit des von Weber beschriebenen Prozesses. Stein des Anstoßes ist damit unvermeidlich der viel zitierte, der Protestantischen Ethik eingefügte Passus, der den Entzauberungsprozess auf zwei Jahrtausende streckt und mit dem Satz beginnt: „Jener große religionsgeschichtliche Prozeß der Entzauberung der Welt, welcher mit der altjüdischen Prophetie einsetzte und, im Verein mit dem hellenischen wissenschaftlichen Denken, alle magischen Mittel der Heilssuche als Aberglaube und Frevel verwarf, fand hier (bei den Puritanern) seinen Abschluß“[16]. Joas hat hier allen Grund, die Stirn zu runzeln. Man sieht ja sofort: um einen irgendwie zusammenhängenden, gar linearen Prozess kann es sich nicht handeln. Die historischen Kontexte, die Weber zusammenführt, sind gegeneinander ausgesprochen heterogen, und die benannten ‚historischen Stätten’ (im alten Israel, in Hellas und im puritanischen England) sind es ebenso (S. 222 ff., S. 240 ff.). Über die ‚Lücken’ im Narrativ hinaus ist es nicht zuletzt die Weber’sche Bestimmung von Anfang und Ende, die Joas Probleme macht (S. 224).[17]
Muss man aber wirklich betonen, dass es dem komplexen historischen Denken Max Webers fern lag, sich Prozesse (oder Bestände) über die Jahrtausende hin linear fortlaufend vorzustellen? Schon die genannten (nur) drei historischen Stätten dementieren ja den Singular des einen großen Prozesses, und man möchte fast meinen, Weber sei an besagter Stelle selbst der Suggestion des Entzauberungsnarrativs (bzw. seiner an der besagten Stelle kursiv gesetzten Entzauberungsformel) erlegen. Aber natürlich waren ihm die besagten Prozesse weit komplexer vor Augen. Unvermeidlich waren sie ja, um nur das zu nennen, unter Einbeziehung des Weiterwirkens der hellenischen Antike im spätantiken Christentum zu konzipieren.[18] Und als ‚weichenstellend’ ist weiterhin an einen historischen Sachverhalt zu denken, über den sich geradezu eine Art Direktverbindung herstellt zwischen der altjüdischen Prophetie und den Puritanern mit ihrem „English Hebraism“[19]. Ich erinnere an den Beginn der Judentumsstudie, wo Weber über “die weltgeschichtliche Tragweite der jüdischen religiösen Entwicklung“ sagt: Diese sei „begründet durch die Schöpfung des ‚Alten Testaments’. Denn zu den wichtigsten geistigen Leistungen der paulinischen Mission gehörte es, daß sie dies heilige Buch der Juden als ein heiliges Buch des Christentums in diese Religion hinüberrettete“.[20] Hier ist es der Schrift- und Textbestand, der Jahrtausende überbrückt.
Der Leser sieht: der Rezensent neigt dazu, der Weber’schen Entzauberungssache weit mehr an Sachwert zuzugestehen, als Joas ihm einzuräumen bereit ist. Mein Eindruck aber ist, dass Joas sich von seinen sakral- und religionstheoretischen Prämissen her schwer tut, einen adäquaten Zugang zu Webers religionssoziologischer Denkungsart zu finden.[21] Hinzu kommt, dass gerade religionssoziologisch Wesentliches gar nicht in den Blick kommt, weil sich Joas eben vorzugsweise nur für den Weber’schen Wortgebrauch von ‚Entzauberung’ interessiert. Ich will das abschließend nur an einem Exempel, dem die Entzauberungsthematik innewohnt und das die Weberrezeption Bourdieus mit ins Spiel bringt, kurz illustrieren. Am Anfang von Webers Religionssoziologie in Wirtschaft und Gesellschaft steht, dem enormen Eingangskapitel folgend, die Trias von Zauberer, Priester und Prophet; ihnen gegenüber die Laien. Bourdieu hat die Trias – soziologisch realistisch und ganz im Sinne Webers – sofort als Konfliktfeld identifiziert, denn die drei Akteurtypen befinden sich nicht nur in der Konkurrenz um die Laien; sie sind vielmehr jeweils Repräsentanten eines Konzepts von Religion, das, wo es ‚selbstbewusst’ wird, dasjenige der zwei anderen jeweils direkt negiert. Joas ist, was Zauberer und Priester angeht, die (von Frazer übernommene) Entgegensetzung von ‚Gotteszwang’ und ‚Gottesdienst’ bei Weber zwar aufgefallen (S. 246 f.); er schadet seiner Sache aber, indem er sich sogleich auf einen beiläufigen Gegensatz zu Durkheim einlässt und nicht ‚am Ball bleibt’. Mit der Entgegensetzung von magischem Gottes- oder Geisterzwang und priesterlichem Gottesdienst verbindet sich ein religionsgeschichtlich grundsätzlicher Zurechnungswechsel: Im ersteren Fall wirkt der Zauberer und hat dank seiner magischen ‚Technik’ Macht über die Geister, die er adressiert; im zweiten, im priesterlichen Fall, sind die Götter stark, der Mensch dagegen ist ‚ohnmächtig’ und deshalb (in Opfer und Gebet) bittend konzipiert. Die Konfliktdisposition ist ersichtlich, und im Falle der Zurückdrängung von Magie durch den priesterlichen Kult hat man es mit relativer Entzauberung zu tun. Nicht anders steht es um den Propheten; ihn sieht Weber gleichermaßen ‚im lebhaften Widerspruch’ zur Priesterschaft wie zu magischer Praxis. Die ‚altjüdische Prophetie’ ist ihm darin der Modellfall, und ihr rechnet er die Ingangsetzung des vielschichtigen okzidentalen Entzauberungsprozesses zu. Und es ist für Weber weiterhin eine vierte, nicht scharf konturierte Größe, die, wie bereits gehört, in die Zurückdrängung der Magie verwickelt ist: ‚der religiöse Intellektualismus’. In Joas’ Darstellung kommt von diesen Konfliktkonstellationen kaum etwas zum Vorschein. Es dürfte, so gründlich das auch von Joas durchgeführt ist, eben doch unzureichend sein, den Zugang zum Weber’schen Entzauberungsnarrativ vorzugsweise über das Aufsuchen der Textstellen zu suchen, die das Entzauberungswort ‚in den Mund nehmen’.
III.
Den Weg in die ‚Achsenzeit’ wählt Joas von einem Schlüsselproblem der Religionsgeschichte her: von dem (gerade auch von Troeltsch) hochgehaltenen Begriff der ‚Erlösungsreligion’ her und der damit sich verbindenden Annahme eines „fundamentalen Einschnitts in der Religionsgeschichte der Menschheit“ (S. 286 ff., 288). Was religionswissenschaftlich unter dem erlösungsreligiösen Titel, wie er meint, nur unzulänglich verhandelt worden ist, sieht Joas in der Diskussion um die Achsenzeit weit besser aufgehoben (S. 290 f.), und dieser Diskussion widmet er im Kapitel 5 einen höchst lehrreichen Literatur- und Forschungsbericht, der von Jaspers seinen Ausgang nimmt (S. 296 ff.). Joas kommt dann aber auch auf das achsenzeitaffine Ideengut im Vorfeld von Jaspers zu sprechen. Beeindruckend ist dabei der Exkurs über die christliche Universalgeschichtsschreibung von Ernst von Lasaulx (S. 316 ff.). Dieser Münchener Professor für Philosophie und Ästhetik war es, der 1856, in Frontstellung gegen den welthistorischen Zufall, jener achsenzeitlich-multikulturellen Einheit in der Gleichzeitigkeit den wohl suggestivsten und treffendsten Ausdruck gegeben hat.[22] Joas nennt es „die vielleicht klarste Formulierung der Achsenzeitthese vor Jaspers“ (S. 319).
Seinen Bericht zieht Joas im Übrigen nicht eng religionsgeschichtlich auf; von Magie und Entzauberung und auch der Erlösungsreligion ist nicht mehr die Rede, umso mehr gewinnt achsenzeitbezogen der Transzendenzbegriff an Gewicht, aber auch der Gesichtspunkt eines „Zeitalter(s) der Kritik“ (S. 311). Es muss an dieser Stelle genügen festzuhalten, dass die Lasaulx’sche ‚Einheit’ der Achsenzeit in der historischen Forschung der letzten Jahrzehnte unvermeidlich aufgeweicht worden ist. Stark mit einbezogen in die Debatte ist der „archaische Staat“ (S. 321 ff.),[23] und die Zusammenführung von Religions- und Staatsgeschichte ist bei Joas dann weichenstellend auch fürs Weitere. Die Schlussüberlegungen nehmen die vielschichtige Kritik an der Achsenzeitthese auf (S. 341 ff.); sie sind dem Autor recht defensiv geraten, halten an der These aber entschieden fest, dies auch im Sinne eines welthistorisch epochalen Bruchs bzw. ‚Durchbruchs’, der die Rede von ‚vorachsenzeitlichen’ und ‚nachachsenzeitlichen’ Erscheinungen rechtfertigt.[24] Gegen die Frage nach dem „Wesen der Achsenzeit“ verhält sich Joas gleichwohl höchst vorsichtig (S. 349 ff.); er offeriert als knappe Leitformel die von „Transzendenz als reflexiver Sakralität“.
Dem Achsenzeitbericht folgt mit dem Kapitel 6 eine ganz andere Textsorte, nämlich eine streng nachfassende, das Detail nicht scheuende Auseinandersetzung mit einem einzigen Text: mit Max Webers Zwischenbetrachtung. Die „neue Deutung“, die Joas hier verspricht (S. 355 ff.), die sich auf eine „mikroskopische Lektüre“ stützt (S. 412 ff.) und einen Zug von Verbissenheit und Besserwisserei hat, steht dem Weber’schen Text selbst an Umfang kaum nach. Umgangssprachlich gesagt: „der Autor will es hier wissen“. Die Zwischenbetrachtung ist ein berühmter Text, für Robert N. Bellah etwa der Schlüsseltext zum Weber’schen Werk. Aber nicht an dieser Stelle liegt für Joas der Grund, gerade hier die Auseinandersetzung zu suchen. Vielmehr ist es der Umstand, dass die Zwischenbetrachtung in der deutschsprachigen Soziologie seit Längerem als klassisches Dokument der Differenzierungstheorie gilt und für ‚funktionale Differenzierung’ prominent in Anspruch genommen wird (S. 373 ff.), auch wenn bei Weber bekanntlich vorzugsweise von ‚Rationalisierung’ die Rede ist. Beide Begriffe (mit Modernisierungsakzent) führen ins Zentrum von Joas’ Kampf gegen die „gefährlichen Prozessbegriffe“ (S. 355 ff.). Hier gilt es nun allerdings, weil es bei Joas nicht erkennbar wird, anzumerken: Die Gesellschaftstheorie, die auf ‚funktionale Differenzierung’ setzt, macht von dem Begriff doppelten Gebrauch. Sie benutzt ihn als Prozessbegriff, aber ebenso auch als Strukturbegriff zur Beschreibung gesellschaftlicher Arbeitsteiligkeit (im Sinne der Interdependenz unterschiedlich spezialisierter Teilsysteme). Wie dem auch sei: es sind die prozessual aufgefassten Differenzierungsvorzeichen, die Joas an die Zwischenbetrachtung verweisen.
Ich möchte an dieser Stelle die Auseinandersetzung mit Joas’ ‚neuer Deutung’ von Webers Schlüsseltext vermeiden. Dies einerseits, weil diese Deutung m. E. wenig überzeugend ausgefallen ist, die Auseinandersetzung damit aber unvermeidlich auch eine ‚mikroskopische’ zu sein hätte, was an dieser Stelle schwerlich machbar wäre. Der andere Grund ist: ich habe mich noch vor kurzem selbst zur Zwischenbetrachtung ausgiebig geäußert, dabei insbesondere bemüht, dem Religionsverständnis des Textes auf die Spur zu kommen. Auch habe ich in einer früheren Arbeit die (unter Vorbehalt) Weber’sche ‚Gesellschaftstheorie’ detailliert zum Thema gemacht.[25] Die dortigen Argumente brauchen hier nicht wiederholt bzw. gegen Joas gewendet zu werden. Stattdessen möchte ich – in aller Kürze – den von Joas so geschätzten Ernst Troeltsch als Differenzierungsdenker vorstellen; er war dies in größter Nähe zu Weber, in Affinität aber ebenso zu Dilthey und Georg Simmel. Vielleicht lässt sich auf diesem Wege etwas für ein freundlicheres Verhältnis von Joas zur Differenzierungsbegrifflichkeit tun.
Die Zwischenbetrachtung ist, soweit es dort um die „Richtungen der Weltablehnung“ geht, so angelegt, dass sie das Religiöse – als Brüderlichkeitsethik und tendenziell auf Wertkollisionen hin – zu den verschiedenen ‚Lebensordnungen’ ins Verhältnis setzt; es geht dabei bekanntlich um die „ökonomische, politische, ästhetische, erotische, intellektuelle Sphäre“[26]. Nicht so sehr die Wertkollisionen waren nun Troeltschs Sache, sehr wohl aber – wiederholt und deutlich vor Webers Zwischenbetrachtung – das In-Beziehung-Setzen des Religiösen zu den verschiedenen Lebensordnungen, etwa unter Fragestellung der ‚Bedeutung des Protestantismus für die moderne Welt’. Wenn Troeltsch von der ‚modernen Welt’ spricht, dann typischerweise so, dass er sie desaggregiert und im Nacheinander von „Familie und Recht, dann Staat, Wirtschaft und Gesellschaft, schließlich Wissenschaft und Kunst“[27] behandelt. Was der ‚modernen Kultur’ aber spezifisch ist, das ist der je eigene Autonomieanspruch dieser Lebensgebiete. Diese Autonomie oder Eigengesetzlichkeit aber ist in Troeltschs Augen vielfach eine, die gegen die ältere Autorität der vor allem ‚kirchlichen Kultur’ sich hat durchsetzen müssen,[28] und das erlaubt es, hier – fallweise und historisch-prozessual – von Autonomisierung und in diesem Sinne dann auch von Ausdifferenzierung zu sprechen. Dass es sich dabei nicht um selbstläufig-lineare Prozesse, sondern um komplexe, umkämpfte und (schon aus Perspektive der vergangenen Gegenwart des Mittelalters) höchst unwahrscheinliche historische Entwicklungen handelt, verstand sich für Troeltsch wie für Weber von selbst. Wäre also auch vor solcher Prozessbeschreibung zu warnen?
Das abschließende Kapitel 7 („Das Heilige und die Macht“, S. 419 ff.) tritt an gegen den „irreführenden und insofern gefährlichen Prozeßbegriff […] der Entzauberung“ (S. 422) und will ihm ein Alternativkonzept entgegensetzen. Um Joas’ Sache recht zu verstehen, muss man zunächst auf zwei konzeptionelle Vorentscheidungen aufmerksam machen. Von der einen, nämlich der Engführung auf Religion und Politik, war zuvor andeutungsweise schon die Rede; man würde sie aus der Sicht von Troeltsch und Weber oder auch unter Differenzierungsvorzeichen unterkomplex nennen. Es ist „die Geschichte der Religion wie der der Macht“ bzw. die der Macht im politisch/staatlichen und im religiösen Gewande (S. 422 f.), auf die Joas den Fokus richtet. Hinsichtlich der theoretischen Rahmung geht es ihm darum, „das Wissen über die Dynamik von Sakralisierungsprozessen“ zu verbinden „mit einer Theorie der Macht“ (S. 441). Was dann aber als eine solche Theorie der Macht angeboten wird, bleibt über den Handlungsbezug von Macht und die Nennung einiger Namen (Michael Mann, Heinrich Popitz u. a.) hinaus eher dürftig; immerhin fällt dabei eine freundliche Bemerkung über die Herrschaftsfragen integrierende Weber’sche Religionssoziologie (S. 445). Die Programmformel aber, die dem Alternativkonzept, das das Entzauberungsnarrativ ablösen soll, vorangestellt wird, bleibt so unbestimmt allgemein, dass man sich nach der gehaltvollen Nahrung zurücksehnt, die Weber zu bieten hatte. Es ist „das Wechselspiel von vielfältigen Prozessen der Sakralisierung mit vielfältigen Prozessen der Machtbildung“, auf das Joas als „Leitfaden“ setzt (S. 445 f.). Hinzu kommt: das Wechselspiel ist, was seine zeitliche Bestimmtheit angeht, konträr zur Prozesslogik der ‚Entzauberung’ konstruiert. Es ist verstanden als ein menschheitsgeschichtlich immerwährendes, als in immer anderen Varianten sich wiederholendes Spiel, als eine kontingente Prozessvielfalt ohne eigene Prozessualität und Richtung. Solche Zeitlichkeit ist dann allerdings definitiv nicht die, welche die „historische Skizze“ bestimmt, die Joas diesen Gedanken unmittelbar folgen lässt (S. 446 ff.).
Die zweite Vorentscheidung ist zunächst begrifflicher Art. Sie betrifft die „Unterscheidungen heilig/profan, transzendent/immanent (oder mundan) und religiös/säkular“ (S. 253 f.). Joas zieht die Begriffe des Heiligen, des Transzendenten und des Religiösen dabei durch unterschiedliche Sachakzente auseinander, vor allem aber dadurch, dass er ihnen andere Zeiten in der Menschheitsgeschichte zuweist: das Sakrale, basierend auf Erfahrungen der Selbsttranszendenz, ist ein Anthropologicum, universell und menschheitsgeschichtlich immerwährend; das Transzendente ist Produkt erst der Achsenzeit und das Religiöse, die „säkulare Option“ voraussetzend, erst eines der Aufklärung. Keine „anthropologische Universalität der Religion“ also, auch keine der Transzendenz (S. 439)! Solche Dreiteilung der (unter Vorbehalt) menschheitlichen ‚Religionsgeschichte(n)’ sähe man nun gern zumindest ein wenig näher erläutert. Joas lässt den Wunsch unerfüllt. Welche Geschichte aber erzählt er nun alternativ zu der der Entzauberung? Er hält sich ans immerwährend Sakrale und erzählt eine sakrale Menschheitsgeschichte. Vorab aber bekräftigt er den anthropologischen Status des Sakralen, präsentiert er in verknappter Form (und fünf Schritten) noch einmal seine „Theorie der Sakralisierung“ (S. 423 ff.) und führt diese dann, wie angekündigt, an die Machtthematik heran.
Der „historischen Skizze“ (S. 446 ff.), die dann folgt, ist, wie gesagt, die Rolle des alternativen Narrativs zugedacht. Ob zu der Geschichte, die hier zusammengefügt ist und deren Träger die Menschheit ist, der schlichte Titel des ‚Historischen’ passt, sei dahingestellt. Immerhin ist es ein Narrativ von verschiedenen einander folgenden Sakralisierungen, ein Narrativ aber auch, in dem dann vieles nicht mehr vorkommen kann, was im Buch in religiös-geschichtlicher Hinsicht zuvor von thematischem Belang war.[29] Joas erzählt seine Geschichte der verschiedenen Sakralisierungen in vier Etappen. Die erste Etappe, mit Durkheims Buch und der ‚Ursprünglichkeit’ der australischen Ureinwohner vor Augen, ist die des machtträchtigen Rituals und der partikularistisch bestimmten „Selbstsakralisierung des Kollektivs“. Die zweite Etappe ist die des sakralen Königtums, das in seiner Sakralausstattung die vorstaatlich-‚egalitären’ ethnischen Kollektive beerbt (S. 461 f.). Joas führt diese Erzählung aus bis hinein in die dualistische Machtgeschichte des lateinischen Christentums, wobei dann der päpstlich-kaiserliche Investiturstreit breiter zur Sprache kommt (S. 470 ff.). Die Geschichte beginnt dann (dritte Etappe) im 17. Jahrhundert neu, und Joas hat nun die hier einsetzende antimonarchisch sich artikulierende, zugleich partikularistische Sakralisierung des Volkes (mit der französischen Revolution dann die der Nation) im Blick. Entscheidend ist ihm die vierte Etappe und die in dieser sich durchsetzende Sakralisierung der Person (S. 481). Auf der Kehrseite davon aber finden zusammen: die „Entsakralisierung politischer Macht“ und die universalistische Überwindung der „immerwährende(n) Tendenz zur kollektiven Selbstsakralisierung“ (S. 423).
Ob diese Menschheitsgeschichte, die schon von der zweiten Etappe an und bis Mündungsgebiet hinein auf okzidentalem Boden spielt, das Zeug zum großen religionsfreundlichen Narrativ hat, sei dahingestellt. Desgleichen die Frage, ob sie angesichts ihres universalistisch-religionskompatiblen ‚guten Endes’, wie sie es modernitätsbezogen um ihrer Alternativfunktion willen vorweisen muss, nicht doch einen Zug ins Teleologische hat. Für die Einheit der Geschichte(n) aber hängt sachlich alles an der Frage, ob das Sakralisierungskonzept – diesseits von Transzendenz und Religion – hinreichend Eigensubstanz hat und ob es stimmig durchträgt von der Durkheim’schen Ursprungsreligion bis hin zum Geltungsanspruch der Menschenrechte heute. Ein Urteil wird man erst wagen können, wenn der Autor, von seiner ‚Skizze’ ausgehend, den Schritt hin zu einer großformatigen Darstellung der Machtgeschichte des Sakralen getan haben wird. Mit dem Entzauberungsnarrativ wird er dann wohl immer noch zu kämpfen haben.
Fußnoten
- Max Weber, Gesammelte Aufsätze zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Tübingen 1924, S. 279.
- Auf das, was bei Weber gelegentlich das „prophetische Zeitalter“ heißt und mit der Achsenzeit gern in Verbindung gebracht wird, ist Joas andernorts eingegangen; vgl. S. 255, Anm. 203.
- Ernst Troeltsch, Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen, Tübingen 1912.
- Max Weber kommt dort in den Fußnoten wiederholt direkt mitredend, ja aktuell ‚belehrend’ (Ernst Troeltsch, Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen, Tübingen 1912, S. 20, Anm. 12) zu Wort. Publiziert worden sind die Soziallehren zunächst bekanntlich im Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, und die Auseinandersetzung mit dem Historischen Materialismus, die dort geführt wird, gehört in die nächste Nähe von Webers Programm ‚sozialökonomischer’ Forschung. Dazu gehört auch: die ‚sozialen’ Problembezüge, auf die hin Troeltsch das Christentum beschreibt, betreffen dessen sich wandelndes Verhältnis zum Staat, zum Wirtschaftsleben und zur Familie (Ebd., S. 45 ff., Anm. 109). Was die letztere angeht, so nimmt Troeltsch ausdrücklichen Bezug auf Marianne Webers Ehefrau und Mutter in der Rechtsentwicklung (1907).
- „Ich behaupte, daß Troeltsch in dieser Hinsicht in der Tat in dieselbe Richtung zielt wie Weber, dass aber sein Verständnis vom menschlichen Handeln genauer betrachtet sich deutlich von dem Webers unterscheidet (…)“ (S. 178). Solche Behauptung, die die ‚genauere Betrachtung’ schuldig bleibt, hört sich nicht gerade nach sorgfältiger Explikation von ‚impliziter Methodologie’ an.
- Andererseits fällt auf, dass Joas, der der Anlehnung an klassische Autoren ja nicht abgeneigt ist, den Kontakt zum Weber’schen (zumal prophetischen) Charisma eher nicht sucht. Seiner Begrifflichkeit von ‚Wert’ und ‚Idealbildung’ ist dieses ja durchaus wahlverwandt.
- Joas formuliert zunächst allerdings auffällig zurückhaltend: „Man könnte“ diese historische Soziologie so „nennen“. Gleich auf der nächsten Seite ist dann „die Frage nach den Bedingungen eines zeitgenössischen vitalen Christentums“ sogar „Troeltschs zentraler religiöser Impuls“ (S. 202; vgl. auch S. 279 ff.)
- Max Weber, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus / Die protestantischen Sekten und der Geist des Kapitalismus, Schriften 1904–1920, hrsg. v. Wolfgang Schluchter in Zusammenarbeit mit Ursula Bube, Max Weber Gesamtausgabe I/18, Tübingen 2014, S. 16 ff., S. 41 f.
- Man darf dabei auch auf Schluchters Beobachtung hinweisen, dass Weber der späten Protestantischen Ethik den Entzauberungsbegriff gleich an vier Stellen, prozessbetont im Sinne der Entmagisierung, eingefügt hat. Joas hat sich diesbezüglich schon vor Erscheinen Max Weber-Gesamtausgabe kundig gemacht (S. 214, Anm. 109).
- Ein von Joas registrierter Versuch in dieser Richtung bei Hartmann Tyrell, Potenz und Depotenzierung der Religion – Religion und Rationalisierung bei Max Weber, in: Saeculum 44, 1993, S. 300–347, dort S. 303 ff.; auch in: ders., „Religion“ in der Soziologie Max Webers, Wiesbaden 2014, S. 133–175.
- Der letzte der drei Prozessbegriffe ist aber nicht nur sprachlich unschön, sondern obendrein schief, ist er doch bei Joas als gegenläufig zur ‚Transszendenz’ angesetzt, nicht jedoch zum ‚Transzendentalen’.
- Man braucht dafür nur auf den begriffsgeschichtlichen Befund hinzuweisen, dass das zuvor nahezu zwingende Mitmeinen Gottes (des Herrn und Schöpfers) am Weltgriff um 1800 verblasst und etwa an der Vielzahl der neu in Umlauf kommenden, aufs Globale gemünzten Weltkomposita geradezu gelöscht erscheint. Wo Weber mit ausdrücklichem Gegenwartsbezug von der ‚Entzauberung der Welt’ sprach, da war dann nur noch von Wissenschaft, Technik und Machbarkeit die Rede.
- Vgl. begrifflich zu ‚sakral/profan’ und ‚Profanisierung’ Joas, S. 253 f.
- Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft. Die Wirtschaft und die gesellschaftlichen Ordnungen und Mächte. Nachlaß, Teilband 2: Religiöse Gemeinschaften, hrsg. v. Hans G. Kippenberg in Zusammenarbeit mit Petra Schilm, Max Weber Gesamtausgabe I/22-1, Tübingen 2001, S. 131.
- Ebd., S. 273.
- Max Weber, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus / Die protestantischen Sekten und der Geist des Kapitalismus, Schriften 1904–1920, hrsg. v. Wolfgang Schluchter in Zusammenarbeit mit Ursula Bube, Max Weber Gesamtausgabe I/18, Tübingen 2014, S. 280.
- Bei ‚wohlwollender Auslegung’ wäre Weber zugute zu halten, dass die Studien zur Wirtschaftsethik der Weltreligionen, auf die Weber an besagter Stelle ausdrücklich hinweist (Max Weber, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus / Die protestantischen Sekten und der Geist des Kapitalismus, Schriften 1904–1920, hrsg. v. Wolfgang Schluchter in Zusammenarbeit mit Ursula Bube, Max Weber Gesamtausgabe I/18, Tübingen 2014, S. 280, Anm. 105), über das ‚Antike Judentum’ (Max Weber, Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen. Das antike Judentum. Schriften und Reden 1911–1920, hrsg. v. Eckart Otto unter Mitwirkung von Julia Offermann, Max Weber Gesamtausgabe I/21, Tübingen 2005) hinaus Torso geblieben sind; das ist mein ceterum censeo. Auch Joas sieht die Unabgeschlossenheit von Webers Werks (S. 208). Die geplante Fortsetzung der Studien hätte das in der Protestantischen Ethik Angedeutete (über das alte Israel hinaus) mit großer Wahrscheinlichkeit auch für den hellenischen Zwischenschritt – und bei diesem nicht nur für die christliche Spätantike (S. 225 f.) – sachlich weiter ausgeführt.
- Vgl. zum Zusammenhang der „hellenischen Bildung“ mit der Ausbildung von Theologie und Dogmatik „nur bei den Christen“ (Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft. Die Wirtschaft und die gesellschaftlichen Ordnungen und Mächte, Nachlaß, Teilband 2: Religiöse Gemeinschaften, hrsg. v. Hans G. Kippenberg in Zusammenarbeit mit Petra Schilm, Max Weber Gesamtausgabe I/22-1, Tübingen 2001, S. 211 f.)
- Max Weber, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus / Die protestantischen Sekten und der Geist des Kapitalismus, Schriften 1904–1920, hrsg. v. Wolfgang Schluchter in Zusammenarbeit mit Ursula Bube, Max Weber Gesamtausgabe I/18, Tübingen 2014, S. 444.
- Max Weber, Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen. Das antike Judentum. Schriften und Reden 1911-1920, hrsg. v. Eckart Otto unter Mitwirkung von Julia Offermann, Max Weber Gesamtausgabe I/21, Tübingen 2005, S. 242.
- Hier sei nur auf die irrige Auffassung eingegangen, für Weber stelle Magie „die Grundschicht der Religion“ dar (S. 245; S. 214 ff., S. 240 ff.). Das ist für Joas schon deshalb nicht akzeptabel, weil der religiöse Ursprung (mit Durkheim) der in kollektiver Ekstase ist. Nun hat Weber aber nicht nur die Differenzfrage von Magie (Gotteszwang) und Religion (Gottesdienst) begrifflich unentschieden gelassen (Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft. Die Wirtschaft und die gesellschaftlichen Ordnungen und Mächte, Nachlaß, Teilband 2: Religiöse Gemeinschaften, hrsg. v. Hans G. Kippenberg in Zusammenarbeit mit Petra Schilm, Max Weber Gesamtausgabe I/22-1, Tübingen 2001, S. 157) und sich stattdessen an „die soziologische Seite jener Scheidung“ gehalten: an die Scheidung von Zauberer und Priester als religiösen Spezialisten. Woran ihm zunächst liegt, ist, dass alle anfängliche, wie immer geartete religiös/magische Praxis ins diesseitig Lebensdienliche, in den ‚ökonomischen Alltag’ und seine Zwecke eingebunden war; er kann das sogar einen „ursprünglich praktischen rechnenden Rationalismus“ nennen (ebd., S. 156). Die ‚Herrschaft der Magie’ ist dagegen als etwas deutlich Späteres veranschlagt (ebd., S. 128): jene „Flutwelle symbolischen Handelns“, die „den urwüchsigen Naturalismus unter sich“ begräbt, ist selbst sozialstrukturell voraussetzungsvoll; sie setzt die (erst zu erarbeitende) „Machtstellung“ des Magiers voraus. - Es geht in dieser gänzlich spekulativen Angelegenheit nicht um die Rechtfertigung Webers, sondern um seine korrekte Darstellung.
- Ich kann hier nicht umhin, Lasaulx (nach Joas, S. 220) zu zitieren. Er sagt: „Denn es kann unmöglich ein Zufall sein, daß ungefähr gleichzeitig , sechshundert Jahre vor Christus, in Persien Zarathustra, in Indien Gautama-Buddha, in China Konfutse, unter den Juden die Propheten, in Rom der König Numa und in Hellas die ersten Philosophen, Jonier, Dorier, Eleaten als die Reformatoren der Volksreligion auftraten; es kann dieses merkwürdige Zusammentreffen nur in der inneren substantiellen Einheit des menschheitlichen Lebens und des Völkerlebens, nur in einer gemeinsamen, alle Völker bewegenden Schwingung des menschheitlichen Gesamtlebens seinen Grund haben, nicht in der besonderen Efferveszenz eines Volksgeistes.“ Ich habe das Original nicht vor Augen gehabt und muss deshalb fragen: Steht dort (prädurkheimisch) wirklich „Efferveszenz“? Oder wohl doch „Eigenart“?
- Verwunderlich ist allerdings, denkt man nur von Indien her, wie wenig hier von Schichtung/Stratifikation die Rede ist.
- Auf das moralische Problem, das sich hier verbirgt, kommt Joas ganz am Ende zu sprechen (486f.). Es betrifft die Unterscheidung von vor- und nachachsenzeitlich, die sich leicht mit der Rede von ‚niederer’ (z. B. magischer) und ‚höherer’ Religion zusammenfindet.
- Vgl. Hartmann Tyrell, Die Religion der Zwischenbetrachtung. Max Webers „spezifisch religiöse Liebesgesinnung“, in: Heidemarie Winkel / Kornelia Sammet (Hg.), Religion soziologisch denken. Reflexionen auf aktuelle Entwicklungen in Theorie und Empirie, Wiesbaden 2017, S. 347–384; ders., Max Webers Soziologie – eine Soziologie ohne „Gesellschaft“, in: Gerhard Wagner / Heinz Zipprian (Hg.), Max Webers Wissenschaftslehre. Interpretation und Kritik, Frankfurt am Main 1994, S. 390–414.
- Max Weber, Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie I, Tübingen 1920. S. 536.
- Dies ist dem bekannten Vortrag Die Bedeutung des Protestantismus für die Entstehung der modernen Welt (1906/1911) entnommen. Dort ist rückblickend gesagt (Ernst Troeltsch, Schriften zur Bedeutung des Protestantismus für die moderne Welt (1906–1913), hrsg. v. Trutz Rendtorff in Zusammenarbeit mit Stefan Pautler, Ernst Troeltsch Kritische Gesamtausgabe, Band 8, Berlin / New York 2001, S. 297): die genannten Lebensordnungen „waren die Gebiete, auf denen wir bisher die Wirkungen des Protestantismus verfolgt haben. Überall ergab sich unserer Untersuchung das Doppelergebnis, daß er die Entstehung der modernen Welt oft großartig und entscheidend gefördert hat, daß er aber auf keinem dieser Gebiete einfach ihr Schöpfer ist.“
- Ebd., S. 211 ff.
- Nichts etwa von Monotheismus und Polytheismus, nichts von den Erlösungsreligionen, wenig von Transzendenz und Achsenzeit und schon gar nichts von der vitalen Zukunft des Christentums.
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Martin Bauer.
Kategorien: Religion
Zur PDF-Datei dieses Artikels im Social Science Open Access Repository (SSOAR) der GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gelangen Sie hier.
Empfehlungen
Religion und Moderne
Rezension zu „Politologische und soziologische Religionskritik. Von Hobbes und Schmitt über Max Weber bis zu Adorno und Horkheimer“ von Horst Junginger und Richard Faber (Hg.)
Standardwerk mit Schwächen
Literaturessay zu "Schlüsselwerke der Religionssoziologie" von Christel Gärtner und Gert Pickel (Hg.)