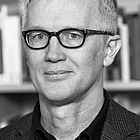Peter Niesen | Rezension | 16.06.2021
... denn sie wissen, was sie tun
Rezension zu „Die demokratische Regression. Die politischen Ursachen des autoritären Populismus" von Armin Schäfer und Michael Zürn

Nachdem die Orientierung an demokratischem Fortschritt ihre fraglose Selbstverständlichkeit verloren hat,[1] erfreut sich seit einiger Zeit der Begriff der „Regression“ gesteigerter Aufmerksamkeit. Die Aussichten für die demokratischen Regierungssysteme, so scheint es, haben sich eingetrübt, die utopischen Energien sind erschöpft. Unter diesen negativen Vorzeichen wäre schon viel gewonnen, wenn es gelänge, zumindest die Ergebnisse vergangenen Fortschritts gegen ihre zeitgenössischen populistischen und technokratischen Gefährdungen zu verteidigen. Dazu wäre es jedoch erforderlich, das schillernde Phänomen „demokratischer Regression“ genauer zu identifizieren und in seinen Ursachen zu bestimmen.
Armin Schäfer und Michael Zürn signalisieren bereits im Titel ihres Buches, dass sie den Brückenschlag zur Zeitdiagnose der „großen Regression“ suchen,[2] hätten ihnen doch auch andere Analysebegriffe zur Verfügung gestanden, angefangen von „demokratischer Erosion“ über „democratic backsliding“ und „backlash politics“ bis hin zur Rede vom „Niedergang“ oder „Zerfall“ der Demokratie.[3] Von „Regression“ zu reden, so Zürn in einem früheren Aufsatz, verweise unvermeidlich auf eine Rückkehr zu einem „weniger entwickelten Zustand“ und erfordere daher eine „normative Theorie oder eine teleologische Theorie sozialer Entwicklung“.[4] Diese Theorie wird im vorliegenden Band nicht entwickelt und auch die normative Dimension des Begriffs wird in reformistischer Einstellung eher beiläufig mitgeführt. Gleichwohl ist die Frage nach der gegenwartserschließenden Kraft des Begriffs der „demokratischen Regression“ von grundlegendem Interesse für die Politische Theorie. Schäfer und Zürn setzen wiederholt an, um das Phänomen zu bestimmen, dennoch fällt es ihnen nicht leicht, es dingfest zu machen.
Die beiden ordnen ihre Analyse zunächst in die bestehende Literatur zum Populismus und zur Gefährdung der Demokratie ein. Sie konstruieren dabei kein übergreifendes, linke wie rechte Bewegungen umfassendes Verständnis des Populismus, sondern identifizieren mit dem „autoritären Populismus“ einen übergreifenden Trend, der sich im globalen Norden wie im Süden durch das Merkmal eines aggressiven Nationalismus auszeichne. Damit unterscheidet sich ihr Zugriff wohltuend von Ansätzen, die auch südeuropäische Linksbewegungen, die sich, sobald sie Regierungsverantwortung übernehmen, zu Sozialdemokraten mausern,[5] als Ausdruck eines einheitlichen populistischen Syndroms klassifizieren. Ebenso wenig gehen sie der These vom Populismus als vorgeblich ‚dünner‘ Ideologie auf den Leim, sondern stellen die chauvinistischen Wurzeln des autoritären Populismus klar heraus (S. 69). Wie andere Vertreterinnen des Genres erörtern sie die Bedeutung zunehmender wirtschaftlicher Ungleichheit ebenso wie die Relevanz kultureller Konflikte in den westlichen Demokratien. Auch die Kontextbedingungen in Wirtschafts-, Migrations- und Pandemiekrisen werden von ihnen berücksichtigt, doch schreiben sie all diesen Faktoren keine entscheidende ursächliche Bedeutung für die Ausbreitung des autoritären Populismus zu. Von bisherigen Erklärungen für den Zulauf populistischer Bewegungen unterscheidet sich diejenige von Schäfer und Zürn vor allem durch die Kombination zweier Faktoren, nämlich die Diagnose einer sozialstrukturellen „Repräsentationslücke“ und die Problematisierung nationaler und internationaler Entscheidungsmechanismen, die sich politischer Kontrolle entziehen.
Als „demokratische Regression“ bezeichnen die Autoren das Zusammentreffen von zwei Phänomenen. Einerseits entfernten sich die Demokratien von ihrem ursprünglichen Ideal der Selbstbestimmung, weil immer häufiger „Entscheidungen in nicht durch Wahlen legitimierte und kaum durch die Bürgerinnen kontrollierte Gremien verlagert werden“ (S. 11). Die politischen Entscheidungs- und Gestaltungsspielräume der Einzelstaaten würden zunehmend nach innen wie nach außen durch nichtelektorale Institutionen wie Gerichte und Zentralbanken begrenzt. Andererseits wende sich ein wachsender Anteil der Bürgerinnen und Bürger von der Demokratie und ihren Einrichtungen ab, „weil sie sich nicht länger repräsentiert fühlen“ (ebd.), was auf die in sozialer Hinsicht immer exklusivere Zusammensetzung der politischen Klasse und deren selektive Aufnahme und Bearbeitung politischer Themen zurückzuführen sei. Im Unterschied zu anderen Autoren machen Schäfer und Zürn also weder die zunehmende ökonomische Ungleichheit noch den diffusen Zorn auf vermeintliche liberal-metropolitane Eliten für den Erfolg des autoritären Populismus verantwortlich. In ihren Augen sind es vielmehr die mangelnde Responsivität demokratischer Parteien und Parlamente für die Anliegen der Unterprivilegierten und die fehlenden Einflusschancen des vermeintlichen Souveräns auf die Entscheidungen nicht gewählter Gremien, die zu jener „doppelten Entfremdung“ (ebd.) von den Idealen und Institutionen der Demokratie geführt hat, die unseren Gesellschaften heute zu schaffen macht. Im Zentrum demokratischer Regression stehe die schichtenspezifisch unterschiedlich stark ausgeprägte Wahrnehmung der politischen Ohnmacht und Bedeutungslosigkeit vieler Bürgerinnen und Bürger: Je weniger sie noch daran glaubten, mit ihrer politischen Stimmabgabe etwas ausrichten zu können, desto eher seien sie geneigt, populistische Parteien zu unterstützen (S. 126).
Diese komplexe Vorstellung demokratischer Regression setzt sich aus heterogenen Elementen zusammen. Sie verknüpft objektive Faktoren wie die institutionelle Umgestaltung demokratischer Prozesse und Verfahren mit subjektiven Faktoren wie veränderten Einstellungen der Bürgerinnen und Bürger gegenüber dem politischen System – unabhängig von der Frage, ob Teile „der Bevölkerung von den Entwicklungen tatsächlich oder auch nur gefühlt negativ betroffen“ sind (S. 61). Das Subjekt demokratischer Regression ist ebenfalls ein doppeltes: Einerseits ist es das Gemeinwesen selbst, das regrediert, andererseits die Bevölkerung oder zumindest deren bereits entfremdete Teile. Darüber hinaus beschreiben die Autoren mithilfe des Ausdrucks nicht nur die Prozesse der Abwendung und des Verfalls, sondern subsumieren darunter auch deren im Verlauf der Beweisführung identifizierte Ursachen.
Allerdings führen die Autoren bereits im zweiten Kapitel eine zweite, schlankere Bedeutung „demokratischer Regression“ ein. Schäfer und Zürn untersuchen dort die Triftigkeit der These vom demokratischen Niedergang. Stimmt der Eindruck? Und wenn ja, wie lässt er sich belegen? Die Autoren sehen darin vorrangig eine institutionelle Frage, die sie unter Rekurs auf ein Verfahren der Demokratiemessung, den feingliedrigen Varieties of Democracy (VDem)-Index, zu beantworten suchen. Die Daten, die sie präsentieren, sind ebenso eindrucksvoll wie bedrückend. Sie belegen, dass sich insbesondere seit den 2010er-Jahren eine wachsende Zahl an Demokratien in ‚elektorale Autokratien‘ verwandelt hat, und dass die Demokratiequalität in vielen Staaten – teils inkrementell, teils massiv – sinkt. Im Lichte der Zahlen lässt sich die Gegenwart in globalhistorischer Perspektive als dritte und bisher massivste Epoche demokratischen Rückschritts verstehen.
Zwar basiert ihre dramatische Diagnose auch auf dem Umstand, dass die Welt seit dem Ende der 1990er-Jahre – ebenso wie zuvor schon während der Zwischenkriegszeit und im Zeitalter der Dekolonisierung – einen beträchtlichen Zuwachs an Demokratien erfuhr, die überhaupt als Kandidaten für demokratische Regression infrage kommen können. Allerdings ist vor dem Hintergrund der katastrophalen Auswirkungen früherer Erosionswellen und des weltweiten demokratischen Aufbruchs nach 1990 doch erklärungsbedürftig, warum die Demokratie-Indizes sowohl für konsolidierte als auch für jüngere, für große wie für kleine Demokratien in den 2010er-Jahren gleichermaßen abstürzten, während hybride Regime und Autokratien sich seither stabilisierten und mittlerweile immer repressiver werden.
Damit hängt die weitergehende Frage zusammen, was genau man eigentlich misst, wenn man Veränderungen in der Demokratiequalität konstatiert und deren globale Verschlechterung feststellt? Den Autoren zufolge handelt es sich hierbei ebenfalls um „demokratische Regression“ (S. 36, 49–52). Als Ergebnis einer Messung der Demokratiequalität bezieht sich der Ausdruck jedoch offensichtlich ebenso wenig auf das Phänomen der doppelten Entfremdung wie auf die Verlagerung von Entscheidungen in nichtelektorale Institutionen, vor allem nicht solche jenseits des Staates, die der VDem-Index gar nicht erhebt.[6] Der Begriff bezeichnet vielmehr den institutionellen Rückbau demokratischer Institutionen, den elementaren Verlust an politischer Chancengleichheit sowie die Beschränkung oder Abschaffung demokratischer Partizipationsrechte. „Demokratische Regression“ verweist hier also auf strukturelle Beschädigungen, die den Mechanismen demokratischer Willens- und Entscheidungsbildung sowie rechtsstaatlichen Verfahren und Wahlen durch Populisten an der Regierung zugefügt wurden. In der Regressionsmessung wird der Regressionsdefinition damit ein konkurrierendes Verständnis an die Seite gestellt, das sich auf die objektive Verschlechterung oder Beseitigung demokratischer Institutionen im innerstaatlichen Bereich richtet.
Um „demokratische Regression“ in diesem schlankeren Sinn handelt es sich, wenn Regierungen Gerichte entmachten oder deren Personal austauschen, Fernsehsender gleichschalten oder Wahlen manipulieren (S. 199). „Demokratische Regression“ im eingangs definierten dichteren Sinn schließt diese Bedeutung zwar ebenfalls ein (S. 61), bezieht sich aber auf die sich einstellende Entfremdungserfahrung mangelnder Vertretung und den steigenden Einfluss nicht gewählter Gremien. Verbunden werden die unterschiedlichen Dimensionen des Konzepts durch die Agitation des autoritären Populismus, der propagandistisch die zunehmende Entfernung vom Ideal kollektiver Selbstbestimmung und die wachsende Entfremdung der Bürgerinnen und Bürger skandalisiert, und damit unter anderem die Agenda verfolgt, nichtelektorale Institutionen und Mechanismen abzuwickeln. Die Unterminierung unabhängiger Instanzen und die Schwächung multilateraler Organisationen prägen sein globales Profil. Dieser Aspekt wird von den Autoren prominent herausgestellt, etwa wenn sie den Zusammenhang zwischen einem stabilen Multilateralismus und dem Gedeihen einzelstaatlicher Demokratien hervorheben und den „Antiinternationalismus autoritärer Populisten als die Hauptbedrohung für die liberalen Demokratien“ identifizieren (S. 184).
Wie verhalten sich nun die beiden verwendeten Bedeutungen „demokratischer Regression“, die komplexe Vorstellung einer „doppelten Entfremdung“ und das dünnere, auf die Beschädigung demokratischer Einrichtungen und Verfahren gerichtete Verständnis, zueinander?[7] Da nicht anzunehmen ist, dass die Autoren zwei rivalisierende Konzeptionen einführen wollten, braucht es eine andere Erklärung. Eine Möglichkeit bestünde darin, die beiden Bedeutungen mittels der Unterscheidung von Konzeption (conception) und Begriff (concept) im Sinne von John Rawls und H. L. A. Hart zu verstehen.[8] Das schlankere Regressionsverständnis identifizierte dann den Begriff „demokratischer Regression“ als schwach normative Kennzeichnung empirisch feststellbarer institutioneller Eingriffe in bestimmten Sektoren: Die Einschränkung von Rechten und die Verschärfung politischer Repressionen, die Beschneidung richterlicher Unabhängigkeit und die Abschaffung pluralistisch ausgerichteter Medien. Alle diese Maßnahmen lassen sich nicht nur feststellen und messen; sie legen zudem Adäquatheitsbedingungen für jede Konstruktion „demokratischer Regression“ fest. Wer immer über „demokratische Regression“ diskutieren wollte, müsste dieses Verständnis also bereits voraussetzen – andernfalls redete man aneinander vorbei. Allerdings erlaubt die so verstandene Bestimmung des Begriffs keine klare Antwort auf die Frage, warum Populationen regredieren und welche Elemente institutionellen Rückbaus aus welchen Gründen als regressiv eingestuft werden müssen.
Verstehen wir die mit Hilfe von Demokratie-Indizes messbaren Verluste an demokratischer Qualität wie geschildert als Bestimmung des Begriffs „demokratischer Regression“, wie erfolgreich ist dann Schäfers und Zürns Konzeption „demokratischer Regression“? Positiv ist hervorzuheben, dass Regression als Eigenschaft von Gemeinwesen, aber auch von Bevölkerungen identifiziert wird und sowohl objektive institutionelle als auch subjektive Einstellungsmerkmale umfasst – wobei sich darüber streiten ließe, ob sie tatsächlich nur in Kombination miteinander, oder nicht auch jeweils für sich allein vollständige Regressionsphänomene darstellen. In drei Hinsichten erschiene mir eine solcherart verstandene Konzeption „demokratischer Regression“ gleichwohl reparatur- oder ergänzungsbedürftig, um künftiger Forschung als Basis dienen zu können.
Erstens bleibt unklar, worin für die Autoren das „Ideal der kollektiven Selbstbestimmung“ besteht, von dem die Gegenwart heute angeblich überall abrückt. Es hat Vorteile, hier mit einer relativ offenen Vorstellung zu operieren, die für unterschiedliche Demokratietheorien anschlussfähig ist. Die zentrale Frage ist allerdings, ob man in der Zunahme nichtelektoraler Institutionen eine objektive institutionelle oder nur den Auslöser einer subjektiven einstellungsbasierten Regression ansehen sollte. Schäfer und Zürn legen sich insofern fest, als sie in ihnen eine „zunehmende Distanz der demokratischen Praxis vom Ideal der kollektiven Selbstbestimmung“, also eine objektive institutionelle Form der Regression sehen (S. 11). In dieser Allgemeinheit ist die Formulierung jedoch wenig hilfreich, denn nicht nach dem Mehrheitsprinzip gewählte oder entscheidende Gremien übernehmen eine Vielfalt von politischen Funktionen, die Demokratie keineswegs nur beschränken oder verhindern, sondern mitunter allererst ermöglichen. Sicher: Manche Politikfelder lassen sich technokratischen Gremien nur um den Preis demokratischer Selbstverleugnung überantworten. Wenn aber nationale und internationale Gerichte die Bühne des politischen Wettbewerbs offenhalten, Medienkonzentration verhindern oder die Gewährleistung politischer Rechte garantieren, ist ihre Funktion kein entbehrliches Merkmal allein „liberaldemokratischer“ Spielarten, sondern eine Fairnessbedingung des politischen Wettbewerbs. Das gilt in ähnlicher Weise auch für manche anderen nationalen wie internationalen Entscheidungsmechanismen. Wenn die türkische Regierung, wie unlängst geschehen, den Austritt aus der Istanbul-Konvention, dem europäischen Übereinkommen zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, erklärt, dann ist schwer zu sehen, welchem Ideal demokratischer Selbstbestimmung die Türkei damit näher rückt.
Der zweite Punkt betrifft das Verhältnis zwischen einzelstaatlicher Demokratie und horizontal-transnationalen Prozessen. Wichtige Phänomene, die sich mit Schäfers und Zürns Konzeption „demokratischer Regression“ theoretisch nicht einfangen lassen, sind etwa die Kontrolle und Beschränkung grenzüberschreitender zivilgesellschaftlicher Aktivitäten[9] oder die Kriminalisierung der ausländischen Trägerschaft von Medien und Stiftungen.[10] Die genannten Beispiele verhalten sich neutral zum Anwachsen internationaler und supranationaler Entscheidungsmechanismen und haben wohl auch mit Repräsentationslücken nichts zu tun, sind aber mit einem hinreichend vage formulierten Ideal von Demokratie als nicht weiter qualifizierter Selbstbestimmung ohne Weiteres verträglich. Ohne das hier näher ausführen oder mit den nötigen Kautelen versehen zu können, erscheint mir offensichtlich, dass die transnationale Schließung stets einen Demokratieverlust mit sich bringt. Demokratische Regression geht in solchen Fällen mit kosmopolitischer Regression einher; das eine Phänomen ist vom anderen nicht zu trennen, und beide harren einer gemeinsamen Bearbeitung. Anders als rivalisierende Ansätze plädieren die Autoren nicht für einen Rückzug in Gemeinwesen von überschaubarer Größenordnung,[11] sondern für mehr Politisierung und effektive Partizipation in überstaatlichen Organisationen, das heißt für Demokratie auch jenseits der Grenzen des Nationalstaats. Aber ihr schillernder Gebrauch des Ausdrucks „kosmopolitisch“ – als soziologische Markierung von Privilegien einerseits, als langfristige politische Menschheitsorientierung andererseits – erschwert eine klare Benennung des Zusammenhangs zwischen Demokratie und transnationaler Offenheit: Demokratischer Regression lässt sich wohl nur dort effektiv begegnen, ja sie lässt sich als solche überhaupt erst zweifelsfrei erkennen, wo eine kosmopolitische Öffnung als Ermöglichungsbedingung von Demokratie verstanden wird. Wenn Schäfer und Zürn im Schlussteil ihres Buches einerseits eine stärkere politische Kontrolle nichtelektoraler Gremien auf der nationalen Ebene und andererseits eine weitreichende Demokratisierung internationaler Organisationen fordern, erscheint ihre Agenda daher unvollständig. Was es daneben ebenfalls bräuchte, ist eine Absicherung transnationaler Einflüsse auf demokratische Staaten, wie sie etwa Seyla Benhabib in ihren Arbeiten zur demokratischen Iteration fordert,[12] und eine Stärkung der entsprechenden Institutionen und Akteure.
Ein dritter und letzter Punkt betrifft die normative Bedeutung „demokratischer Regression“, die auf der Basis ihrer speziellen Konzeption zu entwickeln wäre. Die Autoren haben zur Kennzeichnung der von ihnen untersuchten Phänomene bewusst keinen neutralen Ausdruck gewählt, sondern sich eines zumindest implizit kritischen Vokabulars bedient. Neben der Aufgabe, Prozesse der Regression von bloßen Rückschritten (wie beispielsweise der Einstellung eines ambitionierten Raumfahrtprogramms) zu unterscheiden, bleibt unklar, woher der Vorwurf rührt, der gleichfalls in dem Ausdruck steckt. Warum sollte gerade die Kombination einer Abwendung von demokratischen Institutionen mit bürgerschaftlicher Entfremdung als „Selbstverwahrlosung“ der Demokratie zu kritisieren sein (S. 11)? Die Rede von der „Selbstverwahrlosung“ verweist auf das, was der verwendeten Konzeption fehlt, nämlich ein reflexiver Bezug. Ein Gemeinwesen, das regrediert, ist nicht einfach dem Verfall preisgegeben. Es weiß, dass es regrediert und verhält sich affirmativ dazu: Anders denn als elektorale Belohnung von lustvoll vorgeführter Regression lässt sich keiner der Wahlerfolge des autoritären Populismus verstehen. Dass institutionelle Rückentwicklung nicht als Ergebnis politischer Konjunkturen oder passives Verhängnis verstanden werden kann, sondern – zumindest in konsolidierten Demokratien – die Errungenschaften kollektiver politischer Lernprozesse rückgängig macht,[13] lässt sich unter anderem daran zeigen, dass populistische Regierungen durchweg eine apologetische Vergangenheitspolitik betreiben, historische Katastrophen externalisieren und Prozesse früherer Regression verharmlosen oder affirmieren. Der Skandal der gegenwärtig zu beobachtenden demokratischen Verfallsprozesse liegt mithin darin, dass an Freiheit gewöhnte Bevölkerungen es eigentlich besser wissen sollten. Rainer Forst hat diesen Umstand in einem Vortrag als „Selbstvernachlässigung“ der Demokratie bezeichnet und damit den inneren Zusammenhang zwischen Regression und Selbstverantwortung benannt, der aus der Identität von Subjekt und Objekt demokratischer Selbstbestimmung resultiert. Im Unterschied zu scheiternder Demokratisierung, für die es vielfältige Ursachen geben mag und die von außen zurückhaltend beurteilt werden sollte, handelt es sich bei der Rückabwicklung politischer Standards um bewusste und willentliche kollektive Entscheidungen von Bürgerinnen und Bürgern und der von ihnen gewählten Amtsträgerinnen und Amtsträger, die teilweise seit Jahrzehnten Subjekte demokratischer Erfahrungen sind und nun deren ermöglichende Bedingungen, Konflikttoleranz und Offenheit, verabschieden oder ihrer Verabschiedung Vorschub leisten. Insofern verlangt eine Konzeption demokratischer Regression nach einer breiteren Phänomenologie und einer schärferen Bestimmung derjenigen Elemente, die es an einem bestimmten Demokratieideal und seinen notwendigen Voraussetzungen zu verteidigen gilt.
Insgesamt überzeugt Die demokratische Regression als beherzter erster Zugriff auf ein bewegliches Ziel. Das Buch kombiniert eine fundierte Einschätzung empirischer Prozesse der Rückabwicklung demokratischer Qualität, die man wohl besser nicht ebenfalls als „Regression“ bezeichnet hätte, mit einer aussagefähigen erklärenden Konzeption, die nun einer stärkeren normativen Konturierung bedarf, um ein komplettes Bild unserer regressiven Gegenwart zu entwerfen. Das Thema wird uns weiter begleiten, denn die Autoren verweisen mit der Diagnose einer „doppelten Entfremdung“ auf eine demokratische Pathologie, für deren Bestehen sie wichtige Symptome anführen; gleichzeitig identifizieren sie damit die Angriffspunkte, an die gewiefte Politikunternehmer die Axt legen, um noch leidlich funktionierende demokratische Institutionen weiter zu beschädigen. Das Spannungsverhältnis zwischen den Prozessen der demokratischen Regression und ihrer zielgerichteten Ausbeutung markiert die Streitpunkte, die im Anschluss an das Buch zu diskutieren sein werden.
Fußnoten
- Vgl. zuletzt Amy Allen, Das Ende des Fortschritts. Zur Dekolonisierung der normativen Grundlagen der kritischen Theorie, übers. von Frank Lachmann, Frankfurt am Main / New York 2019.
- Heinrich Geiselberger (Hg.), Die große Regression. Eine internationale Debatte über die geistige Situation der Zeit, Berlin 2017. Für hilfreiche Hinweise danke ich Svenja Alhaus, Markus Patberg und Kai-Uwe Schnapp.
- Siehe hierzu etwa Steven Levitsky / Daniel Ziblatt, Wie Demokratien sterben. Und was wir dagegen tun können, übers. von Klaus-Dieter Schmidt, München 2018; Yascha Mounk, Der Zerfall der Demokratie. Wie der Populismus den Rechtsstaat bedroht, übers. von Bernhard Jendricke, Berlin 2018.
- Karen J. Alter / Michael Zürn, Conceptualising Backlash Politics, in: The British Journal of Politics and International Relations 22 (2020), 4, S. 563–584, hier S. 566.
- David Art, The Myth of Global Populism, in: Perspectives on Politics, First View, 2020, S. 1–13; DOI: doi.org/10.1017/S1537592720003552.
- Siehe dazu das V-Dem Codebook 11.1, Göteborg 2021, S. 372–386.
- Bereits in der Diskussion der These von der „großen Regression“ wurde angemerkt, dass der verwendete Regressionsbegriff psychologische, institutionelle und sogar zivilisatorische Dimensionen umfasse und zwischen diesen nicht immer hinreichend trennscharf unterscheide. Siehe Frieder Vogelmann, Stichworte zur politischen Situation der Zeit. Ein kritischer Sammelband thematisiert „Die große Regression“, in: Soziopolis, 10.04.2017.
- Siehe John Rawls, A Theory of Justice, Cambridge, MA 1999, S. 5; H. L. A. Hart, The Concept of Law, Oxford 1961, S. 155.
- Vgl. Christian Böhme / Lissy Kaufmann, Israel: Strenge Auflagen für Nichtregierungsorganisationen, in: Der Tagesspiegel, 12.07.2016; UN Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, Maina Kiai, 24.04.2013.
- Siehe Gerhard Gnauck, Man nennt es „Repolonisierung“, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10.12.2020; Ismail Azzam, Ägypten: Neuer Streit ums NGO-Gesetz, in: Deutsche Welle, 08.11.2018; Galina Timtschenko / Christian Gesch, „Ich nenne das eine Geiselnahme“, in: Der Spiegel, 01.05.2021.
- Vgl. Dirk Jörke, Die Größe der Demokratie. Über die räumliche Dimension von Herrschaft und Partizipation, Berlin 2019.
- Siehe dazu u.a. Seyla Benhabib, Kosmopolitismus ohne Illusionen. Menschenrechte in unruhigen Zeiten, übers. von Karin Wördemann u.a., Frankfurt am Main 2016; Svenja Ahlhaus, Die Grenzen des Demos. Mitgliedschaftspolitik aus postsouveräner Perspektive, Frankfurt am Main / New York 2020.
- Jürgen Habermas, Auch eine Geschichte der Philosophie, Bd. II, Berlin 2019, S. 791.
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Karsten Malowitz.
Kategorien: Demokratie Gesellschaft Politik Politische Theorie und Ideengeschichte
Zur PDF-Datei dieses Artikels im Social Science Open Access Repository (SSOAR) der GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gelangen Sie hier.
Empfehlungen
Ziemlich beste Feinde. Das spannungsreiche Verhältnis von Demokratie und Kapitalismus
Konferenz der DVPW-Sektionen „Politische Theorie und Ideengeschichte“ und „Politische Ökonomie“, Schader-Forum Darmstadt, 23.–25. Juni 2016
Anna-Maria Kemper, Hannah Riede
Formwandel der Demokratie
Tagung der DVPW-Sektion "Politische Theorie und Ideengeschichte", Universität Trier, 29.-31. März 2017