Bernd Ladwig | Rezension | 28.05.2025
Die wandelbare Wahrheit der Moral
Rezension zu „Moralische Gefühle, moralische Wirklichkeit, moralischer Fortschritt“ von Thomas Nagel
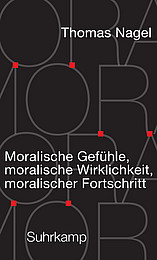
Der US-amerikanische Philosoph Thomas Nagel hat ein kurzes, aber gehaltvolles Buch über Grundfragen der Moralphilosophie geschrieben, das jetzt in deutscher Übersetzung vorliegt. Es besteht aus zwei Essays; der kürzere erste geht auf eine Dewey-Lecture von 2015 zurück, der längere zweite auf eine Laudatio für Nagels Kollegen Thomas M. Scanlon aus dem Jahr 2016. In beiden Essays geht es um Fragen moralischer Epistemologie. Nagel interessiert, welche Autorität moralischen Urteilen, Wahrnehmungen und Intuitionen zukommt. Dabei umgeht er die skeptische Grundsatzfrage, ob wir auf moralischem Gebiet überhaupt etwas mit Gewissheit erkennen können. Vielmehr setzt er die Wahrheit des Kognitivismus voraus und will wissen, wie wir ihn am besten verstehen sollten. Er nimmt dazu Intuitionen im Sinne von relativ stabilen und starken vortheoretischen Überzeugungen als Ausgangsmaterial und gleicht sie mit Grundpositionen der Moraltheorie ab.[1]
Das Ergebnis seiner Überlegungen ist eine pluralistische Version des moralischen Realismus: Manche unserer Intuitionen weisen demnach in eine konsequentialistische, andere in eine deontologische Richtung, und beiden Arten von Überzeugungen lassen sich Prinzipien zuordnen, die für ihre Unverzichtbarkeit sprechen. Nagel knüpft damit an ältere Überlegungen an, in denen deutlicher als in den beiden Essays der dualistische Grundzug seines ganzen Philosophierens zutage tritt. Dieser hat ihn zu einer prägenden Figur nicht nur der Moralphilosophie, sondern auch der Erkenntnistheorie und der Philosophie des Geistes gemacht und sei darum kurz vorgestellt.
Zwei Standpunkte
Nagel zufolge sind wir Menschen dazu imstande, zwei verschiedene Standpunkte einzunehmen, einen unpersönlichen und einen persönlichen. Was Letzteren betrifft, so ist jeder von uns gleichsam der Nullpunkt seiner eigenen Orientierung als leiblich-seelisches Subjekt. Zugleich aber können wir von unserer je persönlichen Stellung in der Welt auch abstrahieren.[2] Radikal unpersönlich mutet etwa die Objektivität an, nach der die modernen Naturwissenschaften streben. Ihre Begrifflichkeiten ebnen selbst noch die Besonderheiten des Menschseins, ja des lebendigen Erlebens überhaupt ein. Aber es wäre, so Nagel, schlechte Philosophie, daraus reduktionistische Schlüsse zu ziehen. Noch so viel Wissen über Echolokation erschließt uns zum Beispiel nicht, wie es sich anfühlt, eine Fledermaus zu sein. Es gibt uns keinen Zugang zur Erste-Person-Perspektive.[3] Und ohne Erste-Person-Perspektive könne es auch keine Subjekte geben, die naturwissenschaftliche Betrachtungen anstellen.
Der konstitutive Dualismus des Unpersönlichen und des Persönlichen durchzieht auch das moralische Urteilen, wie Nagel es versteht. Er ist dort allerdings weniger radikal als in den Naturwissenschaften, weil der unpersönliche Standpunkt nicht von uns verlangt, das eigene Menschsein auszuklammern, sondern nur, von unserer je besonderen Position im sozialen Gefüge abzusehen. Wir sollen uns als Mensch unter Menschen betrachten, die alle den gleichen moralischen Status haben. Mein Leben, mein Wohlbefinden, meine Selbstbestimmung sind moralisch gesehen nicht mehr und nicht weniger wichtig als das Leben, das Wohlbefinden und die Selbstbestimmung irgendeines anderen. Für mich als moralischen Akteur folgen daraus Handlungsgründe, die nicht nur mich persönlich, sondern jeden beliebigen Menschen unbedingt binden. Zugleich kann ich aber auch als moralischer Akteur nicht ignorieren, dass ich ein ganz bestimmter Mensch bin, der sein eigenes und einziges Leben führt und verantwortet. In früheren Schriften hat Nagel argumentiert, dass deshalb zur Moral auch akteur-relative Gründe gehörten.[4] So mache es einen Unterschied, ob irgendjemand lügt oder ob gerade ich damit leben muss, einen anderen angelogen zu haben.
Widerstreitende Intuitionen
Zu Beginn seines neuen Buches gibt Nagel ein eindrückliches Beispiel für die Bedeutung, die akteur-relative Gründe selbst in Extremsituationen haben können. Das Beispiel handelt von seinem philosophischen Fachkollegen Stuart Hampshire, der als Soldat im Zweiten Weltkrieg vor der Frage stand, ob er einen todgeweihten Kollaborateur über dessen bereits beschlossenes Los belügen sollte, um ihm zuvor noch kriegswichtige Informationen zu entlocken. Hampshire, so Nagel, habe sich dazu außerstande gesehen, obwohl dies den Kollaborateur nicht vor der Erschießung bewahrte, die Alliierten aber die erhofften Informationen kostete. Ein schlechter Deal? Von einem unpersönlichen Standpunkt aus gesehen gewiss. Aber kommt es in Fragen der Moral nur darauf an, welche Weltzustände wir durch unser Handeln wahrscheinlich herbeiführen? Nagel bezweifelt dies. Hampshire hätte sich damit rechtfertigen können, dass Lügen eine an sich falsche Handlungsweise sei.
Diese mögliche Verteidigung verdeutlicht, dass für Nagel die Unterscheidung zwischen akteur-neutralen und akteur-relativen Handlungsgründen mit einer anderen Grunddifferenz im moralischen Denken zusammenhängt: derjenigen zwischen konsequentialistischen und deontologischen Grundsätzen. Kommt es moralisch letztendlich immer und einzig auf die bestmöglichen Folgen einer Handlung beziehungsweise Regelung an, oder zumindest auch auf deren intrinsische Merkmale? Ist, mit anderen Worten, das Richtige nur eine Funktion des Guten, das wir damit (voraussichtlich) bewirken, oder kann es von diesem auch unabhängig sein?
Konsequentialisten haben auf verschiedenen Wegen versucht, unsere deontologischen Intuitionen wegzuerklären. Ein klassisches Beispiel hierfür bildet David Humes Argument, die Bereitschaft zur Beachtung subjektiver Rechte sei nur eine „künstliche Tugend“, die letztendlich dem Gemeinwohl diene.[5] Neuerdings noch beliebter ist die moralpsychologische Unterscheidung zwischen schnellem, gefühlsbetontem und langsamem, reflektiertem Denken:[6] Spontan neigten viele Menschen, wie auch Hampshire, zu deontologischen Skrupeln. Aber wenn sie sich auf das genauere langsame Denken einließen, würden sie die rationale Überlegenheit des Konsequentialismus anerkennen.
Nagel zeigt sich von derlei Argumenten wenig beeindruckt. Warum etwa, so fragt er, sollte Hampshires Weigerung, den Kollaborateur anzulügen, moralisch unhaltbar sein, nur weil sie vielleicht einer unmittelbaren moralischen Reaktion entsprang und nicht das Ergebnis distanzierter Folgenabschätzung war? Der Konsequentialismus, der die moralische Qualität einer Handlung oder Regelung allein anhand ihrer (voraussichtlichen) Folgen beurteilt, lässt sich nicht ohne falschen Zirkelschluss mit Befunden der Moralpsychologie rechtfertigen. Er ist nicht weniger von moralischen Intuitionen abhängig als sein deontologischer Widersacher. Dass gleiche Schmerzen gleich zählen, ist so eine moralische Intuition; dass jeder einzelne Mensch einen Status der Unverletzlichkeit als autonomes Rechtssubjekt hat, ist eine andere. Nagel will keinen der beiden Typen von Intuitionen aufgeben oder den einen auf den anderen reduzieren. Für ihn ist darum auch klar, dass es keinen Fortschritt an moralischer Erkenntnis bedeutete, wenn wir etwa die Idee individueller Rechte ganz in Erwägungen zum kollektiven Wohl aufgehen ließen. Er ist davon überzeugt, dass damit etwas Wertvolles verloren ginge, und beschließt seinen ersten Essay deshalb mit den Worten:
„Die menschliche Moral wird sich zweifellos weiterentwickeln, und vielleicht wird sie in sich eine konsequentialistische Richtung bewegen. Doch die vollkommen andersartige Form, Individuen wertzuschätzen, indem man sie – komme, was wolle – jeweils für sich anständig behandelt und eine solche Behandlung auch für sich selbst einfordert, gehört ganz wesentlich zu unserem Leben.“ (S. 38 f.).
Wahrheit und Zugänglichkeit praktischer Gründe
Damit ist die Brücke zum zweiten Essay geschlagen: Was berechtigt uns dazu, in einer Überzeugung wie der moralischen Statusgleichheit aller Menschen als Träger von Rechten einen Zugewinn an moralischer Einsicht zu sehen? Als moralischer Realist nimmt Nagel an, die Existenz moralischer Gründe sei davon unabhängig, ob und wie viele Menschen faktisch an sie glauben. Moralischer Fortschritt liege vor, wo Menschen zu neuen wahren Überzeugungen über Handlungsgründe gelangen oder falsche Auffassungen berichtigen. Wir sollten uns diesen Fortschritt aber nicht, nach dem Vorbild der Naturwissenschaften, als zunehmende Einsicht in zeitlose Wahrheiten vorstellen. Das sei schon deshalb nicht sinnvoll, weil moralische Wahrheiten von praktischen Gründen handelten und also Subjekte voraussetzten, die solche Gründe verstehen können. Praktische Gründe seien Antworten auf die Frage, wie jemand handeln sollte, und diese Frage könne sich nur einer normativ zurechnungsfähigen Person stellen. Schwere Schmerzen seien zwar schon im Mesozoikum intrinsisch schlecht gewesen, aber in Ermangelung moralfähiger Akteure habe es noch keine Gründe gegeben, gegen sie vorzugehen.
So weit, so klar. Aber Nagel geht noch darüber hinaus und vertritt eine schwerer zu verstehende und wohl auch zu verteidigende Position. Die Existenz praktischer Gründe setze nicht nur Personen voraus, die überhaupt über praktische Vernunft verfügen, es gebe solche Gründe überhaupt nur unter der Bedingung, dass sie den Menschen, für die sie Gründe sein sollen, prinzipiell zugänglich sind. Diese Bedingung der Zugänglichkeit ist stärker und spezieller als die allgemeine Bedingung der praktischen Vernunftfähigkeit, weil sie dafür spricht, dass jedenfalls manche moralischen Gründe kulturell und historisch relativ sind. In Nagels Worten:
„Gründe können nicht vollkommen verborgen sein, wie die chemische Zusammensetzung von Salz in der fernen Vergangenheit. Ein Weg zu ihrer Erkenntnis muss für die Personen, für die sie bestimmt sind, zu jener Zeit verfügbar sein – nicht erst nach Jahrhunderten geschichtlicher Entwicklung.“ (S. 46)
Man könnte meinen, dies sei ein Rückfall in einen mit dem moralischen Realismus unvereinbaren Relativismus. Nagel zufolge wäre dem jedoch nur so, wenn wir Zugänglichkeit mit tatsächlichem Zugang gleichsetzten. Ob und wie viele Menschen an einen Handlungsgrund glauben und ihr Tun und Lassen an ihm ausrichten, sei eine Frage der Psychologie. Der Inhalt eines praktischen Grundes sei aber keine Funktion von Einstellungen, die Personen faktisch haben oder nicht haben. Er ergebe sich vielmehr aus Tatsachen, die für Personen relevant werden als etwas, das für oder gegen eine bestimmte Handlung spricht. Das setze aber eben voraus, dass die Person nicht nur allgemein praktisch vernünftig ist, sondern dass sie die epistemische Möglichkeit hat, eine besondere Tatsache als für ihr praktisches Schlussfolgern bedeutsam zu begreifen.
Nagel denkt hier einerseits an Tatsachen wie die, dass eine bestimmte Handlung einem anderen schwere Schmerzen bereiten könnte. Hier scheint er anzunehmen, dass die praktische Vernunft zusammen mit dem allgemein-menschlichen Vermögen des Mitfühlens hinreiche, um in dieser Tatsache einen prima facie gültigen Grund gegen die fragliche Handlung zu erblicken. Der Inhalt des Grundes ergibt sich demzufolge aus der intrinsischen Schlechtigkeit schwerer Schmerzen, und er erfüllt die Bedingung der Zugänglichkeit ohne historisch spezifische Voraussetzungen ideeller oder institutioneller Art. Auf der anderen Seite steht für Nagel etwa das liberale Prinzip politischer Legitimität. Es besagt ungefähr, dass die Grundsätze, nach denen Staatsbürger regiert werden, für diese als Freie und Gleiche akzeptabel sein müssen und sie deshalb das Recht haben, die politischen Autoritäten durch freie Meinungsäußerung infrage zu stellen und durch Abwahl zu bestrafen.
Offensichtlich sind Staatsbürgerschaft, Meinungsfreiheit und Wahlrecht institutionelle Tatsachen, die nicht immer schon vorlagen, wo nur überhaupt normativ zurechnungsfähige Menschen lebten und zusammenwirkten. In diesem Sinne sind sie fraglos historisch voraussetzungsvoll. So mag man zugunsten Nagels etwa argumentieren, dass zu den Anwendungsbedingungen des Wahlrechts im modernen Sinne ein moderner, gewaltmonopolisierender Staat gehöre. Doch wie immer man das sieht, die bloße Tatsache, dass manche wahren Aussagen von geschichtlichen Gegenständen handeln, ändert noch nichts an der logischen Zeitlosigkeit ihrer Wahrheit. Der Satz „Bernd Ladwig bekleidet im Jahr 2025 die Professur für politische Theorie und Philosophie am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin“ handelt zweifellos von Gegenständen, die mit der Zeit entstehen und vergehen, nämlich Menschen, Professuren und Universitäten. Die Wahrheit des damit Gesagten ist dennoch eine unverlierbare Eigenschaft, denn sie hängt nicht davon ab, wann es gesagt wird.
Nagel könnte antworten, das sei so, weil dieser Satz keine praktische Wahrheit ausdrücke. Praktische Wahrheiten handelten von den Gründen, die jemand habe, etwas zu tun oder zu lassen, und um einen Handlungsgrund zu haben, müsse dieser für den Handelnden eben kognitiv zugänglich sein. Die Gründe aber, die für das liberale Legitimitätsprinzip sprechen, seien selbst so scharfsinnigen Denkern wie Thomas Morus oder Thomas Hobbes zu ihrer Zeit beim besten Willen noch nicht zugänglich gewesen. Folglich handele es sich hier um eine Wahrheit, die auch im logischen Sinne temporal sei.
An einem anderen Beispiel wird deutlich, wie problematisch diese Annahme ist. Nagel nimmt an, dass der Begriff eines neutralen Rechts auf individuelle Religionsfreiheit erst nach den verheerenden Religionskriegen der Neuzeit kognitiv fassbar geworden sei. Auch dieses Prinzip sei darum erst im Laufe der Zeit, unter dem Eindruck kontingenter Entwicklungen, wahr geworden. Aber abgesehen von der Frage, woher Nagel wissen will, was welche Menschen wann erkennen konnten, liegt noch ein weiterer Einwand auf der Hand: Die Überzeugung, man dürfe die Ungläubigen im Namen der wahren Religion unterdrücken, hielt der neuzeitlich-modernen Metaphysikkritik nicht stand. Sie hat uns gelehrt, zwischen Fragen des Wissens und Fragen des Glaubens zu unterscheiden.
Weil sich Gottes Existenz nicht beweisen lässt und keine Kirche einen privilegierten Zugang zur Wahrheit hat, war der Anspruch, eine religiöse Lehre mit Feuer und Schwert zu verbreiten, nie durch gute Gründe gedeckt. Vielmehr war es schon immer wahr, dass die Gründe für religiöse Intoleranz schlechte Gründe waren.[7] Das passt zu der realistischen Intuition, dass die liberal-demokratischen Gemeinwesen, als sie sich zum Grundrecht der Religionsfreiheit durchrangen, damit einer echten moralischen Einsicht Geltung verschafften. Die gültigen Gründe, die für dieses Recht sprachen, traten nicht erst mit den liberaldemokratischen Ordnungen in die Welt; vielmehr verdanken diese ihre Legitimität – die heute allerdings faktisch unter Druck steht – den moralischen Lernprozessen, die sich in ihren Prinzipien, Regeln und Strukturen niedergeschlagen haben.
Für einen konsequenteren moralischen Realismus
Was dann von Nagels Argument bleibt, ist die Warnung vor einer vorschnellen moralischen Verurteilung von Menschen für Ansichten oder Praktiken, deren Falschheit sie vielleicht noch nicht erkennen konnten. Nicht alles, was moralisch falsch ist, ist darum schon vorwerfbar falsch. Vorwerfbar falsch ist eine Handlung erst dann, wenn die Handelnde für sie keine guten rechtfertigenden Gründe hat und ein anderes Handeln von ihr normativ erwartet werden darf. Sie muss dazu wissen können, dass ihre Handlung moralisch falsch ist. Hier hat mithin die Bedingung der Zugänglichkeit ihren rechtmäßigen Platz.
Nagel weist selbst in einer Fußnote (S. 73) auf diese „natürliche Alternative“ zu seiner Sichtweise hin. Er verwirft sie allerdings mit dem Argument, dass Urteile über ein Unrecht von Gründen für ein Handeln abhingen, die etwa die Menschen in der vorliberalen Zeit noch nicht gehabt hätten. Aber die Rede vom „Haben“ eines Grundes ist zweideutig. Sie kann gleichgesetzt werden mit der Behauptung, ein bestimmter Grund sei einem bestimmten Akteur zugänglich, aber sie muss nicht so verstanden werden. Wenn ein (rechtfertigender) Handlungsgrund etwas ist, das für eine bestimmte Handlung spricht, dann ist es in der Tat „natürlich“ zu sagen, die Unbeweisbarkeit religiöser Behauptungen habe schon immer für die Religionsfreiheit gesprochen. In diesem Sinne des Sprechens-für hatten auch schon die Menschen in der Zeit vor den Religionskriegen einen Grund, von Zwang und Gewalt in Glaubensfragen abzusehen, ob sie das bereits erkennen konnten oder nicht.
Ich denke darum, Nagel hätte gut daran getan, seinen Realismus mit noch größerer Konsequenz zu vertreten. Das hätte ihn nicht der Möglichkeit beraubt, etwa die Wahrheit des Satzes „Staatliche Autorität bedarf, wo immer möglich, der demokratischen Legitimation“ auf seine Anwendungsbedingung, eben staatliche Herrschaft, hin zu relativieren. Auch ein konsequenterer Realismus muss darum den Sinn für geschichtliche Kontingenz nicht verlieren. In jedem Fall aber ist es erfrischend, mit welcher Verve Nagel einem relativistischen und reduktionistischen Zeitgeist entgegentritt. Sein Glaube an die Möglichkeit moralischen Fortschritts ist nicht nur ermutigend; er ist auch unverzichtbar, um die Verluste zu ermessen, die uns in dieser dunklen Zeit rapider Regression drohen. In diesem Sinne sind seinen gedankenreichen und auch schnörkellos geschriebenen Essays noch viele Leserinnen und Leser zu wünschen.
Fußnoten
- Er folgt damit John Rawls’ methodologischem Vorschlag der Suche nach einem Überlegungsgleichgewicht. Vgl. John Rawls, Eine Theorie der Gerechtigkeit, übers. von Hermann Vetter, Frankfurt am Main 1975, S. 68–71.
- Thomas Nagel, Der Blick von nirgendwo, übers. von Michael Gebauer, Frankfurt am Main 1992; ders., Eine Abhandlung über Gleichheit und Parteilichkeit und andere Schriften zur politischen Philosophie, übers. und mit Nachbemerkungen sowie einem Schriftenverz. hrsg. von Michael Gebauer, Paderborn u.a. 1994.
- Thomas Nagel, Wie ist es, eine Fledermaus zu sein?, in: Peter Bieri (Hg.), Analytische Philosophie des Geistes, 4., neu ausgestattete Aufl., Weinheim/Basel 2007, S. 261–275.
- Thomas Nagel, Die Grenzen der Objektivität. Philosophische Vorlesungen, übers. und hrsg. von Michael Gebauer, Stuttgart 1991, S. 70–98.
- David Hume, Ein Traktat über die menschliche Natur [1739/40], Band II, Drittes Buch: Über Moral, Zweiter Teil, Hamburg 1978.
- Siehe etwa Daniel Kahneman, Schnelles Denken, langsames Denken, übers. von Thorsten Schmidt, München 2012.
- Ähnlich argumentiert Hilary Putnam mit Blick auf die angebliche Rationalität des Glaubens an das Gottesgnadentum königlicher Herrschaft. Vgl. ders., Vernunft, Wahrheit und Geschichte, übers. von Joachim Schulte, Frankfurt am Main 1990, S. 209–212.
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Karsten Malowitz.
Kategorien: Epistemologien Normen / Regeln / Konventionen Philosophie Wissenschaft
Zur PDF-Datei dieses Artikels im Social Science Open Access Repository (SSOAR) der GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gelangen Sie hier.
Empfehlungen
Mit Foucault im Lotussitz
Rezension zu „Das therapeutisierte Subjekt. Arbeiten am Selbst in Psychotherapie, Beratung und Coaching“ von Eva Georg
Hinterfragt – Der Ethik-Podcast
Entscheidungen über das Verhalten werden oft sekundenschnell getroffen: erst im Gespräch, das Situation, Optionen und Gründe auseinanderdividiert, ergeben sich ethische Alternativen.
Theodor W. Adorno and the Sources of Normativity
Frankfurter Adorno-Vorlesungen 2019 von Peter E. Gordon
