Sylvia Terpe | Rezension | 04.08.2021
Hoffnungsvoll in eine ungewisse Zukunft
Rezension zu „Radikale Hoffnung. Ethik im Angesicht kultureller Zerstörung“ von Jonathan Lear
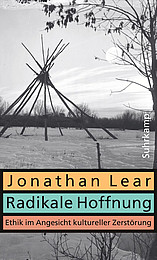
Auch wenn die deutsche Übersetzung des bereits 2006 im englischsprachigen Original erschienenen Buches des US-amerikanischen Philosophen und Psychoanalytikers Jonathan Lear spät kommt, hat das Thema nicht an Aktualität verloren. Am Beispiel der Crow-Indianer diskutiert Lear, wie die Zerstörung einer Kultur und der mit ihr verbundenen Lebensweise erlebt wird und wie es ihren Angehörigen dennoch gelingen kann, der ungewissen Zukunft hoffnungsvoll entgegenzublicken. Lears Erkenntnisinteresse beschränkt sich dabei nicht allein auf die Crow. Er macht darauf aufmerksam, dass auch „unsere Lebensweise […] auf viele Arten verletzlich“ (S. 26) ist und radikale Hoffnung eine Art, auf solche Verletzungen zu reagieren. Auf diese Einschätzung wird am Ende der Rezension zurückzukommen sein. Zuvor geht es darum, was radikale Hoffnung im Sinne Lears eigentlich beschreibt, wie er sie empirisch erkundet (Kapitel 1), theoretisch verankert (Kapitel 2) und normativ rechtfertigt (Kapitel 3).
Die Zerstörung einer Kultur
Den Auftakt des Buches bildet die Geschichte des letzten traditionell gewählten Häuptlings der Crow, Plenty Coups, und seines Stammes, die jener kurz vor seinem Tod einem „weißen Mann“ (S. 19) erzählt. Die Erzählung endet in den 1880er-Jahren mit der „Verweisung der Crow“ (S. 20) in ein Reservat und den Worten Plenty Coups: „Danach ist nichts mehr geschehen.“ (S. 21) Diese Feststellung des Häuptlings ist der Ausgangspunkt der Überlegungen Lears, denn sie irritiert. So war das Leben Plenty Coups’ nach dem Einzug in das Reservat bis zu seinem Tod im Jahr 1932 beileibe nicht ereignislos: Er war weiterhin aktiv an den Verhandlungen der Crow mit der US-Regierung beteiligt, widmete sich dem Ackerbau und „ermutigte junge Crow, die Bildung des weißen Mannes zu erwerben und sogar für seine Religion offen zu sein“ (S. 25). Plenty Coups selbst „ließ sich kirchlich taufen und trauen“ (S. 151).
Was kann es also bedeuten, wenn Plenty Coups sagt, dass „danach […] nichts mehr geschehen“ sei? Lear diskutiert zunächst verschiedene Deutungsmöglichkeiten und liefert damit nebenbei ein anschauliches Beispiel für die Schwierigkeiten des Fremdverstehens.[1] Und obgleich Lear sich nicht anmaßt, „sagen zu können, was Plenty Coups wirklich sagen wollte“ (S. 25), erscheint ihm doch eine bestimmte Deutung als besonders plausibel. Diese schildert er im ersten Teil des Buches in einer ausgesprochen spannenden Darstellung anhand verschiedener historischer und ethnographischer Quellen, um sie später seiner Konzeption einer radikalen Hoffnung zugrunde zu legen.
Dieser Deutung zufolge wurden die Crow mit dem Einzug in das Reservat ihrer traditionellen nomadischen Lebensweise beraubt: Sie waren daran gehindert, umherzuziehen, konnten keine Büffel mehr jagen und nicht länger kriegerische Auseinandersetzungen mit anderen Stämmen führen. Doch der Verlust ging nach Lear noch tiefer. Denn mit der Verunmöglichung dieser Praktiken und damit des Vollzugs ihrer traditionellen Lebensweise, verloren auch die Begriffe, mit denen sich die Crow ihr Leben bislang verständlich gemacht hatten, ihre Bedeutung und konnten nicht mehr sinnvoll angewendet werden. Lear zitiert die Medizinfrau Pretty Shields, die nach der Übersiedlung ins Reservat konstatierte: „Ich versuche ein Leben zu führen, das ich nicht verstehe.“ (S. 94)
Mit dem Verlust der Praktiken und der ihnen zugehörigen Begriffe ging zudem eine tiefe Verunsicherung über die eigene Identität einher. Es hatte keinen Sinn mehr, die alten Ideale eines guten und gelungenen Lebens anzustreben, da es faktisch unmöglich geworden war, ein guter Krieger (der viele Coups zählt) oder eine gute Squaw (die ihre Kinder auf Jagd und Krieg vorbereitet) zu sein. Auch „[w]as es heißen sollte hervorragend als Häuptling zu sein, hatte keine klare Bedeutung mehr“ (S. 82). Mit der Vorstellung einer guten – oder überhaupt beschreibbaren – Zukunft verloren die Crow auch ihre „Zeitlichkeit“ (S. 75). Die praktischen Alltagsverrichtungen, die dem Überleben im Reservat dienten, blieben Tätigkeiten im Hier und Jetzt und hörten auf, für die Zukunft bedeutungsvolle Ereignisse zu sein. Wenn Plenty Coups also sagt, dass nach dem Einzug in das Reservat „nichts mehr geschehen“ sei, so ist dies nach Lears Interpretation vor dem Hintergrund einer kulturellen Zerstörung zu verstehen, die ihrerseits den umfassenden Zusammenbruch einer Lebensweise, ihrer Begriffe und ihrer Selbstverständlichkeiten, einschließlich ihrer Zeitlichkeit, bedeutet.
Die Entstehung einer Ethik radikaler Hoffnung
Im zweiten Teil des Buches wirft der Autor die Frage auf, warum die Crow auf diese Entwicklung weder mit Verzweiflung noch mit Apathie reagierten. Die hypothetische Antwort lautet: Womöglich, weil sie die Fähigkeit zu radikaler Hoffnung ausbildeten. Anstatt an den alten Vorstellungen und Begriffen festzuhalten und nostalgisch auf die unwiederbringliche traditionelle Lebensweise zurückzublicken, seien die Crow in der Lage gewesen, einen gänzlich anderen Bedeutungsrahmen zu entwickeln: den der radikalen Hoffnung.
Radikale Hoffnung im Sinne Lears beschreibt die „Hoffnung darauf, dass [in der Zukunft] etwas Gutes hervortreten wird, selbst wenn man gegenwärtig noch nicht über die Begriffe verfügt, mittels derer man sich dieses Gute verständlich machen kann“ (S. 10). Es handelt sich also um „die Hoffnung auf eine Zukunft, die noch nicht zu begreifen“ (S. 182) ist und die dennoch als eine Ethik „dem Gedanken verpflichtet“ ist, „dass etwas Gutes entstehen“ wird – ohne dass man weiß, worin genau dieses Gute besteht (S. 153). Die Qualität einer Ethik erhält diese Hoffnung nach Lear durch ihren Charakter eines Gebotes: die Bedeutung kognitiven „Verstehens“ wird durch die emotional-moralischer „Verpflichtung […] übertroffen“ (S. 147).
Lear verortet den Ursprung dieser radikalen Hoffnung in einer Traumvision, die der 9-jährige Plenty Coups Mitte der 1850er-Jahre hatte. Die Traumdeutung war eine im Stamm der Crow übliche kollektive Praxis, „um die Zukunft vorauszusagen“ (S. 113). Nach Lear waren sowohl der Traum Plenty Coups als auch dessen Deutung durch die Stammesältesten eine Reaktion auf die damaligen Entwicklungen. Durch das Vordringen des „weißen Mannes“ (S. 96) sahen sich die Crow mit einer Situation konfrontiert, in der es nicht nur immer weniger Büffel gab; auch mussten sie „verheerende Krankheiten und schreckliche Angriffe“ vonseiten ihrer traditionellen Feinde „ertragen“ (S. 124), allen voran der Sioux, aber auch von anderen Stämmen. Nach Lear gab Plenty Coups’ Traum den damit verbundenen „Ängsten und Sorgen eine narrative Form“ (S. 124 f.). Unter anderem sagte der Traum voraus, dass ein großer Sturm – interpretiert als die mit dem „Ansturm des weißen Mannes“ (S. 198) einhergehenden Umwälzungen – kommen werde. Zum Überleben bedürfe es der „Weisheit der Meise“ (S. 205) – interpretiert als die Fähigkeit, anderen zuzuhören und von ihnen zu lernen (S. 127 ff.). Einer der damaligen Stammesältesten fasste die Bedeutung des Traumes folgendermaßen zusammen: „Ich sehe seine Warnung. Diejenigen Stämme, die den weißen Mann bekämpft haben, sind alle geschlagen und ausgelöscht worden. Wenn wir zuhören, so wie es die Meise tut, können wir womöglich diesem Schicksal entgehen und unsere Gebiete behalten.“ (S. 117)
Lear interessiert sich vor allem für die psychologischen Voraussetzungen, derer es bedarf, um die Zeiten eines fundamentalen Umbruchs bewältigen zu können. Im Bild der Meise erkennt er ein neues „Ichideal“, das ermutigt „zuzuhören und […] von anderen zu lernen“ (S. 141). Zwar „lag noch im Dunkeln“ (S. 122), was genau es zu lernen galt, doch war nach Lear damit der Grundstein dafür gelegt, sich den Herausforderungen einer ungewissen Zukunft nicht zu versperren, sondern sie mutig anzunehmen. Diese „neue Form des Mutes“ (S. 128) in Gestalt von Offenheit gegenüber „einer radikal neuartigen Zukunft“ (S. 113) und die radikale Hoffnung selbst gehören dementsprechend untrennbar zusammen.
Angesichts dieses, von Lear mehrfach besonders hervorgehobenen, Prinzips der Offenheit (S. 140) ist es überraschend, dass er eine praktische Schlussfolgerung der Crow als nahezu zwangsläufig präsentiert. Und zwar „entschieden [sie] sich dazu, sich mit dem weißen Mann gegen ihre traditionellen Feinde zu verbünden. Auf diese Weise wollten sie den herannahenden Sturm überstehen und ihr Stammesgebiet behalten“ (S. 119). Faktisch bedeutete Offenheit also die Hinwendung der Crow zu ‚den Weißen‘, nicht aber zu den Sioux und anderen ihrer traditionellen Feinde. So radikal neu ihr Zugehen auf ‚die Weißen‘ auch gewesen sein mag, so traditionell blieben die Crow im Hinblick auf ihre alten Feindschaften. Lear thematisiert diese Feindschaften zwar, sieht indes aber nicht, dass gerade sie sich dem Mut zur Offenheit und damit auch der radikalen Hoffnung der Crow entziehen. Dieser blinde Fleck beeinflusst leider auch die Betrachtungen im letzten Teil des Buches.
Eine Rechtfertigung radikaler Hoffnung
Im dritten Teil beschreibt Lear die Plenty Coups zugeschriebene Position radikaler Hoffnung als sachlich und moralisch gerechtfertigt – und verteidigt sie insbesondere gegen die Angriffe von Sitting Bull, einem Stammeshäuptling und spirituellen Führer der Sioux. Sitting Bull hatte vor allem durch seinen Kampf gegen ‚die Weißen‘ sowie durch seine Versuche, eine pan-indianische Allianz zu schmieden, Bekanntheit erlangt. Aus seiner Perspektive musste jemand wie Plenty Coups als „leichtgläubiger Dummkopf“ und „Kollaborateur“ erscheinen (S. 160).
Lear versucht nachzuweisen, dass Plenty Coups gleichwohl über Mut im Sinne einer aristotelischen Tugend verfügte und argumentiert, dass dessen „[radikale] Hoffnung ein wichtiger Bestandteil solchen Mutes“ (S. 161) war. Diese Darstellung ist in weiten Teilen repetitiv und wirkt mit ihrem Fokus auf die psychologischen Fähigkeiten von Plenty Coups reduktionistisch. Noch verfehlter erscheint jedoch das Bild, das Lear von Sitting Bull und damit für die Sioux und all jene Stämme zeichnet, die sich gegen ‚die Weißen‘ zur Wehr setzten. Während Plenty Coups als jemand präsentiert wird, dem es gelungen sei, „die Wirklichkeit zutreffend zu erfassen“ (das heißt die „unvermeidliche Verwüstung“ durch „gewaltige Mächte“ anzuerkennen) und deshalb „richtig auf sie zu reagieren“ (das heißt mutig „von anderen zu lernen“) (S. 190 ff.), wird Sitting Bull als weltfremd und rückwärtsgewandt dargestellt. Den Geistertanz, an dessen Verbreitung jener einen wesentlichen Anteil hatte und der in Erwartung eines kommenden Messias „dabei helfen sollte, die Apokalypse“ und damit die Vernichtung ‚der Weißen‘ „einzuleiten“ (S. 216), deutet Lear als den Versuch, „die Welt auf magische Weise“ zu verändern und „den Anforderungen des echten Lebens aus dem Weg zu gehen“ (S. 217 f.).
In dieser Argumentation irritieren nicht nur Lears Formulierungen von „der“ Wirklichkeit und dem „echten“ Leben, mit denen er die Deutungsoffenheit des Sozialen ausklammert. Befremdlich ist auch, dass er die Wirkung, die der Geistertanz auf die US-Obrigkeit hatte, klein redet (S. 216). Denn die war vom aufwieglerischen Potenzial des Tanzes so beunruhigt, dass sie aktiv versuchte, ihn zu unterbinden.[2] Gänzlich unverständlich ist, dass Lear in dem Anliegen Sitting Bulls, über eine messianische Religion eine pan-indianische Gemeinschaft zu schaffen, nicht mehr erkennt als den erfolglosen Versuch „die traditionelle Lebensweise der Sioux aufrechtzuerhalten“ (S. 219). Denn mit Lears theoretischer Brille könnte man im Bestreben, Elemente der traditionellen Identität der Sioux zu bewahren, indem sie in den noch unscharfen Rahmen einer pan-indianischen Gemeinschaft überführt werden, auch radikale Hoffnung erkennen. Oder ist die Vorstellung einer solchen zukünftigen Gemeinschaft zu konkret, um als radikale Hoffnung zu gelten?
Soziologische Fragen und Erweiterungen
Insgesamt fällt der Eindruck, den das Buch von Lear hinterlässt, ambivalent aus. Nach einem packenden Auftakt und lesenswerten theoretischen – insbesondere psychologischen –Ausführungen zur radikalen Hoffnung im zweiten Teil, endet das Buch mit einer wenig überzeugenden normativen Rechtfertigung des Verhaltens der Crow im Angesicht der Bedrohung. Gleichwohl ist das Buch unbedingt lesenswert und es sind gerade seine Schwächen, die eine Reihe von soziologischen Fragen aufwerfen und zum Weiterdenken anregen.
So drängt sich in vielen Teilen des Buches der Eindruck auf, dass eine figurationssoziologische Perspektive, welche die Beziehungs- und Machtkonstellationen stärker berücksichtigt und diese mit den jeweils spezifischen Hoffnungsvorstellungen und damit verbundenen Praktiken verbindet, ein anderes Licht auf die Sachverhalte werfen könnte. Den Crow als vergleichsweise kleinem und wiederholt von der Auslöschung durch seine traditionellen Feinde bedrohtem Stamm (S. 50) konnte ein Bündnis mit der US-Regierung gleichermaßen notwendig wie attraktiv erscheinen. Aus einer solchen Perspektive wäre es indes (auch) plausibel, den Traum von Plenty Coups als eine pro- und retrospektive Rechtfertigung des Bündnisses mit ‚dem weißen Mann‘ zu deuten. Sitting Bull hingegen war es möglicherweise nur deshalb möglich, die damals noch gänzlich neue Idee einer pan-indianischen Allianz zu entwickeln, weil er der Vertreter eines mächtigen Stammes war und einen dementsprechenden Einfluss geltend machen konnte.
Darüber hinaus regt das Buch allgemeine gesellschaftstheoretische Fragen an: Was macht eigentlich eine Gesellschaft oder eine Kultur aus? Wann ist es angebracht von kultureller Zerstörung zu sprechen? Mit der traditionellen Lebensweise der Crow hat Lear eine Sozial- und Kulturform beschrieben, die hochgradig integriert war und die, ebenso wie die der anderen indianischen Stämme, mit dem Ansturm ‚der Weißen‘ zweifelsohne zerstört wurde. Wenn Lear aber darauf hinweist, dass auch „unsere Lebensweise […] auf viele Arten verletzlich“ (S. 26) ist, so stellt sich die Frage, ob auch wir Verletzungen erleiden können, deren Folgen so fundamental und umfassend sind, dass sie ‚unsere‘ Lebensweise in Gänze – oder zumindest in (wichtigen) Teilen – bedrohen. Was könnten entsprechende Anlässe sein? Das Ende der DDR? Die Corona-Pandemie? Der Klimawandel? Solche und andere Veränderungen stellen sicher – in mal mehr, mal weniger großem Maße – bislang selbstverständliche Lebensweisen und Bedeutungen infrage und radikale Hoffnung auf ein kommendes, bisher noch unbekanntes Gutes kann zweifelsohne dabei helfen, einen Umgang mit ihnen zu finden. Soll radikale Hoffnung aber nicht bloßer „im Wunschdenken verhaftete[r] Optimismus“ (S. 172) sein, scheint es doch notwendig, sie mit einer Kritik an den jeweils vorliegenden sozialen Verhältnissen zu verbinden.
Eine andere Frage betrifft die Bindungskraft radikaler Hoffnung. Als Ethik ist sie nach Lear „dem Gedanken verpflichtet“, „dass etwas Gutes entstehen“ wird (S. 153). Doch was ist die Quelle eines solchen Verpflichtungsgefühls? Im Fall der Crow ist es der Glaube an einen transzendenten Gott. Dieser Glaube habe den Crow die Kraft gegeben, sie aber auch dazu verpflichtet, anzunehmen, „dass etwas Gutes hervortreten wird“ (S. 146). Was könnten gleichermaßen bindende, zugleich aber nicht-religiöse Quellen einer moralischen Verpflichtung, an das Gute zu glauben, sein? Ist im Glauben an das kommende Gute überhaupt der Umweg über eine vor allem als Pflicht verstandene Ethik notwendig? Sind hier vielleicht Konzeptionen angebrachter, die den attraktiven Charakter von Moral vor ihrem verpflichtenden betonen?[3]
Nicht zuletzt wäre es sinnvoll, Lears These der radikalen Hoffnung und den von ihm untersuchten historischen Zusammenhang mit anderen Studien, die Hoffnung thematisieren, zu vergleichen.[4] So wird etwa in der Forschung zu sozialen Bewegungen Hoffnung regelmäßig als ein wichtiges motivierendes und stabilisierendes Element von kollektivem Protest ausgemacht, obwohl sie in bestimmten Kontexten auch lähmen und Widerstand unterbinden kann.[5] In welchem Verhältnis also stehen radikale Hoffnung und Hoffnung auf Überleben, Befreiung, Zugehörigkeit oder sozialen Aufstieg? Inwiefern sind radikale Hoffnung auf ein kommendes, noch unbekanntes Gutes und Kritik an gegenwärtigen Verhältnissen vereinbar? Die Suche nach Antworten auf solche Fragen könnte dabei helfen, das Konzept radikaler Hoffnung weiter zu schärfen und seine Tragfähigkeit für gegenwärtige Kontexte zu eruieren.
Fußnoten
- Siehe einführend zum Problem des Fremdverstehens Jan Kruse, Qualitative Interviewforschung, Weinheim 2015, Kap. I.4.1.
- Jason Frank, Collective Actors, Common Desires, in: Political Research Quarterly 68 (2015), 3, S. 639.
- Hans Joas, Die Entstehung der Werte, Frankfurt am Main 1997, S. 254.
- Einen kurzen Überblick gibt Sarah Amsler, Hope, in George Ritzer (Ed.), Blackwell Encyclopedia of Sociology Online.
- Siehe Sylvia Terpe, Negative Hopes: Social Dynamics of Isolating and Passive Forms of Hope, in: Sociological Research Online 21 (2016), 1.
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Hannah Schmidt-Ott.
Kategorien: Anthropologie / Ethnologie Kultur Psychologie / Psychoanalyse
Zur PDF-Datei dieses Artikels im Social Science Open Access Repository (SSOAR) der GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gelangen Sie hier.
Empfehlungen
„Das sind Flecken“
Rezension zu „Der Rorschach-Test reist um die Welt. Globalgeschichten aus der Ethnopsychoanalyse“ von Hubertus Büschel
Caroline Neubaur, Hannah Schmidt-Ott
Was macht Spaß beim Rezensieren?
Episode 23 des Mittelweg 36-Podcasts
„Beschreiben, was uns modern macht“
Drei Fragen zum Werk von Bruno Latour
