Yvonne Albrecht | Rezension | 27.01.2022
Institutionen in Bewegung?
Rezension zu „Umkämpfte Vielfalt. Affektive Dynamiken institutioneller Diversifizierung“ von Hansjörg Dilger und Matthias Warstat (Hg.)
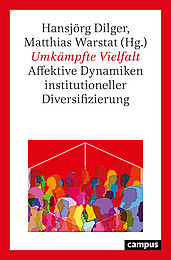
Neo-institutionalistische Ansätze postulieren, dass Institutionalisierungsprozesse vor allem durch normative, kognitive und regulative Vorgänge zu erklären sind.[1] Demnach versuchen sich zum Beispiel Organisationen dadurch zu legitimieren, dass sie Strukturen ausbilden, die in ihrem Umfeld als effizient und rational gelten.[2] Kritiker*innen der neo-institutionalistischen Perspektive bemängeln unter anderem die analytische Vernachlässigung emotionaler Komponenten. Emotionssoziologische Erkenntnisse, so Konstanze Senge,[3] könnten zeigen, aus welchen Gründen sich Akteur*innen für den Erhalt oder die Veränderung von Institutionen einsetzen.
Unter dem Titel Umkämpfte Vielfalt. Affektive Dynamiken institutioneller Diversifizierung haben Hansjörg Dilger und Matthias Warstat (Freie Universität Berlin) nun einen Essayband herausgegeben, der die Bedeutung von Affektivität im Kontext von Institutionen fokussiert, indem er affektive Dynamiken in und um Institutionen untersucht.[4] Konkret beschäftigen sich die Beiträge zudem mit einem Thema, das Institutionen vielfach vor Herausforderungen stellt: migrationsbezogene Diversifizierungsprozesse.[5] Der Band will beleuchten, wie Konflikte und Kämpfe um „kulturelle Vielfalt“ – so die in einigen Beiträgen genutzte Bezeichnung für migrationsbezogene Diversität – Institutionen in Deutschland verändern und affektiv prägen. Herausgebern wie Autor*innen geht es um sogenannte Kulturen der Reibung, also um Formen des Zusammenlebens und -arbeitens, in welchen die Einzelnen Pluralität grundsätzlich anerkennen und begrüßen sowie die mit ihr einhergehenden Konflikte austragen.[6] Die Analyse der affektiven Dynamiken, die bei solchen Reibungen entstehen, kann nach Aussage der Herausgeber zu einem besseren Verständnis von Diversifizierungsprozessen beitragen und aufzeigen, inwiefern diese Prozesse Potenziale, aber auch Probleme für Institutionen darstellen. Denn – darüber herrscht im sozialwissenschaftlichen Kanon weitgehend Einigung – Institutionen charakterisiert gemeinhin ein starkes Beharrungsvermögen (inertia),[7] das Veränderungen, etwa im Zusammenhang mit Diversität, eher entgegensteht. Gerade die institutionelle Umsetzung von Vielfalt ist jedoch eine wesentliche Voraussetzung für die Transformation der Gesellschaft in Richtung mehr Pluralität, Partizipation und Repräsentation.
Insbesondere Unternehmen verstehen Diversität mittlerweile als wichtigen Erfolgsfaktor, was sich zum Beispiel an den einhelligen Forderungen der Charta der Vielfalt – einer Arbeitgeber*inneninitiative zur Förderung von Vielfalt in Unternehmen – zeigt: Hier wird Vielfalt als notwendig dargestellt, um erfolgreich zu sein. Damit ist Diversität eigentlich zu einem übergreifenden Leitprinzip institutioneller Transformation und zu einer Voraussetzung für die Legitimität von Institutionen geworden – ein Umstand, der aus Perspektive neo-institutionalistischer Ansätze zu institutioneller Anpassung führen müsste. Und dennoch geschieht dies oftmals nicht: Obwohl Organisationen und Unternehmen Diversität in ihrer Außendarstellung als relevant bezeichnen und ausgefeilte diversity policies formulieren, laufen Versuche zur dauerhaften Implementierung von Diversität oftmals ins Leere. Die Beteiligten machen dabei häufig die Erfahrung, immer wieder mit dem Kopf gegen eine „brick wall“[8] zu rennen – so der unter anderem von Sara Ahmed verwendete Begriff zur Beschreibung schwer- bis unveränderlicher Strukturen in Institutionen. Die Persistenz solcher ‚institutioneller Backsteinmauern‘ lassen sich mit neo-institutionalistischen Ansätzen allein nicht erklären. Die Fokussierung auf affektive Dynamiken kann wertvolle ergänzende Erkenntnisse liefern – im Hinblick auf Blockaden, aber auch auf Veränderungen.
Insofern werfen die Beiträge des Bandes wichtige Fragen auf: Welche affektiven Arrangements fördern Diversität in Institutionen?[9] Und umgekehrt: Welche Konflikte und Affizierungen – im Sinne von reziproken Machtgeschehen – stehen weiteren Öffnungen entgegen? Der im Kontext des DFG-Sonderforschungsbereichs „Affective Societies“ entstandene Band verwendet einen breiten Institutionenbegriff: Im Fokus der 13 Beiträge stehen sowohl konkrete Organisationen und Einrichtungen wie das Berliner Humboldt Forum (Beitrag von Ivanov/Bens) oder die Kinder- und Jugendhilfe (Beitrag von Röttger-Rössler/Nguyen) als auch sogenannte Leitideen wie Religion (Beitrag von Mattes/Kasmani/Dilger) und Literatur (Beitrag von Fleig), die sich gesellschaftlich etabliert haben und hier ebenfalls unter dem Begriff der „Institution“ gefasst werden.[10]
Das Ziel, Affektivität, Diversität und Institution aus interdisziplinärer Perspektive zusammenzubringen, ist ein überaus interessantes und durchaus auch voraussetzungsvolles Unterfangen. So gehen die Beiträge des vorliegenden Bandes mehr oder weniger konsequent mit diesem Dreiklang um: Manchen hätte ein stärkerer Fokus auf affektiven Dynamiken gutgetan, andere hätten sich stärker auf die breite Institutionendefinition beziehen können, die Dilger und Warstat in der Einleitung entfalten. Drei Beiträge sind in der Weise, wie sie Affektivität, Diversität und Institution miteinander verknüpfen, hervorzuheben und werden daher im Folgenden ausführlicher besprochen:
1. Der Beitrag von Margreth Lünenborg und Débora Medeiros, „Redaktionen dekolonisieren! Journalismus für die Einwanderungsgesellschaft“, beschreibt in eindrücklicher Weise die Versäumnisse der deutschen Medienlandschaft in Bezug auf migrantische Diversität. So sollten zum Beispiel 2020 in der Talkshow „Maischberger“ vier weiße Personen über das Thema „Rassistische Gewalt in den USA“ diskutieren. Die Diagnose der Autorinnen: „Professionelle Kriterien des Gatekeeping, der Selektion von Themen und Expert*innen im Journalismus, [sic] führen in Deutschland zum Ausschluss Schwarzer Menschen aus der öffentlichen Diskussion.“ (S. 95) Die Debatte um migrantische Diversität setze die Institution Journalismus in Deutschland zunehmend unter affektive Spannung. „Redaktionen, die noch immer überwiegend weiß, männlich, akademisch und aus der Mittelschicht besetzt sind, stehen unter Druck.“ (S. 96) Denn als Konsequenz dieser Zusammensetzung – nur 4 bis 5 Prozent der Belegschaften in Redaktionen haben eine Migrationsbiografie[11] – reproduziert die Berichterstattung vielfach die Stereotype und Emotionen der Mehrheitsgesellschaft. Dies führt bei Menschen mit Migrationsgeschichte häufig zu Wut und Enttäuschung. Damit enttarnen Lünenborg und Médeiros den vermeintlich objektiv-rationalen Journalismus als durchaus affektive Institution und legen so den Bias von Themen und Darstellungen offen.
2. Unter dem Titel „Feeling Awareness: Affektive Dynamiken in der rassismuskritischen (Weiter-)Bildung“ fragen Nadine Maser und Nina Sökefeld in ihrem Beitrag, welcher Stellenwert Affekten und Emotionen bei der Vermittlung von Awareness zur Bekämpfung von rassistischer Diskriminierung zukommt. Anhand von Textmaterial aus rassismuskritischen Bildungsangeboten zeigen die Autorinnen, dass die Entwicklung eines machtkritischen Bewusstseins ein affektiver Prozess ist, der eine reflexive Auseinandersetzung mit den eigenen Emotionen erfordert. Rassismuskritische Seminare in Institutionen können das dortige Bewusstsein für Diskriminierung schärfen, sodass sich Awareness langfristig institutionalisiert. Weiterführend interessant wären neben der Auswertung von Textmaterial auch teilnehmende Beobachtungen gewesen: Die Analyse von beobachteten affektiven Dynamiken und Spannungen könnte überaus aufschlussreich sein im Hinblick auf Widerstände und Abwehr im Umgang mit Rassismus.
3. Ebenfalls überaus lesenswert ist der Beitrag von Gülay Çağlar und Jennifer Chan de Avila, welcher sich die Institution Universität und ihre „Schattenseiten“ im Umgang mit Diversität vornimmt – also jene Aspekte von Diversitätspolitik, die tiefes Unbehagen verursachen, weshalb sie die beteiligten Akteur*innen eher verdrängen (müssen). Çağlar und Chan de Avila fragen unter dieser Prämisse nach ausgesparten Themen und verpufften institutionellen Ansätzen. Antworten suchen sie in den Internetauftritten, Leitbildern und online verfügbaren Dokumenten von 22 deutschen Universitäten, die sie analysiert haben. Darüber hinaus führten sie qualitative Interviews und arbeiteten mit Fokusgruppen. Ihr Aufsatz macht empirisch fundiert und eindrücklich deutlich, dass die Institutionalisierung von Diversität auch im universitären Kontext ein stark umkämpfter affektiver Prozess ist, bei dem es immer um den Umgang mit Kategorien geht.
Der insgesamt sehr relevante, interessante und lesenswerte Band ist im Kontext von aktuellen Debatten zur Emotionalität/Affektivität in Institutionen anzusiedeln, welche im wissenschaftlichen Diskurs immer wieder kurzzeitig präsent sind, um dann doch wieder in den Hintergrund zu geraten. Die Beiträge zeigen facettenreich die analytischen Möglichkeiten einer stärkeren Fokussierung auf affektive Dynamiken in Institutionen auf. Es wäre jedoch wünschenswert, dass künftige Forschungen noch systematischer vergleichend arbeiten – also beispielsweise die Merkmale affektiver Dynamiken in unterschiedlichen Institutionen vergleichen, um Probleme und Erfolge auf der Mesoebene zu identifizieren. Nur so sind eindeutige und verallgemeinerbare Aussagen darüber möglich, wie affektive Dynamiken die Institutionalisierung von Diversität strukturell fördern oder hemmen.
Weiterhin wären Einblicke in die inoffizielle, die verborgene Seite von Institutionen interessant: Welche Akteur*innen sagen was hinter vorgehaltener Hand? Auf welche affektiven Widerstände oder Ängste verweisen Blockadehaltungen von Mitgliedern oder Mitarbeitenden? Woran zeigt sich ein affektives Machtgeschehen in Institutionen und wie nutzen es die jeweiligen Akteur*innen, um Anliegen abzuwehren oder zu pushen? Solche Studien, die eher ethnografisch angelegt sein müssten, könnten das neo-institutionalistische Paradigma sinnvoll ergänzen, da sie in der Lage wären, zu erfassen, was unter der Oberfläche geschieht. Dazu erscheint das Konzept „affektiver Dynamiken“ überaus geeignet. Sein Mehrwert ist allerdings in weiterführenden Untersuchungen noch stärker herauszuarbeiten, die sich zu diesem Zweck noch konsequenter auf Dynamiken fokussieren müssten – auch unter Berücksichtigung von oder in Abgrenzung zu zum Beispiel organisationssoziologischen Studien, die sich mit eher statischen institutionalisierten feeling rules[12] befassen. Dann kann die Analyse affektiver Dynamiken in Institutionen einen wertvollen Beitrag zu einem der aktuellen Anliegen neo-institutionalistischer Studien leisten: zur Erklärung von institutionellem Wandel – oder aus welchen Gründen dieser eben nicht erfolgt.
Fußnoten
- Vgl. W.E. Douglas Creed / Bryant Ashley Hudson / Gerardo A. Okhuysen / Kristin Smith-Crowe, Swimming in the Sea of Shame. Incorporating Emotion into Explanations of Institutional Reproduction and Change, in: Academy of Management Review 39 (2014), 3, S. 275–301; vgl. Melissa Wooten / Andrew J. Hoffman, Organizational Fields. Past, Present and Future, in: Oliver Greenwood (Hg.), The Sage Handbook of Organizational Institutionalism, Thousand Oaks, CA 2008, S. 131–147.
- Dadurch kommt es häufig zu einer Isomorphie, also Gleichgestaltigkeit, von Organisationen, die überaus beständig ist. Dazu einschlägig Paul J. DiMaggio / Walter W. Powell, The Iron Cage Revisited. Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields, in: American Sociological Review 48 (1983), 2, S. 147–160.
- Vgl. Konstanze Senge, Die emotionale Säule von Institutionen. Entwicklungen, Potentiale und Probleme einer neo-institutionalistischen Deutung von Emotionen, in: Maja Apelt / Uwe Wilkesmann (Hg.), Zur Zukunft der Organisationssoziologie, Wiesbaden 2015, S. 205–225, insbes. S. 208. Siehe außerdem Stephen Fineman, Emotions in Organizations, London 1993; Barbara Sieben / Åsa Wettergren, Emotionalizing Organizations and Organizing Emotions – Our Research Agenda, in: dies. (Hg.), Emotionalizing Organizations and Organizing Emotions, Basingstoke 2010, S. 1–21.
- Hierzu einschlägig Robert Seyfert, Das Leben der Institutionen. Zu einer allgemeinen Theorie der Institutionalisierung, Weilerswist 2011.
- Vgl. zu diesen Herausforderungen z.B. in zivilgesellschaftlichen Organisationen Serhat Karakayalı / Yvonne Albrecht, Vielfalt als Herausforderung organisationaler Einheit? Konflikte um die Repräsentation von Migration [29.11.2021], in: Birgit Blättel-Mink (Hg.), Gesellschaft unter Spannung. Verhandlungen des 40. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie 2020. Vgl. auch Hella Unger / Helen Baykara-Krumme / Serhat Karakayali / Karen Schönwälder (Hg.), Organisationaler Wandel durch Migration? Zur Diversität in der Zivilgesellschaft, Bielefeld (im Erscheinen).
- Vgl. die konzeptionellen Bezüge zu Naika Foroutan, Die postmigrantische Gesellschaft. Ein Versprechen der pluralen Demokratie, Bielefeld 2019.
- Vgl. z.B. Kevin Stainback / Donald Tomaskovic-Devey / Sheryl Skaggs, Organizational Approaches to Inequality. Inertia, Relative Power, and Environments, in: Annual Review Sociology 36 (2010), S. 225–247.
- Vgl. Sara Ahmed, On Being Included. Racism and Diversity in Institutional Life, Durham, NC 2021.
- Vgl. Jan Slaby / Rainer Mühlhoff / Philipp Wüschner, Affective Arrangements, in: Emotion Review 11 (2017), 1, S. 3–12.
- Um die Begriffe „Institution“ und „Organisation“ existieren bereits breite Debatten, die auch der vorliegende Sammelband stärker rezipieren müsste.
- Vgl. Horst Pöttker / Christina Kiesewetter / Juliana Lohfink (Hg.), Migranten als Journalisten? Eine Studie zu Berufsperspektiven in der Einwanderungsgesellschaft, Wiesbaden 2016.
- Vgl. Maxim Voronow / Russ Vince, Integrating Emotions into the Analysis of Institutional Work, in: Academy of Management Review 37 (2012), 1, S. 58–81; vgl. Arlie Russell Hochschild, Das gekaufte Herz. Die Kommerzialisierung der Gefühle, übers. von Ernst von Kardorff, mit einem aktuellen Vorw. von Arlie Russell Hochschild und einer Einl. von Sighard Neckel, Frankfurt am Main / New York 2006.
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Henriette Liebhart.
Kategorien: Affekte / Emotionen Diversity Gruppen / Organisationen / Netzwerke
Zur PDF-Datei dieses Artikels im Social Science Open Access Repository (SSOAR) der GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gelangen Sie hier.
Empfehlungen
Wie Gewerkschaften und soziale Bewegungen durch Organizing der Demokratie auf die Sprünge helfen können
Literaturessay zu „People, Power, Change. Organizing for Democratic Renewal“ von Marshall Ganz, „Changemakers. Radical Strategies for Social Movement Organising“ von Jane Holgate und John Page sowie „Undivided. The Quest for Racial Solidarity in an American Church“ von Hahrie Han
„Die Welt ist bunter, als meist angenommen“
Ein Gespräch mit Steffen Mau über Polarisierungsunternehmer, Veränderungserschöpfung und gesellschaftliche Gewöhnungsprozesse
Nachgefragt bei Nina Leonhard
Fünf Fragen zur Studie „Armee in der Demokratie - Ausmaß, Ursachen und Wirkungen von politischem Extremismus in der Bundeswehr“
