Laura Wolters | Rezension | 10.06.2025
Die Rechte als Wohlfühloase
Rezension zu „Die Gefühlsgemeinschaft der AfD. Narrative, Praktiken und Räume zum Wohlfühlen“ von Florian Spissinger
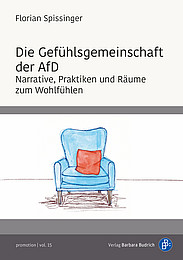
Die politische Rechte im Jahr 2025. Welche Begriffe taugen, um dieses – in Ermangelung eines präziseren Konzepts – globale Phänomen zu beschreiben? Wutbürger? Hassrede? Angstpolitik? Welche Begriffe einem auch am ehesten zusagen, es scheint gesetzt, dass, erstens, das Erstarken der politischen Rechten mit Gefühlen in Verbindung zu bringen ist und, zweitens, diese Gefühle dezidiert negativ sind. Ob es sich dabei in erster Linie um eine dem Gegenstand angemessene Beschreibung handelt oder doch eher um das Grundgefühl der Wissenschaftler:innen gegenüber ihrem als „abstoßend“ (S. 9) empfundenen Forschungsobjekt, das ist eine der Leitfragen, die Florian Spissingers Dissertation Die Gefühlsgemeinschaft der AfD. Narrative, Praktiken und Räume zum Wohlfühlen durchzieht. Spissinger stellt die Prämisse der destruktiven Emotionen in Frage und untersucht stattdessen, wie es dazu kommt, dass eine aktive Beteiligung am rechten Projekt – genauer gesagt an der Parteiarbeit der AfD – sich für ihre „Unterstützer:innen und Sympathisant:innen richtig, wichtig und gut anfühlt“ (ebd.). Das zu lösende Rätsel ist mithin nicht mehr die Frage, warum es Menschen in den Schoß der rechten Parteien zieht; wenn es sich explizit gut anfühlt, dort zu verweilen, liegt die Antwort ja bereits auf der Hand. Die Frage ist vielmehr, wie dieses Wohlgefühl entsteht.
Spissingers Frage ist, um das gleich vorwegzunehmen, eine extrem gute – und sie zielt mitten ins Herz der zeitgenössischen Rechtspopulismusforschung, die bei aller Aktivität in den letzten Jahren noch immer einigermaßen fassungslos vor der scheinbar unaufhaltsamen und nur schwer erklärlichen Anziehungskraft rechter Bewegungen steht. Um sie zu beantworten, bedient sich der Autor eines „affektsensiblen Instrumentariums“ (S. 34) und der politischen Ethnografie. Seine Einsichten gewinnt Spissinger aus einer „Form von Konzeptarbeit, die in dichten Beschreibungen fundiert ist […] [a]nstatt von eingeschliffenen Denkfiguren, Begriffen und Theorien auszugehen“ (S. 37). Sie trage durch „Sensibilität für lokale Kontexte und alltägliche Interaktionen“ dazu bei, „das bestehende wissenschaftliche Wissen durch mikroskopische Evidenzen zu verfeinern, zu verkomplizieren, Dinge neu zu sehen sowie Neues zu entdecken“ (ebd.). Die lokalen Kontexte, die in der Arbeit berücksichtigt werden, sind zwei AfD-Regionalverbände, die Spissinger im Jahr 2019 über mehrere Monate beobachtet hat – einer in Ostdeutschland in einer von Strukturwandel geprägten Region nahe der Lausitz, der andere irgendwo in Süddeutschland im Herzen der Automobilindustrie. Die Akteur:innen, die damit in den Blick genommen werden, sind jene der zweiten oder dritten Reihe, beispielsweise Lokalpolitiker:innen und vor Ort engagierte Unterstützer:innen.
Die Monografie ist in drei Teile gegliedert, die entlang von Narrativen, Praktiken und Räumen ausleuchten, wie eine in sich stimmige neurechte Gefühlswelt entsteht und ihren Anhänger:innen ein attraktives Identitätsangebot mit positiven Emotionen unterbreitet. Im ersten Teil rekonstruiert Spissinger anhand von apokalyptischen Zukunftserzählungen innerhalb der neuen Rechten, wie sich aus einem Bedrohungsszenario eine attraktive Gefühlsposition als Widerständige erschaffen lässt. Anhand der wohlbekannten rechten Narrative vom „großen Austausch“ und einem durch Klimaschutz und Energiewende herbeigeführten, landesweiten „Blackout“ zeichnet der Autor nach, wie Verschwörungserzählungen von den Akteur:innen durch alltägliches Erleben „verwahrheitet“ (S. 58) werden. Jede migrantisch gelesene Person in der Fußgängerzone, jedes Windrad in der Landschaft könne zum erlebbaren Beweis des „nationalen Niedergangs“ (S. 66) werden. Auf diese Weise, so Spissingers Schluss, verfestige sich schließlich ein manifestes Zukunftswissen innerhalb der Bewegung. Dieses Untergangswissen erzeuge in den Akteur:innen aber gerade kein Gefühl von Angst, Verzweiflung oder Resignation, sondern erlaube es ihnen vielmehr, sich als Teil einer Widerstandsbewegung wahrzunehmen, die heroisch agiert und auf eine Verhinderung des Niedergangs und eine positive Zukunftsgestaltung hoffen lässt.
Im zweiten Teil legt Spissinger dar, wie die neurechte Gefühlsgemeinschaft ihre Widerstandserzählung durch die Vorstellung von aktiver Unterdrückung durch den vermeintlich totalitären Mainstream anreichert. Seine Gesprächspartner:innen, Aktive und Unterstützer:innen der jeweiligen AfD-Verbände, zeigten nicht nur ein verfestigtes Zukunftswissen, sie erlebten sich auch, erstens, als die Einzigen, die dazu in der Lage seien, das Offensichtliche und die Wahrheit zu erkennen, während der Rest der Gesellschaft einer ideologisch-verblendeten Leugnung verfalle; auch mache ihr „Wahrsprechen“ sie, zweitens, für den ideologisierten Mainstream zu einer Gefahr, die mit undemokratischen und totalitären Mitteln unter Kontrolle gebracht werden müsse. In der Konsequenz immunisiere sich die neurechte Gefühlsgemeinschaft vollständig gegen den Vorwurf des Rechtsextremismus: Wer sich als unterdrückter Widerstandskämpfer und Aufklärerin gegen den Totalitarismus versteht, wird Kritik der Gegenseite nicht reflektieren, sondern schlicht als Bestätigung des eigenen Wissens und „Selbstnarrativs“ (S. 129) verstehen. Der Vorwurf, antidemokratisch zu agieren, werde damit von der neurechten Gefühlsgemeinschaft erfolgreich ins Gegenteil verkehrt: Sie selbst verstünden sich als unterdrückter Widerstand, während die „Altparteien“ und die Antifa nicht weniger seien als die neue NSDAP. Diese Mischung aus epistemischer Selbstüberhöhung und Selbstviktimisierung verdichtet Spissinger schließlich zu einer an Arlie Hochschilds Vorgehen angelehnten „Tiefengeschichte von antitotalitärer Aufklärung“ (S. 173), die als erlebte Wahrheit der neurechten Gefühlsgemeinschaft zugrunde liege.
Im dritten Teil schließlich nimmt der Autor anhand von vier mikropolitischen Studien konkrete Räume (Wahlkampfstand, Stammtisch) und Praktiken (Performanz von Sachlichkeit, Schimpfen, Spott und Gelächter) in den Blick. Er zeichnet nach, wie sich die neurechte Gefühlswelt „jenseits negativer Emotionen“ (S. 193) konstituiert und in „Identitäts- und Gefühlstrainings“ (S. 223) verfestigt. Diese tieferen empirischen Einblicke sind deshalb besonders aufschlussreich, weil sie zeigen, wie sich neurechte Narrative in bestimmten sozialen Räumen in Praktiken und Routinen übersetzen, die affektiv wirkmächtig werden. Sie demonstrieren auch, dass die rechte Gefühlswelt nicht auf der emotionalen Verführung einer unbedarften Menschenmenge durch charismatische Anführer aufbaut, sondern auf einer Art Bottom-up-Gefühlsarbeit mit dem Ziel affektiver Vergemeinschaftung. Spricht Spissinger von neurechten Identitäts- und Gefühlstrainings, so hat er auch nicht die Manipulation von Emotionen durch neurechte „Trainer“ beziehungsweise Anführer im Sinn, sondern meint das gemeinsame Entdecken und Einüben erstrebenswerter Gefühle und affektiver Praktiken, etwa im gemeinsamen Schimpfen auf oder Spotten über die gegnerische Seite.
Insgesamt ist Die Gefühlsgemeinschaft der AfD eine äußerst spannende, erhellende und darüber hinaus wirklich gut zu lesende Lektüre, die ihre gewonnenen Erkenntnisse überzeugend argumentiert und mit reichhaltiger Empirie untermauert. Für den Autor lässt sich die neurechte Gefühlswelt, die es Akteur:innen ermöglicht, sich in rechten Räumen wohlzufühlen, in vier „affektiven Wirkmechanismen“ (S. 253) zusammenfassen: Die neue Rechte verspreche über ihr ideologisches Angebot hinaus auch eine affektive Heimat (1), deren Gefühlswelt den Beteiligten „affektiven Auftrieb“ und ein attraktives Identitätsangebot unterbreite (2); sie vermittle zudem ein besonderes Gefühl von Befreiung (3) und entlaste von äußerer Kritik und Selbstzweifeln (4).
Dass diese Erkenntnisse auch im Jahr 2025 noch zu überzeugen vermögen, ist dabei nicht selbstverständlich, stellt eine derart kleinteilige und dichte Untersuchung an einem moving target wie der politischen Rechten doch ein gewisses Risiko dar. Man denke allein an die Transformationen und Erfolge, die die Bewegung seit Spissingers Feldforschung angesichts der Covid-19-Pandemie und des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine durchlaufen hat. Spissinger jedoch kann in kurzen Exkursen überzeugend darstellen, dass sich Inhalte und Narrative zwar wandeln mögen, die affektiven Wirkmechanismen und neurechten Tiefengeschichten sich aber dennoch kaum verändern beziehungsweise sich noch verstärken. Nicht nur das macht die Studie zu einem handwerklich wie methodisch guten Forschungsbeitrag, der klug und bedacht mit dem Forschungsstand und der Theorie umgeht. Spissinger verweist stets respektvoll aber in der Sache unnachgiebig auf die Schwachstellen der bisherigen Forschung. Der Autor praktiziert Theoretisieren im besten Sinne und verknüpft seine theoretischen Überlegungen gekonnt mit der Darstellung und Reflexion seines empirischen Materials.
An zu äußernder Kritik bleibt lediglich das, was ausnahmslos jedem guten Buch angekreidet werden kann: kleinere Ungenauigkeiten, über die man beim Lesen stolpert, und ein unvermeidliches – wie unfaires – „Was man sonst noch hätte machen können“.
Spissinger legt im Verlauf seiner Argumentation großen Wert darauf, sich von den „eingeschliffenen Denkfiguren“ (S. 189) der bisherigen Forschung loszusagen. Das ist zwar durchaus überzeugend, häufig werden die so benannten Gegner:innen jedoch recht oberflächlich in ein paar einleitenden, allgemeinen Sätzen abgehandelt. An manchen Stellen hätte man sich als Leserin darüber gefreut, etwas mehr über jene Argumente und Empirie zu erfahren, die Spissingers Thesen scheinbar entgegenstehen, etwa warum andere Autor:innen von dezidiert negativen Gefühlswelten in der Rechten ausgehen (etwa S. 29 f., S. 47 ff., S. 189 ff.). So verkommt die Gegenperspektive in manchen Kapiteln zu einem Pappkameraden, der scheinbar vor allem Relevanz herstellen soll, argumentativ aber nicht wirklich tief geht.
In anderer Richtung wundert man sich zuweilen, warum der Autor sich in seinen affekt- beziehungsweise emotionstheoretischen Konzepten nicht stärker auf Theorien einlässt, die nicht schon am Gegenstand der politischen Rechten entwickelt wurden. Gerade eine Forschung im Modus des Entdeckens, wie Spissinger sie betreibt, würde gewiss davon profitieren. Es ist selbstverständlich sinnvoll, sich am Forschungsstand zu orientieren, und der Autor macht auch keinen Hehl daraus, dass er kein ontologisches, emotionstheoretisches Erkenntnissinteresse verfolgt (S. 34 f). Gleichwohl birgt das Argument von affektiven Wirkmechanismen mehr sozialtheoretisches Potenzial, als nur konkrete neurechte Gefühlswelten zu beschreiben. Als Leserin wünscht man sich an so mancher Stelle der Lektüre mehr Mut, vielleicht gar mehr Unverfrorenheit des Autors, auch über die Wirkmechanismen anderer politischer Bewegungen mit gegenteiligen Anliegen zu sinnieren: Haben Spott und Häme bei der CSU eine ähnliche Bedeutung wie bei der neuen Rechten? Versteht sich Extinction Rebellion auch als widerständige Aufklärungsgemeinschaft? Wieviel Wert legt die FDP auf die Performanz von Sachkompetenz? In aller Fairness: Das kann man Spissingers Arbeit nicht ernstlich vorwerfen. Letztere hat selbstverständlich ihr eigenes Anliegen bearbeitet und nicht noch all jene, die neugierigen Leser:innen bei der Lektüre in den Sinn kommen.
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Stephanie Kappacher.
Kategorien: Affekte / Emotionen Demokratie Gruppen / Organisationen / Netzwerke Rassismus / Diskriminierung
Zur PDF-Datei dieses Artikels im Social Science Open Access Repository (SSOAR) der GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gelangen Sie hier.
Empfehlungen
Radikale Volksherrschaft
Rezension zu „Risiko-Demokratie. Chemnitz zwischen rechtsradikalem Brennpunkt und europäischer Kulturhauptstadt“ von Jenni Brichzin, Henning Laux und Ulf Bohmann
Das Wissen der Marginalisierten
Der Sinn für Ungerechtigkeit und die soziale Standpunkttheorie
„Das Gleichheitsversprechen der Demokratie läuft empirisch für sehr viele Menschen ins Leere“
Fünf Fragen an Naika Foroutan zum Thema des diesjährigen DGS-Kongresses
