Detlef Siegfried | Rezension | 12.06.2025
Reflexionen in den fiktiven Figuren des Pop
Rezension zu „Neon / Grau“ von Anna Lux und Jonas Brückner
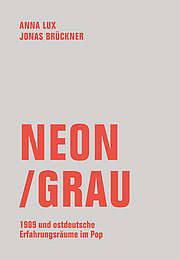
Das Buch Neon / Grau reiht sich ein in die gegenwärtige Flut von Publikationen, die sich mit dem gesellschaftlichen und politischen Bruch in der DDR von 1989 und der Transformation der Folgejahre beschäftigen – aber es ist anders als die anderen. Geschrieben und kompiliert von einer Historikerin und einem Kulturwissenschaftler – beide ostsozialisiert, die sich im Rahmen des an den Universitäten Leipzig und Freiburg angesiedelten interdisziplinären Forschungsverbunds „Das umstrittene Erbe von 1989“ mit dieser Geschichte wissenschaftlich beschäftigen –, ist der Band doch keine wissenschaftliche Abhandlung traditioneller Machart. Ungewöhnlich ist die Perspektive, mit der die Autor:innen ihren Gegenstand betrachten, denn es geht um seine Reflexion in der Popkultur, genauer gesagt: in der populären Geschichtskultur. Ungewöhnlich ist auch die Methode, denn das Buch kombiniert Sachdarstellungen aus der Feder von Lux und Brückner mit Interviews mit Akteuren, die die „große Transformation“ (Philip Ther) in Romanen, Spielfilmen oder Songs verarbeitet oder als Kulturwissenschaftler:innen begleitet haben.
Gegliedert ist der Stoff nicht chronologisch, sondern systematisch. Dadurch gehen zwar Dynamiken innerhalb der hier behandelten 35 Jahre verloren, aber dafür sind die acht intensiver behandelten Tiefenlotungen ergiebig: „1989“ als Erinnerungsort, der durch das rasante Verschwinden der DDR ausgelöste Phantomschmerz, die Utopie eines demokratischen Sozialismus, die Dynamik der „Einheitsfiktion“, die staatliche Einheit als „ethnokulturelles Projekt“, die Jugendkultur, Geschlechterrelationen, die Verhältnisse auf dem Land. Die Kapitel bestehen jeweils aus einer längeren Darstellung zum Thema sowie drei knappen Beiträgen, in denen Künstler:innen Fragen von Lux und Brückner beantworten. Das Ergebnis ist eine Mischung aus wissenschaftlich solide fundierten, aber leicht zugänglichen Sachtexten und individuellen Perspektiven – ein informatives und zugleich kommunikatives Kaleidoskop, das in seiner Heterogenität mit dem popkulturellen Ansatz korrespondiert.
Nicht nur in der Form unterläuft das Buch die Meistererzählung. Inhaltlich steht es dem staatspolitischen Narrativ von geglückter Revolution und erfüllter Einheitssehnsucht ebenso kritisch gegenüber wie einer ungebrochenen Niedergangs- und Verlustgeschichte, wie sie sich oft genug in einer ostdeutschen Selbstwahrnehmung als Underdog materialisiert. Sympathisch ist vielmehr, dass Autorin und Autor, zumal im Wissen um die Langzeitfolgen, die einheitskritischen Stimmen als Kontrapunkt zu den Jubeltönen von Festreden zum 3. Oktober stark machen, ohne ihre Wirkungsmacht zu überschätzen. Warnungen und alternative Ideen hat es durchaus gegeben, nur wurden sie im Einheitsrausch des Jahres 1990 mehrheitlich in den Wind geschlagen. An den Folgen zerschellte der Traum vom Abbau der ‚Mauer in den Köpfen‘.
Ein wesentliches Verdienst dieses ungewöhnlichen Buches besteht darin, die Vielstimmigkeit der Sichtweisen auf den Umbruch in Ostdeutschland en détail herauszuarbeiten, den die geschichtspolitischen Großdeutungen eher verschüttet haben.
Ein wesentliches Verdienst dieses ungewöhnlichen Buches besteht darin, die Vielstimmigkeit der Sichtweisen auf den Umbruch in Ostdeutschland en détail herauszuarbeiten, den die geschichtspolitischen Großdeutungen eher verschüttet haben. Dabei wird auch klar, dass Kategorien wie „Ostdeutschland“ oder „der Osten“, wie sie etwa Dirk Oschmanns auftrumpfende These von der Erfindung des Ostens durch den Westen popularisiert,[1] eine Homogenität suggerieren, die den tatsächlichen Verhältnissen nicht entspricht. Allerdings werden Lux und Brückner nicht immer dem selbstgesetzten Anspruch gerecht, Generalisierungen zu vermeiden. So etwa, wenn sie den „Wendekindern“ attestieren, „auf eine umsichtige Weise den Diskurs über die Umbruchszeit bereichert“ zu haben, „indem sie sich mit den eigenen Erinnerungen und Erfahrungen auseinandersetzten“ und „früh eine selbstgewiss im Sattel sitzende offizielle Erinnerungskultur“ konfrontierten (S. 210). Wirklich? „Die Wendekinder“? Deren Wortmeldungen fallen durchaus unterschiedlich aus. Dass man etwa Anne Rabes Buch Die Möglichkeit von Glück (2023) weder umsichtig noch bereichernd finden muss, demonstriert Regina Scheer, die es im vorliegenden Band ganz zu recht als „platt“ und in der These der Allveranwortlichkeit des DDR-Systems für jegliche Dysfunktionalität im Privatleben als „zu kurz“ gegriffen verabschiedet (S. 98). Aber es stellt sich auch die Frage, wie überraschend der zentrale Befund der Vielstimmigkeit eigentlich ist. Sicherlich, es ist wichtig und originell, Stimmen aus dem Pop – by the way: Inwieweit jede Belletristik als Pop gilt, kann man offenbar unterschiedlich sehen – gegen die dominierenden Deutungen von historischem Glück oder tiefem Elend in Anschlag zu bringen. Aber besonders überraschend ist der Globalbefund, gesellschaftlicher Wandel verlaufe selten ausschließlich progressiv oder regressiv, sondern sei oft von „Gleichzeitigkeit oder Widersprüchen“ (S. 119) gekennzeichnet, wahrlich nicht. Der Gewinn dieses Buches liegt vielmehr in seinem aufmerksamen und detaillierten Blick für diese Widersprüche.
Wirklich interessant wird es immer dann, wenn die hier herausgegriffenen Einzelaspekte in der Tiefe untersucht werden. So im Kapitel über die „Deutsche Einheit“ als „ethnokulturelles Projekt“, das über Beispiele aus Punk und Hip Hop popkulturelle Positionierungen jenseits des völkischen Denkens in Erinnerung ruft und zeigt, dass das Versprechen der deutschen Einheit für migrantische oder jüdische Minderheiten alles andere als eine Verheißung war. Für sie hatte der von einem Teil der ethnisch privilegierten ostdeutschen Mehrheitsgesellschaft geführte Anerkennungskampf – etwa um Arbeitsplätze – „den flächendeckend offen und gewaltvoll zu Tage tretenden Ausschluss“ (S. 149) zur Folge, wie die im Band als externe Stimme vertretene Historikerin Maren Möhring herausarbeitet. Die schon in den „Baseballschlägerjahren“ evidenten Kontinuitäten des Nationalsozialismus, popkulturell nicht selten gedeutet als deutsche Volkskontinuität der gewaltsamen Ausschaltung Nichtdeutscher („80 Millionen Hooligans“ von den Goldenen Zitronen), steigerten sich noch mit den Morden des NSU und der rassistischen Mobilisierung während der sogenannten Flüchtlingskrise nach 2015. Lux und Brückner ergründen die Deutung rassistischer Gewalt im Osten etwa durch eine Analyse des Spielfilms Wir sind jung. Wir sind stark (2015), in dem es um die Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen von 1992 geht. Auch wenn sie in Ostdeutschland weniger stark repräsentiert waren als im Westen, brachten sich auch dort migrantische Stimmen zu Gehör, wie schon früh Angelika Nguyen mit ihren Dokumentarfilm Bruderland ist abgebrannt (1992). Für die zweite Hälfte der 2010er-Jahre konstatieren Autorin und Autor eine verstärkte Thematisierung migrantischer Perspektiven, die die DDR ebenso umfasst wie ihre gesamtdeutsche Nachgeschichte. Diese Entwicklung illustrieren Lux und Brückner am Beispiel zahlreicher Songs und Bücher, intensiver analysiert werden unter anderem der Roman 1000 Serpentinen Angst (2020) von Olivia Wenzel und der Kurzfilm Für immer (2023) von Christian Tung Anh Nopper.
Ein zweites Beispiel für die Ergiebigkeit der thematischen Detailanalysen ist das Kapitel zum ländlichen Raum, das dankenswerterweise die ansonsten dominante Berliner Perspektive etwas relativiert. Dank der im Pop stets auch repräsentierten Stimmen von unten zeigt sich hier die Problematik der „inneren Peripherie“ (Stefan Schmalz u.a.) eindrücklich: wirtschaftlicher Niedergang, Abwanderung junger Frauen und männliche Überzahl, hohe Wahlergebnisse rechter Parteien, Straßendominanz faschistischer Schlägertrupps etc. Aber abseits dieser Klischees treten die Nuancen hervor. Als „verdichtete fiktionale Sozialstudie“ (S. 269) verleiht etwa die Comedyserie Warten auf’n Bus (2020) den Akteuren eine Stimme und damit die Deutungshoheit über ihre Biografie und gegenwärtige Lage, während zugleich anhand der beiden Hauptfiguren die konstitutive Bedeutung sozialer Beziehungen für das Überleben auf dem platten Land herausgearbeitet wird. Die Autor:innen des Bandes sehen die Bushaltestelle als einen „Möglichkeitsort, an dem Dinge entstehen: Kreatives, Reflektiertes, politische Haltung“ (S. 276). Der Song Gehen oder Bleiben (2015) der Band Feine Sahne Fischfilet beantwortet – ähnlich wie der ihrem Sänger gewidmete Spielfilm Wildes Herz (2018) – die Frage ganzer Jugendgenerationen auf dem Land mit einem Plädoyer für die Verteidigung dieses Raums gegen rechte Dominanz.
Anna Lux’ und Jonas Brückners Buch bekräftigt überzeugend seine Ausgangsthese: In den fiktiven Figuren des Pop spiegeln sich „historische Menschen“ (Lion Feuchtwanger) wider – als Parabeln eines ganz bestimmten, milieuhaft gebundenen Zeitgeistes.
Die Perspektive Pop hat den großen Vorteil, Stimmen von unten und von außen explorieren zu können, die oft aus einer sehr persönlichen Sichtweise schöpfen und sich in den generalisierenden politischen Diskursen selten wiederfinden. Anna Lux’ und Jonas Brückners Buch bekräftigt überzeugend seine Ausgangsthese: In den fiktiven Figuren des Pop spiegeln sich „historische Menschen“ (Lion Feuchtwanger) wider – als Parabeln eines ganz bestimmten, milieuhaft gebundenen Zeitgeistes. Nicht immer stehen sie quer zu den Großnarrativen, die in geschichtspolitischer Absicht propagiert werden, aber oftmals eben doch. In diesen Fällen lassen sie sich als Gegenerzählungen lesen, ohne die die ganze Komplexität der historischen Entwicklung nicht zu verstehen ist.
Fußnoten
- Dirk Oschmann, Der Osten. Eine westdeutsche Erfindung, Berlin 2023.
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Henriette Liebhart.
Kategorien: Kunst / Ästhetik Pop Rassismus / Diskriminierung Sozialer Wandel Sozialgeschichte Stadt / Raum
Empfehlungen
Der Schwarze Kontinent
Rezension zu „Afropäisch. Eine Reise durch das schwarze Europa“ von Johny Pitts
