Marie Rosenkranz | Rezension | 07.01.2025
Verlustangst, ästhetisch
Rezension zu „Wut und Wertung. Warum wir über Geschmack streiten“ von Johannes Franzen
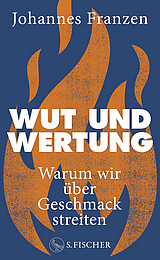
In der Kunst passiert gegenwärtig vor allem eines: es wird gestritten. Sei es bei der documenta fifteen, bei der Eröffnung des Humboldt-Forums, über Florentina Holzingers „Sancta“ oder im Rahmen der Aufführung des Dokumentarfilms „No Other Land“ in der Berliner Akademie der Künste. Kunstproduktionen sind häufig Anlass für aufgeheizte öffentliche Debatten, die meist über die Kunst selbst hinausweisen.
In seiner Monografie „Wut und Wertung. Warum wir um Geschmack streiten“ (2024) widmet sich der Kulturwissenschaftler Johannes Franzen diesem gleichermaßen aktuellen und zeitlosen Thema. Denn um Kunst, so der Autor, werde nicht nur heute besonders emotional gestritten, sondern schon immer. Das Buch beleuchtet negative Affekte in Geschmackskonflikten wie Schuld (guilty pleasure), Enttäuschung, Hass und Schadenfreude. Deren Analyse untermauert Franzen mit einer bemerkenswert großen Zahl von Beispielen aus Literatur und Popkultur: Anhand von Effie Briest über den Open Cascet von Dana Schutz bis hin zu Serien wie Breaking Bad und dem umstrittenen Rammstein Sänger Till Lindemann[1] zeigt Franzen, wie Kunst zum Anlass wird für über die Kunst hinausweisende gesellschaftliche Auseinandersetzungen.
Johannes Franzen, aktuell wissenschaftlicher Mitarbeiter am Seminar für Deutsche Philologie der Universität Mannheim, analysiert in elf Kapiteln, warum Konflikte über kulturelle Vorlieben wie Bücher, Filme oder Musik zu besonders feindseligen Auseinandersetzungen führen können. Er argumentiert, dass Streitigkeiten über Geschmack eine zentrale Rolle im kulturellen Selbstverständnis der Rezipient*innen spielen. Das Buch, das sich nicht nur an ein Fachpublikum richtet, sondern auch an Kunstaffine, Fans und somit eigentlich fast jede*n, der*die für irgendeine Kunstform brennt, verwendet eine Vielzahl von auch für Laien gut erklärten einschlägigen Konzepten aus der Kunstsoziologie – darunter Distinktion (Pierre Bourdieu) – und der Ästhetik, wie etwa das Geschmacksurteil (Immanuel Kant). Zudem werden unterschiedliche wissenschaftliche (z.B. Rita Felski, Carolin Amlinger und Lawrence Levine), kunstkritische (z.B. Dan Kois) und journalistisch-essayistische (z.B. Hans Magnus Enzensberger) Stimmen in die Argumentation eingeflochten.
Im ersten Kapitel widmet sich Franzen zunächst der „Ästhetischen Intoleranz“ (S. 17), also dem starken Affekt, den man verspürt, wenn das Gegenüber beim als Smalltalk begonnenen Party-Gespräch ästhetische Vorlieben äußert, für die man keinerlei Verständnis aufbringen kann. Franzen geht hier zunächst der ganz grundsätzlichen Frage nach, wie sich Kunstrezipient*innen mit Kunst identifizieren und stellt das Verletzungspotenzial abweichender Geschmacksurteile heraus. Das nächste Kapitel befasst sich mit dem Aufstieg des autonomen Kunstbegriffs und der damit einhergehenden Abwertung von Popkultur, dem Phänomen der Publikumsbeschimpfung und der Disziplinierung von Rezeptionspraktiken (bloß nicht im Kino tuscheln oder im Konzert husten), und nimmt somit Mechanismen der Macht und des sozialen Ausschlusses in den Blick, die hinter Geschmacksurteilen stecken. Weiter geht es mit der Digitalisierung und dem Beispiel der „Review Bomb“ – also eine Welle negativer Kritik, die in Foren über ein Kunstwerk hereinbricht (S. 105). Das Phänomen bewertet der Autor positiv, da es die Kunstkritik demokratisiere und ihren Elitismus infrage stelle. Allerdings geht er auch auf seine Kehrseite ein: Die Demokratisierung gebe auch „toxische(n) Praktiken“, wie Beleidigungen, Raum (S. 116). Die nachfolgenden Kapitel widmen sich dem „Hass auf schlechte Kunst“ in Form des „Bashings“ durch „Anti-Fans“ (S. 134) sowie den Affekten Kitsch, Ekel und Schadenfreude (Kapitel 5 und 6).
Eine Schlüsselrolle in der Argumentation kommt den Kapiteln 8 und 10 zu, in denen der Autor sich Fragen der Moral widmet. Am Beispiel der Kontroversen um das Bild „Thérèse, träumend“ (1938) des französischen Malers Balthus, das heute als kinderpornografisch gilt, geht es um die Frage, wie Kunst moralische Empörung auslöst. Franzen zeichnet nach, dass die Empörung leicht als Kunstfeindlichkeit abgetan werden kann. Das Argument: Wer zur reinen ästhetischen Erfahrung fähig sei, würde über Kunst nicht moralisch urteilen. Die „Distanz zwischen Kunst und Welt, zwischen Autor und Erzähler, zwischen Realität und Abbild“ (S. 257) werde inzwischen vor allem dazu benutzt, moralisch fragwürdiges Verhalten zu rechtfertigen. Franzen fragt, wieso es so leicht ist, diejenigen, die Wut über Kunstwerke wie „Thérèse, träumend“ äußern, als Moralisten oder gar Kunstfeinde abzutun. Bei der Kunst handle es sich um eine „verkehrte Welt des Urteilens“: Es seien „Dinge, über die man sich normalerweise zu Recht empört, erlaubt […], während die moralische Irritation auf einen Mangel an ästhetischem Verständnis verweist“ (S. 258). Interessant ist auch die Auseinandersetzung des Autors mit Triggerwarnungen. Diese schützten nämlich nicht nur vor Retraumatisierungen, sondern im Kontext des Kunstparadigmas wiesen sie diejenigen, „die es trotzdem wagen, die Bilder anzuschauen, als mutige Ästheten aus“ (S. 259).
Im anschließenden Kapitel leitet Franzen aus den Debatten über Kunst generelle Aussagen über Diskussionskulturen der Gegenwart ab. Zu ihnen gehört etwa die Annahme, „emotional sind immer die Anderen“ (S. 279), oder auch der neue Gebrauch des Worts „Zensur“, das oft Verwendung fände, wenn verhandelt werde, was sagbar sei und was es nicht mehr sein sollte. Diesen Aspekt behandelt Franzen unter dem Schlagwort der „ästhetische[n] Verlustangst“ (S. 308). Gemeint ist damit die Befürchtung, dass die moralische Kritik an Kunst den Rezipient*innen die Erfahrung geliebter Kunst verderben könne – oder gleich deren Verbot nach sich ziehen. Die ästhetische Verlustangst unterstellt dem Gemeinwesen „Regeln aufzustellen, die in den Alltag der Rezeption auf eine destruktive Art eingreifen“ (S. 361). Was Franzen hier diskursanalytisch aufschlüsselt, kritisiert er auch. Es gebe ein „verwirrtes Verhältnis von können und dürfen“ (S. 310): Man spreche von Zensur, aber eigentlich sei heute jedwede noch so scharf kritisierte Kunst so leicht verfügbar wie nie. Wenn Michael Jackson oder Till Lindemann als Täter sexueller Gewalt entlarvt werden oder „Winnetou“ plötzlich als problematisch gilt, dann sei die Gefahr weniger, dass Kunst verboten werde, als dass ihr Genuss einen seltsamen Beigeschmack bekomme.
Die Digitalisierung begünstige derartige Verlustängste auslösende moralische Enthüllungen, die Franzen mit Gérard Genette als „vergiftete[n] Paratext“ (S. 326) bezeichnet, also als Wissen um die Kunst, das nicht von den Künstler*innen produziert wird, und das den Kunstgenuss erheblich schmälern kann. Aus Franzens Sicht ist dieses Mitwirken der Öffentlichkeit an der Kunstrezeption progressiv, da sich nun viele an der Deutung von Kunst beteiligen könnten – auch die Opfer missbräuchlichen Verhaltens. Weniger progressiv erscheint die Entwicklung allerdings denjenigen, die ästhetische Verluste befürchten, sie erleiden oder sie mit ihrem machtmissbräuchlichen Verhalten gar auslösen. Sie verspürten eine Sehnsucht nach Kunstwerken als Orte, „die frei von Schuldgefühlen sind, in denen man sich versenken kann, ohne vom erhobenen Zeigefinger gesellschaftlicher Anforderungen gestört zu werden“ (S. 393).
Diese kritische Analyse endet jedoch überraschend. Franzen schließt nämlich mit dem optimistischen Argument, dass die in dem Buch betrachteten Auseinandersetzungen mitnichten destruktiv, sondern vielmehr produktiv für die Entwicklung von Kunst und Gesellschaft seien. Grund dafür sei, dass sie Reflexion und Dialog förderten und sich in ihnen der „unberirrbare Lebensgeist einer Kultur [zeige], deren Energie nicht verlorengeht, wenn Menschen weniger Hochliteratur lesen oder Kunstfilme schauen“ (S. 396 f.). Dispute über Kunst florierten auch deshalb, weil streiten über Kunst „so viel Spaß macht“ (S. 395). Dieses Fazit kommt angesichts des Fokus des Buchs auf negative Affekte in der Kunstrezeption dann doch etwas aus dem Nichts. Gerade angesichts aktueller Debatten, wie sie um den Film „No other Land“ geführt werden, welcher die Verhältnisse in Gaza dokumentarisch zeigt, und dessen Regisseure darum kämpfen mussten, nicht als antisemitisch zu gelten, wirkt dieser Optimismus etwas deplatziert.[2] Denn derartige Konflikte verhandeln politische Macht und Legitimität von Sprecherpositionen und haben Auswirkungen auf die Sicherheit der Kunstschaffenden.
Franzens Analyse, dass es bei Geschmackskonflikten um sehr viel mehr geht als um Kunst, vermag allerdings restlos zu überzeugen. Das lesenswerte Buch bietet einen sowohl breitgefächerten als auch tiefgehenden Einblick in politisierte Auseinandersetzungen um Geschmack, die nicht nur im Reservatbereich der Kunst verbleiben, sondern Aufschluss geben über Identitäten und Konfliktlinien in der Gesellschaft. „Wut und Wertung“ ist eine zugängliche, materialreiche Mischung aus theoretischen Überlegungen und anschaulichen Beispielen, die verschiedenen Medien und Epochen entstammen.
Obwohl Franzen dies selbst nicht markiert – der Anschluss an Forschungsgebiete scheint zugunsten der Ansprache eines breiteren Publikums zurückzutreten – dürfte die Untersuchung auch für Forschende der Emotions- und Affektsoziologie, der Medien- und Kunstsoziologie, sowie der Soziologie der Bewertung, des Geschmacks und ferner des Designs von einigem Interesse sein. Auch für Kunsthistoriker*innen ist das Buch interessant, liefert es doch eine kurze Geschichte prominenter Geschmackskonflikte. Die Ästhetische Theorie wird noch am direktesten angesprochen, denn indem sie die Grenzen dessen, was Kunst ist, mitbestimmt, ist sie selbst ist „Teil dieser Konfliktgeschichte“ (S. 52). Zu kritisieren wäre, dass die politische Theorie zu kurz kommt. Mit einem durch sie geschulten Begriff des Konflikts[3] hätte man den Zusammenhang zwischen Geschmack und politischem Streit sicherlich noch etwas weiter erhellen können.
Nichtsdestotrotz vermag das Buch immer wieder durch überraschende Einsichten zu begeistern, führt die Leser*in leichthändig von Beispiel zu Beispiel und ruft dabei manche Erinnerung an eine Debatte wach, die vor dem Hintergrund der nachfolgenden bereits verblasst war. Dass von so manchen dieser Streits durchaus eine Faszination ausgeht, zeigt das Buch so gewissermaßen performativ. Die genauen Analysen, die Franzen dazu präsentiert, überzeugen und eröffnen eine neue Perspektive auf die Geschmackskonflikte der Gegenwart. Trotz des Blicks auf negative Affekte wie Wut, Scham und Schuld werden die aufgeheizten Konflikte um Geschmack dabei nicht als Ausdruck des Niedergangs kultureller Debatten dargestellt, sondern als zentrale Orte der Aushandlung von Macht wie von kulturellem Fortschritt. Das liest sich angesichts der zahlreichen Klagen über das aktuelle kulturelle Klima sehr erfrischend.
Würde man dennoch nach Lücken in der Argumentation fahnden, drängte sich die dann am Ende doch nicht ganz beantwortete Frage auf, wie sich die keineswegs neuen Konflikte um Kunst denn gegenwärtig verändern. Zu eruieren wäre etwa, inwieweit die öffentlichen, durch Online-Kommunikation befeuerten Debatten um Geschmack eigentlich Schäden hervorrufen und wie mächtig die ästhetischen Verlustängste auf politischer Ebene sind. Dass eine Demokratisierung von „Wut und Wertung“ in Summe progressive Effekte haben soll, kann das Buch eher beschwören als belegen. Denn notwendigerweise bleibt offen, wie überzeugend diejenigen, die die von Franzen so treffend beschriebenen „ästhetischen Verlustängste“ aktuell am meisten verspüren, eigentlich seine Analyse fänden.
Fußnoten
- https://www.deutschlandfunkkultur.de/skandal-und-moral-in-der-popkultur-dlf-kultur-c5183d10-100.html (5.1.2025)
- https://www.sueddeutsche.de/kultur/antisemitismus-debatte-wieder-diskussionen-um-berlinale-film-no-other-land-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-241113-930-287597 (5.1.2025)
- Zu nennen wäre hier etwa Oliver Marchart, Conflictual aesthetics: artistic activism and the public sphere, Berlin 2019.
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Hannah Schmidt-Ott.
Kategorien: Affekte / Emotionen Demokratie Gesellschaft Kultur Kunst / Ästhetik Öffentlichkeit Pop
Zur PDF-Datei dieses Artikels im Social Science Open Access Repository (SSOAR) der GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gelangen Sie hier.
Empfehlungen
Die ambivalente Ästhetik des Widerstands
Rezension zu „Protest! A History of Social and Political Protest Graphics“ von Liz McQuiston
