Stefan Messingschlager | Rezension | 10.11.2025
Atomisierung statt Integration
Rezension zu „Beyond Coercion. The Politics of Inequality in China“ von Alexsia T. Chan
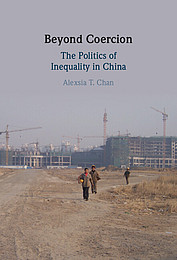
In einer Zeit, in der China mit tiefgreifenden sozialen Herausforderungen und zunehmender Ungleichheit konfrontiert ist, wirft Alexsia T. Chans aufschlussreiche Neuerscheinung Beyond Coercion. The Politics of Inequality in China ein dringend notwendiges Schlaglicht auf die anhaltende Marginalisierung von rund 300 Millionen Wanderarbeiterinnen und -arbeitern im urbanen Raum. Trotz wiederholter offizieller Bekenntnisse zur Integration dieser Gruppe in städtische Wohlfahrtssysteme sind soziale Ausgrenzung und unzureichender Zugang zu essenziellen sozialen Dienstleistungen die Realität. Chan benennt dieses Paradox und formuliert zwei Leitfragen: Weshalb scheitert der chinesische Staat immer wieder daran, seine ausdrücklich formulierten Reformversprechen einzulösen? Und durch welche gezielten Mechanismen wird soziale Ungleichheit strategisch als Instrument politischer Kontrolle eingesetzt?
Im Mittelpunkt von Chans Analyse steht das innovative Konzept der „political atomization“ – eine Reihe mehr oder weniger subtiler administrativer Strategien, die der Staat bewusst einsetzt, um marginalisierte Gruppen zu isolieren und dadurch ihr Potenzial zu kollektivem Handeln systematisch zu untergraben. Überzeugend argumentiert Chan, dass die wiederkehrenden Fehlschläge und scheinbar unbeabsichtigten Folgen staatlicher Integrationspolitiken keineswegs zufällig sind, sondern das Ergebnis hochwirksamer bürokratischer Praktiken darstellen, die die politische Kontrolle durch eine aktive Steuerung sozialer Ungleichheit festigen sollen (S. 3 f.). Auf Grundlage umfangreicher ethnografischer Feldforschung in Städten wie Beijing, Shanghai und Chengdu dokumentiert Chan, wie lokale Behörden das staatliche Integrationsversprechen institutionell bestenfalls fragmentiert adressierbar machen und selektiv durchsetzen. Anhand lebendig und detailliert erzählter Fallstudien zeigt sie die Komplexität und häufige Willkür der bürokratischen Anforderungen, mit denen Migrant:innen konfrontiert sind, wenn sie versuchen, ihre Kinder auf öffentlichen Schulen anzumelden oder Zugang zum Gesundheitssystem zu erhalten – Hindernisse, die darauf abzielen, sie zu isolieren und ihr kollektives Mobilisierungspotenzial zu schwächen (S. 147). In deutlichem Gegensatz zu gängigen Ansätzen, die sich vor allem auf offene Repression konzentrieren, legt Chan am Beispiel der Volksrepublik China überzeugend dar, wie zeitgenössische autoritäre Regime zunehmend auf diffuse administrative Prozesse setzen, um politische Stabilität zu gewährleisten – wenn auch um den Preis steigender sozialer Ungleichheit.
Um ihre Thesen zu untermauern, präsentiert Chan in den Kapiteln 3 bis 7 zahlreiche empirische Beispiele, die anschaulich zeigen, wie die Mechanismen sozialer Kontrolle im Alltag der Migrantinnen und Migranten konkret sichtbar werden. Dabei analysiert sie zunächst die Strategie des „deflecting“, was bedeutet, dass staatliche Institutionen es Wanderarbeiter:innen gezielt erschweren, ihre legitimen Ansprüche durchzusetzen. Besonders aufschlussreich sind hierbei die „phantom services“: öffentliche Leistungen wie Gesundheitsversorgung und Bildung, die formal verfügbar sind, aber aufgrund undurchsichtiger und häufig wechselnder bürokratischer Anforderungen praktisch unerreichbar bleiben (S. 56). Eindrucksvoll beschreibt Chan einen exemplarischen Fall aus Hangzhou, bei dem eine Migrantin dringend eine Operation benötigte, jedoch durch unüberwindbare administrative Hürden – darunter überhöhte Krankenversicherungsbeiträge, niedrige Erstattungssätze sowie komplizierte bürokratische Abläufe – gezwungen war, auf die notwendige Behandlung vor Ort zu verzichten und stattdessen eine weit entfernte ländliche Gesundheitsstation aufzusuchen. Scheinbar neutrale Verwaltungsvorschriften führen in der Praxis systematisch dazu, dass Migrant:innen in Städten grundlegende Versorgungsleistungen vorenthalten werden (S. 66 f.).
Die Migrant:innen internalisieren das bürokratische Scheitern als ihr persönliches Versagen, anstatt dessen strukturelle und institutionelle Ursachen zu erkennen.
Daneben identifiziert Chan gezielte Strategien einer „political demobilization“, mit denen staatliche Institutionen bewusst institutionelle Fragmentierung erzeugen, um eine nachhaltige kollektive Mobilisierung der Wanderarbeiterinnen und Wanderarbeiter zu verhindern (Kap. 4). Besonders deutlich zeigt sich dies im Bildungssektor, wo Migrant:innen mit häufig unüberwindbaren und sich zudem ständig ändernden bürokratischen Anforderungen konfrontiert sind. Eindrücklich belegt Chan dies am Beispiel der privat betriebenen minban xuexiao (民办学校, häufig als „people-run schools“ bezeichnet), in denen ein Großteil der Kinder von Arbeitsmigrant:innen unterrichtet wird und deren Existenz durch wechselnde Zertifizierungsstandards sowie willkürliche Lizenzierungsanforderungen permanent bedroht ist (S. 85–89). Aufgrund gezielt erzeugter administrativer Unsicherheit sehen sich Schulleitungen und Eltern gezwungen, ihre Ressourcen kurzfristig an jeweils neue Standards anzupassen und aktuelle Regeln zu erfüllen – was kollektives Handeln und organisierten Protest faktisch verhindert. Besonders hervorzuheben ist, wie Chan die tiefgreifenden psychologischen Folgen dieser Praktiken herausarbeitet: Die Migrant:innen internalisieren das bürokratische Scheitern als ihr persönliches Versagen, anstatt dessen strukturelle und institutionelle Ursachen zu erkennen. Mit diesen äußerst wirkungsvollen Strategien gelingt es den lokalen Behörden, kollektive Forderungen und potenzielle soziale Proteste bereits im Vorfeld auszubremsen und zugleich eine Fassade bürokratischer Neutralität aufrechtzuerhalten (S. 41 f.).
Zugleich – auch dies verdeutlicht Chan – sind Wanderarbeiterinnen und Wanderarbeiter keineswegs passive Opfer. Vielmehr suchen sie aktiv und einfallsreich nach individuellen Lösungen, um bürokratische Hürden zumindest zeitweise zu umgehen. Im fünften Kapitel liefert Chan Beispiele dafür, welche praktischen Strategien und Taktiken die Migrant:innen anwenden, um kurzfristigen Zugang zu essenziellen Dienstleistungen zu erhalten. Sie nutzen beispielsweise informelle Soziale Netzwerke und persönliche Beziehungen – das weithin bekannte guanxi (关系) –, um administrative Hindernisse zu überwinden oder zu umgehen (S. 108 f.). Gleichzeitig legt die Autorin jedoch die inhärente Ambivalenz dessen offen: Zwar verschafft der individuelle Widerstand unmittelbar Erleichterung, doch er verstärkt auch die politische Atomisierung, indem er die Energie der Migrant:innen weg von kollektiven Aktionen hin zu individuellen Bewältigungsmechanismen lenkt. Auf diese Weise schwächen die informellen Lösungen der Einzelnen unbeabsichtigt die Solidarität und reduzieren das Potenzial für eine dauerhafte kollektive politische Mobilisierung (S. 120).
Anhand eindringlicher Schilderungen zeigt Chan im sechsten Kapitel auf, wie Migrantengemeinschaften – dauerhaft von formellen Institutionen ausgeschlossen – auf improvisierte und häufig risikoreiche Maßnahmen zurückgreifen müssen, um grundlegende Bedürfnisse wie Gesundheitsversorgung und Bildung notdürftig sicherzustellen. Sie sind abhängig von informellen, unregulierten medizinischen Einrichtungen, den sogenannten „black clinics“ (hei zhensuo, 黑诊所). Da ihnen der Zugang zur öffentlichen Gesundheitsversorgung oft verwehrt bleibt, haben sie in der Regel keine andere Wahl, als sich diesen unsicheren und illegalen Einrichtungen anzuvertrauen (S. 129). Wie Chan überzeugend argumentiert, tragen solche informellen Praktiken zur Normalisierung extremer Prekarität bei – und verfestigen so genau jene Dynamiken politischer Atomisierung, die sie zuvor herausgearbeitet hat.
Insbesondere der systematische Ausschluss von Migrantenfamilien aus adäquaten Bildungs- und Gesundheitsangeboten sei fatal; derlei ausgrenzende Praktiken hätten tiefgreifende Auswirkungen auf die weitere soziale und ökonomische Entwicklung Chinas.
Abschließend bündelt die Autorin ihre Erkenntnisse zu einer differenzierten Reflexion über die langfristigen Folgen der politischen Atomisierung für den chinesischen Staat. Die administrativen Strategien der Regierung würden zwar kurzfristig politische Stabilität gewährleisten, brächten jedoch auf längere Sicht erhebliche soziale und wirtschaftliche Risiken mit sich (S. 151). Insbesondere der systematische Ausschluss von Migrantenfamilien aus adäquaten Bildungs- und Gesundheitsangeboten sei fatal; derlei ausgrenzende Praktiken hätten tiefgreifende Auswirkungen auf die weitere soziale und ökonomische Entwicklung Chinas (S. 152). Die anhaltende Exklusion erschwere die Herausbildung einer stabilen Mittelschicht erheblich und verfestige eine dauerhafte soziale Fragmentierung. Chan warnt ausdrücklich vor einer zunehmenden Distanz zwischen den Migrantengemeinschaften und dem chinesischen Staat, die potenziell zu verschärften sozialen Spannungen und größerer politischer Instabilität führen könnte.
Alexsia T. Chan leistet mit Beyond Coercion. The Politics of Inequality in China einen bedeutsamen Beitrag zur Erforschung autoritärer Regierungspraktiken, indem sie die oft übersehenen Mechanismen sichtbar macht, mittels derer die Regime soziale Kontrolle und institutionalisierte Ungleichheit aufrechterhalten. Ihr Konzept der politischen Atomisierung schließt dabei eine wichtige Forschungslücke, indem es den Fokus von offen repressiven Maßnahmen des Staates auf jene administrativen Praktiken lenkt, die die soziale Ordnung mittels strategischer Ausgrenzung und Fragmentierung bewahren. Durch umfangreiche ethnografische Feldforschung zeichnet Chan die alltäglichen Erfahrungen der Wanderarbeiterinnen und Wanderarbeiter sowie die bürokratischen Hindernisse nach – und macht damit die in China weitgehend verdeckten institutionellen Mechanismen der Exklusion sichtbar. Ihre differenzierte Betrachtung der individuellen Bewältigungsstrategien einerseits wie auch der strukturellen Kontrollmechanismen andererseits bereichert die sozialwissenschaftliche Chinaforschung wesentlich und leistet darüber hinaus einen wichtigen methodisch-theoretischen Beitrag zu vergleichenden Debatten über Autoritarismus, Ungleichheit und Governance. Kurz: Eine unbedingte Lektüreempfehlung für Forschende und Studierende, die ein vertieftes Verständnis der mehr oder weniger subtilen Dynamiken autoritärer Herrschaft und der tief verwurzelten institutionellen Ursachen sozialer Ungleichheit suchen.
Fußnoten
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Henriette Liebhart.
Kategorien: Gesundheit / Medizin Gruppen / Organisationen / Netzwerke Macht Rassismus / Diskriminierung Soziale Ungleichheit
Zur PDF-Datei dieses Artikels im Social Science Open Access Repository (SSOAR) der GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gelangen Sie hier.
Empfehlungen
Eine politische Angelegenheit
Rezension zu „Politiken der Reproduktion. Umkämpfte Forschungsperspektiven und Praxisfelder“ von Marie Fröhlich, Ronja Schütz und Katharina Wolf (Hg.)
Die Vorläufer der Neuen (alten) Rechten
Rezension zu „Rechtsextrem: Biografien nach 1945“ von Gideon Botsch, Christoph Kopke und Karsten Wilke (Hg.)
