Leo Roepert | Rezension | 14.12.2020
Biedermann als Brandstifter
Rezension zu „Konformistische Rebellen. Zur Aktualität des autoritären Charakters“ von Katrin Henkelmann et. al. (Hg.)
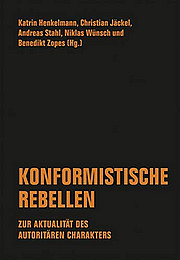
In Max Frischs bekannter Parabel auf den Aufstieg autoritärer Regime sind die Rollen klar verteilt: Herr und Frau Biedermann besitzen ein Haus, in dem sie ungestört ihr bürgerliches Leben leben möchten; die Brandstifter wollen dieses Haus niederbrennen. Obwohl sie kaum einen Hehl aus ihren Absichten machen, geht ihr Plan am Ende auf, weil die Biedermanns ihnen mit einer Mischung aus ängstlichem Opportunismus und Realitätsverleugnung begegnen. Die Theorie des autoritären Charakters, die seit den frühen 1930er-Jahren vor allem von Erich Fromm, Max Horkheimer und Theodor W. Adorno ausgearbeitet wurde, hat eine andere Pointe: sie zeigt, dass im Biedermann selbst ein Brandstifter steckt. Im autoritären Charakter verbinden sich widersprüchliche Impulse und Eigenschaften. Einerseits verhält er sich Autoritäten gegenüber kritiklos und unterwürfig, andererseits hat er starke aggressive und destruktive Neigungen, die sich gegen Fremdgruppen, aber auch gegen etablierte Normen und Institutionen richten. In seinem Verhältnis zur gesellschaftlichen Ordnung lässt sich der autoritäre Charakter daher als konformistischer Rebell charakterisieren – er rebelliert gegen die Ordnung auf eine Weise, die es ihm erlaubt, zugleich die Identifikation mit ihr aufrechtzuerhalten.
Der Band Konformistische Rebellen stellt die Frage nach der Aktualität der Theorie des autoritären Charakters. Die Beiträge des ersten Teils rekapitulieren die Grundlagen kritischer Autoritarismustheorie. Eine sehr gute Überblicksdarstellung bietet der Aufsatz von Ingo Elbe: Er zeigt, wie die Mitglieder des Instituts für Sozialforschung Marx‘sche Gesellschaftstheorie mit Grundeinsichten der Freud‘schen Psychoanalyse verbanden, um zu verstehen, warum Individuen sich mit Herrschaftsstrukturen und Weltbildern identifizieren, die ihren eigenen Interessen zuwiderlaufen. Der autoritäre Charakter sei dadurch gekennzeichnet, dass er die Erfahrung gesellschaftlich hervorgebrachter Ohnmacht verarbeite, indem er seine eigene Subjektivität negiere und bei scheinbar mächtigen Kollektiven und idealisierten Führerfiguren Schutz suche. Frustrationen und Aggressionen, die ihren eigentlichen Grund in sozialen Antagonismen haben, würden projektiv an Fremdgruppen ausagiert. Was Elbes Darstellung ausspart, sind die sozialisationstheoretischen Überlegungen, mit deren Hilfe die Frankfurter die individuelle Genese des autoritären Charakters erklären wollten: die patriarchale Autorität, der das Kind unterworfen wird, habe im fortgeschrittenen Kapitalismus ihre rationale Grundlage verloren, weshalb die Identifikation mit ihr notwendig misslingen müsse. Daraus resultiere ein Charakter mit einem schwachen Ich und einem schlecht integrierten Über-Ich, der für autoritäre Anrufungen anfällig sei.
Der zweite Teil des Bandes widmet sich den Spezifika der autoritären Charakterstruktur. Hier sind die Beiträge von Ljiljana Radonić und Sebastian Winter hervorzuheben, die die geschlechtliche Dimension des Autoritarismus in den Blick nehmen – ein Themenfeld, das von der feministischen Forschung und der kritischen Männlichkeitsforschung seit langem bearbeitet wird, in der breiteren sozialwissenschaftlichen Debatte um Populismus und den aktuellen „Rechtsruck“ jedoch noch immer eine untergeordnete Rolle spielt. Winter erklärt den aktuellen „Antigenderismus“, den er neben Rassismus und Antisemitismus als zentrales Element der neu-rechten Strömungen ausmacht, aus der Konstitutionslogik bürgerlich-männlicher Subjektivität. Radonić zeigt, dass es in der antisemitischen Projektion geschlechtsspezifische Unterschiede gibt: während Männer vor allem als weiblich codierte Eigenschaften wie Passivität und Verletzbarkeit auf den jüdischen Andren übertrügen, projizierten Frauen vor allem aggressive und sexuelle Impulse, die nicht der herrschenden Weiblichkeitsnorm entsprächen.
Die Frage nach der Aktualität der Autoritarismustheorie, die im Zentrum des umfangreichen dritten Teils steht, wird unterschiedlich beantwortet. Jan Weyand und Jan Gerber halten die Theorie des autoritären Charakters für historisch überholt. Weyand argumentiert, dass sie den gegenwärtigen Aufstieg nationalistischer Kräfte schon deshalb nicht erklären könne, weil sie sich ihrer Anlage nach gar nicht für konkrete Ursachen gesellschaftlicher Entwicklungen interessiere, sondern lediglich eine strukturelle Disposition zu erfassen versuche. Hinzu komme, dass sich ein grundlegender Wandel hin zu anti-autoritären Erziehungsstilen vollzogen habe, die entsprechend andere Charakterstrukturen hervorbrächten. „Den typischen Sozialcharakter der Gegenwart muss man nicht anbrüllen, damit er tut, was er soll. Das macht er von alleine“ (S. 254). Gerbers Kritik setzt an der Differenz der zu erklärenden Phänomene an. Die populistischen Bewegungen der Gegenwart hätten mit dem historischen Faschismus kaum etwas gemeinsam. Weder handele es sich um Massenbewegungen, noch würden sie ein Führer-Prinzip propagieren. Auch ein irrationaler Jugend- und Gewaltkult sei nicht zu erkennen. Marxistische Faschismustheorien oder das sozialpsychologische Autoritarismuskonzept seien daher ungeeignet, den heutigen Populismus zu erfassen. Gerbers Warnung vor historischen Analogisierungen hat ihre Berechtigung, seine eigene Deutung des Populismus tendiert jedoch ins andere Extrem, indem sie alle Gemeinsamkeiten mit dem Faschismus ausblendet: den völkischen Nationalismus, der das Eigene als homogene Gemeinschaft auffasst, den Rassismus, der die Überlegenheit des Eigenen gegenüber „barbarischen Fremden“ behauptet, und eine System- und Elitenkritik, die um einen Kern latent bis manifest antisemitischer Verschwörungsmythen organsiert ist. Verbunden werden diese Elemente durch eine „palingenetische“ Erzählung, die eine fundamentale Bedrohung des Eigenen behauptet, welche nur durch einen Akt nationaler Wiedergeburt überwunden werden kann.[1]
Für Christine Kirchhoff und Karin Stögner kann die Theorie des autoritären Charakters auch heute noch Gültigkeit beanspruchen. Laut Kirchhoff zeige sich die Gegenwart autoritärer Charaktere nicht nur in dem Zuspruch, den Pegida und AfD erführen, sondern auch in weniger offensichtlicher Weise. Der von vielen Liberalen geäußerte Wunsch, mit Rechten zu reden, verrate, so ihre These, eine heimliche Identifikation. Der kommunikative Austausch ermögliche es, an der autoritären Enthemmung, die das Gegenüber praktiziere, teilzuhaben, ohne sie selbst zu vollziehen. Nur auf den ersten Blick paradox ist nach Stögner, dass im Zeitalter des neoliberalen Individualismus zugleich autoritäre Kollektive an Bedeutung gewinnen. „Denn das nationalistische und ethnozentrische Kollektiv ist […] nur die Kehrseite dieses neoliberalen Fake-Individualismus, der in Vereinzelung und sozialer Atomisierung besteht“ (S. 270). Eine Konstante des autoritären Charakters seien der „Hass auf Differenz“ (S. 271) und „Mixophobie“ (S. 271). Die eigene nationale und geschlechtliche Identität werde als Einheit verstanden, die nach außen strikt abgegrenzt und innen rein gehalten werden soll – eine Auffassung, die sich mitunter auch in linker Identitätspolitik finde. Mit Adorno müsse Identität, die dem falschen Universalismus des Tauschprinzips entspringe, als die Urform von Ideologie bestimmt werden.
Peter Schulz‘ Beitrag nimmt hinsichtlich der Frage nach der aktuellen Relevanz des autoritären Charakters eine Mittelposition ein. Der autoritäre Charakter, wie er von der Kritischen Theorie konzipiert wurde, entspreche dem Kapitalismus der Zwischenkriegszeit, der von körperlich anstrengender und schlecht entlohnter Industriearbeit im hierarchischen Betrieb geprägt sei. Im fordistischen Konsum-Kapitalismus werde der konventionelle Charakter zum vorherrschenden Sozialtypus. Mit dem postfordistischen Kapitalismus, der sich durch weitergehende Tertiarisierung und Ausdifferenzierung von Kulturindustrie und Konsum auszeichne, betrete schließlich der narzisstische Charakter die Bühne, der eine starke orale Disposition aufweise und nach Einheit und Anerkennung strebe. Der konventionelle und der autoritäre Charakter verschwänden jedoch nicht; vielmehr sei von einer „Gleichzeitigkeit dominanter Sozialcharaktere im Gegenwartskapitalismus“ (S. 282) auszugehen. Der narzisstische Charakter sei sozialstrukturell vor allem in den relativ abgesicherten, aber atypischen Berufsfeldern zu verorten, wo entgrenztes Arbeiten und relativ hohes Einkommen sein Individualitätsbedürfnis stützten. Der konventionelle Charakter sei hingegen vorwiegend unter Facharbeiter*innen, Beamt*innen oder Angestellten im öffentlichen Dienst anzutreffen. Der autoritäre Typus finde sich – mit Ausnahme der neurechten Funktionseliten, die gutsituierten Milieus entstammen – vor allem in Schichten, die von Prekarität und Exklusion bedroht seien.
Die Beiträge des vierten Teils beleuchten unterschiedliche Aspekte des gegenwärtigen Autoritarismus. Dabei wird deutlich, dass sich autoritäre Mechanismen nicht nur bei der politischen Rechten, etwa bei den „regressiven Rebellen“ (Heumann/Nachtwey) der AfD finden lassen. So zeigt etwa Miriam Mettler, inwiefern die Unterordnung des Individuums unter die islamische Gemeinschaft der Umma auf ein mütterliches Separationsverbot zurückgeht. Tom David Uhlig widmet sich dem Autoritarismus in der Linken, den er unter anderem am Beispiel der Bewegung Aufstehen untersucht. Deren Weltsicht sei von einem nationalistischen Gemeinschaftsethos und einem „Phantasma der Rückwärtsgewandtheit“ (S. 372) bestimmt, das auf die Wiederherstellung einer vermeintlich verlorengegangenen Einheit der Interessen von Volk und Staat ziele. Kritik an kapitalistischen Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnissen werde durch eine Neoliberalismus-Kritik ersetzt, die sich vor allem gegen Individualismus und Kosmopolitismus richte und damit auch an antisemitische Deutungsmuster anschlussfähig sei.
Konformistische Rebellen stellt einen gelungenen Anstoß zur Wiederbelebung der Diskussion um die kritische Autoritarismustheorie dar. Erfreulich ist, dass viele Beiträge deren psychoanalytische Grundlage unterstreichen. Einige Adaptionen des Autoritarismuskonzepts, wie etwa die Studien der Heitmeyer-Gruppe, und neuere soziologische Subjekttheorien (Richard Sennett, Ulrich Bröckling, Andreas Reckwitz) klammern die Sozialpsychologie aus. Sie ist jedoch unverzichtbar, wenn nicht nur die Verbreitung autoritärer Einstellung gemessen und deskriptive Idealtypen gebildet, sondern die – auch aus politischen Gründen drängenden – theoretischen Fragen nach der Attraktivität irrationaler und destruktiver Weltbilder beantwortet werden sollen.
Gleichzeitig wird bei der Lektüre des Bandes deutlich, dass das sozialpsychologische Instrumentarium in vielerlei Hinsicht problematisiert und weitergedacht werden muss. Die Sozialisationsbedingungen haben sich grundlegend gewandelt. Neben veränderten Erziehungspraktiken wären auch neue Sozialisationsinstanzen wie Social Media zu berücksichtigen, auf die Björn Milbrandt in seinem Beitrag hinweist. Die vielfach formulierte These, der Autoritarismus sei durch den Narzissmus abgelöst worden, mag hilfreich sein, um den Wandel von Subjektivität in Grundzügen zu beschreiben, ist letztendlich aber zu undifferenziert. Es sollte nicht nur in Betracht gezogen werden, dass – wie Schulz in seinem Beitrag argumentiert – autoritäre und narzisstische Sozialcharaktere nebeneinander existieren, sondern auch, dass Autoritarismus und Narzissmus unterschiedliche, zugleich aber miteinander verschränkte Momente bürgerlicher Subjektivität darstellen könnten.[2]
Eine weitgehend ungeklärte theoretische Frage ist die nach der Vermittlung spezifischer Inhalte und Weltbilder mit den allgemeinen Merkmalen und Mechanismen des autoritären Charakters. Islamismus und Rechtspopulismus, die beide autoritarismustheoretisch gefasst werden können, haben einiges gemeinsam, unterscheiden sich aber auch in vielen Hinsichten. Rassismus ist nicht dasselbe wie Antisemitismus oder Misogynie. Eine erweiterte Theorie des autoritären Charakters müsste zeigen, wie die spezifische Empfänglichkeit für diese unterschiedlichen Phänomene in subjektiven Strukturen angelegt ist und wie diese wiederum durch objektive gesellschaftliche Strukturen hervorgebracht werden. Auf diese Weise könnte eine Einsicht aktualisiert werden, die in den Debatten um das Erstarken autoritärer Bewegungen insgesamt noch zu wenig präsent ist: dass die destruktiven Tendenzen der Gegenwartsgesellschaft nicht nur an ihren „Rändern“, bei den „Modernisierungsverlierern“ und „Extremisten“ zu verorten sind, sondern aus der „bürgerlichen Mitte“ selbst entspringen: Biedermann als Brandstifter.
Fußnoten
- Vgl. Roger Griffin, Fascism, Cambridge 2018, S. 37-62.
- Für ein solches Verständnis vgl. Lutz Eichler, System und Selbst. Arbeit und Subjektivität im Zeitalter ihrer strategischen Anerkennung, Bielefeld 2013, S.244-247.
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Hannah Schmidt-Ott.
Kategorien: Politik Kritische Theorie
Zur PDF-Datei dieses Artikels im Social Science Open Access Repository (SSOAR) der GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gelangen Sie hier.
Empfehlungen
Mission Impossible?
Rezension zu „Kritische Theorie der Politik“ von Ulf Bohmann und Paul Sörensen (Hg.)
Neue Konturen feministischer Kritischer Theorie
Rezension zu „Kritische Theorie und Feminismus“ von Karin Stögner und Alexandra Colligs (Hg.)
Francesca Barp, Hannah Schmidt-Ott
„An asset and a burden“
Bericht zur Konferenz „Futuring Critical Theory“ vom 13. bis 15. September 2023 in Frankfurt am Main
