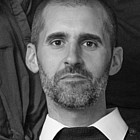Julien Deroin | Rezension | 10.03.2020
Das große Unbehagen der kleinen Leute
Rezension zu „Le temps des passions tristes. Inégalités et populisme“ von François Dubet

Für den Aufstieg des Populismus, der sich seit geraumer Zeit in den westlichen Demokratien vollzieht, mangelt es fürwahr nicht an einfachen Erklärungen. Der Großteil führt die aktuelle politische Polarisierung auf wachsende gesellschaftliche Antagonismen zurück: zwischen Gewinnern und Verlierern der Globalisierung und der 'ökonomischen Modernisierung', zwischen kosmopolitischen anywheres und heimatverbundenen somewheres[1], zwischen 'offener Gesellschaft' und ihren (fremdenfeindlichen, wertkonservativen, homophoben, sexistischen) Feinden, oder auch zwischen (Groß-)Stadt- und Landbewohner*innen. Da sie das Phänomen des Populismus anhand von makrosoziologischen oder auch makroökonomischen Variablen – also quasi 'von außen' – einzufangen versuchen, greifen derartige Erklärungsversuche bei aller intuitiven Plausibilität letztlich zu kurz.[2] Nicht selten lassen sich zudem politisch motivierte Deutungsmuster ausmachen, oft gepaart mit (ab-)wertenden oder moralisierenden Untertönen und polemischen Zuspitzungen.
Vor diesem Tableau ragt der jüngste Essay des französischen Soziologen François Dubet klar heraus. Denn als Ungleichheits- und Gerechtigkeitsforscher sucht Dubet die Gründe für den Erfolg des Populismus in gesellschaftlichen Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte, mit denen er dank langjähriger Forschung unter anderem zum Schulsystem, zur Arbeitswelt und zu den Jugendlichen in den französischen Vorstädten seit Langem detailliert vertraut ist.[3] Seit den 2000er-Jahren hat er diese Beobachtungen zu einer Art allgemeiner Theorie der sozialen Ungleichheit in den heutigen westlichen Gesellschaften systematisiert, die auch den vorliegenden Essay grundiert.[4] Le temps des passions tristes begreift den Populismus als politischen Ausdruck eines tiefen Unbehagens an neuartigen Formen der Ungleichheit und weist darin, wenngleich auf dortige Beobachtungen gestützt, in seinen Implikationen über Frankreich hinaus.
Die Erfahrung sozialer Ungleichheit
Die Einkommens- und Vermögensungleichheit in den westlichen Gesellschaften hat im vergangenen Jahrzehnt einige Aufmerksamkeit erregt, nicht zuletzt ob ihres mittlerweile exorbitanten Ausmaßes.[5] Dubet zufolge wird die politische Sprengkraft dieser Entwicklung allerdings großenteils überschätzt: Der Anstoß, den die obszöne Bereicherung weniger Superreicher – ob der reichsten 1 oder 0,1 Prozent – errege, sei in Wahrheit vergleichsweise gering. Viel bedeutsamer für die subjektive Erfahrung von Ungleichheit seien die unzähligen „kleinen“ Demütigungen, Diskriminierungen und Benachteiligungen, die die Menschen im Alltag erleben und die Bourdieu seinerzeit mit dem Begriff der „kleinen Nöte“[6] (petites misères) in den Blick nahm. Die soziologische Analyse kann sich Dubet zufolge daher nicht mit der statistischen Messung von Ungleichheit begnügen, sondern muss deren subjektive Wahrnehmung – welche wiederum gesellschaftlich vermittelt wird – gleichberechtigt einbeziehen (S. 104):
Du point de vue économique, ce sont les grandes inégalités qui comptent le plus. Mais, du point de vue sociologique et politique, ce sont les petites qui pèsent davantage. Ce sont elles qui déterminent les expériences sociales, les colères et les indignations.
Aus wirtschaftlicher Sicht sind es die großen Ungleichheiten, die am meisten zählen. Aber aus soziologischer und politischer Sicht sind es die kleinen, die schwerer wiegen. Sie sind es, die soziale Erfahrungen, Wut und Empörung bestimmen.
Zentral sei hier die Beobachtung, dass Menschen sich zur Selbstverortung in erster Linie auf ihr unmittelbares Umfeld – also auf Nachbarn, Kollegen, Verwandte, Bekannte und so weiter – beziehen und sich mit diesem permanent und alltäglich vergleichen. Dazu komme nahezu jedes Kriterium in Frage: Wohlstand, beruflicher Status, Konsumgewohnheiten, Lebenschancen, Zugang zu Bildung, Gesundheit, Kultur und noch etliche mehr. Dabei orientierten sich die Menschen an gesellschaftlich vorherrschenden Deutungsmustern, Gerechtigkeitsmaßstäben und Moralvorstellungen. Soziale Ungleichheit sei somit grundsätzlich ein multidimensionales und lebensweltliches Phänomen, dessen Wahrnehmung maßgeblich von gesellschaftlichen Normen und Werten geprägt ist. Für die Akzeptanz von sozialer Ungleichheit komme es demnach weniger auf deren objektives Ausmaß an, als auf ihre Formen sowie ihre Einbettung in gesellschaftliche Aushandlungsprozesse der Kritik und der Rechtfertigung (S. 14):
[...] l’amplitude des inégalités a moins d’importance que leur nature, la manière dont elles nous conduisent à nous définir et à définir les autres, la formation du sentiment d’injustice, les stratégies déployées pour les combattre et souvent pour les défendre.
[...] das Ausmaß der Ungleichheiten ist weniger wichtig als ihre Formen, die Art und Weise, wie sie uns dazu bringen, uns selbst und andere zu definieren, die Entstehung des Ungerechtigkeitsgefühls, die Strategien, die zu ihrer Bekämpfung und oft auch zu ihrer Verteidigung eingesetzt werden.
Die gesellschaftlichen Verhältnisse, die subjektive Erfahrung und die normativen Diskurse bildeten das dreidimensionale Raster, an dem sich die Analyse zu orientieren habe. Alle drei fügen sich bei Dubet zu einer „Ungleichheitsordnung“ (régime d’inégalités) zusammen, die einer Gesellschaftsordnung ihr Gepräge gibt.
Diese theoretischen Prämissen bilden den Ausgangspunkt von Dubets Populismusanalyse, die in drei Schritten erfolgt. In den ersten beiden Kapiteln stellt er den Wandel der Ungleichheitsordnung von der Ungleichheit der Klassen (inégalités de classe), die kennzeichnend für die industrielle Gesellschaft gewesen sei, zur heutigen „multiplen Ungleichheit“ (inégalités multiples) dar. Mit dieser Verschiebung der Koordinaten sozialer Ungleichheit habe sich, so schließt Dubet an, auch deren subjektive Erfahrung grundlegend verändert: Sie sei heute stärker individualisiert und fragmentiert. In Kapitel 4 schließlich widmet sich Dubet den damit einhergehenden „düsteren Leidenschaften“ (passions tristes) wie Wut, Empörung und Ressentiment, deren ungenügende politische Artikulation und Repräsentation er als Ursache für den Erfolg des Populismus in Anschlag bringt.
Von der Ungleichheit der Klassen zur „multiplen Ungleichheit“
Dubets Darstellung der modernen Industriegesellschaft versöhnt Marx und Tocqueville: Die industrielle Gesellschaft sei zwar in der Tat in relativ feste und homogene soziale Klassen unterteilt gewesen, jedoch habe sich der Abstand zwischen diesen im Laufe der Zeit stetig verringert. Kennzeichnend sei vor allem gewesen, dass die (teils gewaltige) soziale Ungleichheit durch die Klassenzugehörigkeit „gebrochen“ wurde. Abhängig von ihrer Stellung in der kapitalistischen Arbeitsteilung wurden den Individuen demnach ähnliche Lebensbedingungen und -chancen zuteil, sodass ihr sozialer Status je nach Beschäftigung weitgehend homogen war. Damit stellten soziale Ungleichheit und Ungerechtigkeit grundsätzlich eine kollektive Erfahrung dar, die zudem in sinn- und identitätsstiftende Narrative, insbesondere marxistischer Provenienz, eingebettet gewesen seien. Solche Deutungsmuster machten demnach Ursachen und Verursacher von sozialer Ungleichheit sicht- und somit angreifbar und ermöglichten dadurch politische Mobilisierung. Im Kampf für soziale Gerechtigkeit seien die Arbeiter ihrer gemeinsamen Interessen und ihrer kollektiven Identität gewahr geworden, womit sie Würde erlangten und Solidarität erfuhren. Unter dem Druck von Arbeits- und sozialen Kämpfen habe im Übrigen ab dem späten 19. Jahrhundert ein langfristiger Trend zur Verringerung von Armut und Ungleichheit eingesetzt, der in den Wohlfahrtsstaat und die Massenkonsumgesellschaft der Nachkriegszeit („Trente Glorieuses“) kulminiert sei. Für eine Weile sei das (sozial-)demokratische Ideal der gleichen Teilhabe und Lebenschancen in einer Gesellschaft mit überschaubaren Einkommens- und Statusunterschieden zum Greifen nahe erschienen.
Diese „Ordnung der Ungleichheit der Klassen“ (régime des inégalités de classe) sei zwischen den 1970er- und den 1990er-Jahren ins Wanken geraten. Globalisierung, der Aufstieg der Dienstleistungsökonomie und der „neue Geist des Kapitalismus“ (Boltanski & Chiapello) zogen einen tiefgreifenden Wandel der Arbeitswelt nach sich – hier folgt Dubet den bekannten Beobachtungen. Deregulierung des Arbeitsmarktes, Zunahme atypischer Beschäftigungsformen, Flexibilisierung des Produktionsprozesses und Fragmentierung der Belegschaften führten zur Zersplitterung der sozialen Klassen – insbesondere der Arbeiterschaft – in eine Vielzahl kleinerer Gruppen mit unterschiedlichen Status, Interessen und Identitäten. Ähnliche Ausdifferenzierungsprozesse ließen sich zur gleichen Zeit etwa im Bildungsbereich beobachten mit der immer weiteren Auffächerung des Bildungsangebots entlang einer subtilen Rangordnung von Abschlüssen, Fächern und Hochschulen, aber auch im Bereich des Konsums und der Lebensstile mit der kapitalistischen Ausrichtung auf gestiegene Distinktions- und Individualitätsbedürfnisse.
Individualisierung der Ungleichheit und die Forderung nach Chancengleichheit
Im Mittelpunkt von Dubets Argumentation steht nun die Annahme, dass dieser Wandel von der industriellen zur Dienstleistungsgesellschaft respektive der Klassengesellschaft zur „Gesellschaft der Singularität“ (Rosanvallon)[7] mit einer weitreichenden Veränderung der Formen und Wahrnehmung sozialer Ungleichheit einhergegangen sei. Die Ursache hierfür findet er zum einen im Zerfallen der wenigen sozialen Klassen in eine immer größere Anzahl verschiedener, sich teilweise überlappender gesellschaftlicher Gruppen, die sich nicht mehr allein klassenökonomisch, sondern jeweils durch einzelne Merkmale wie etwa berufliche Tätigkeit, Beschäftigungsstatus, Alter, Geschlecht, Sexualität, ethnische Herkunft, Religion, Wohnort, Behinderung definierten.[8] Dadurch seien ebenso viele potenzielle Gründe für soziale Benachteiligung (oder Bevorteilung) ins kollektive Bewusstsein getreten. Da solche Gruppen jedoch keine annähernd so umfassende soziale Identität anbieten könnten wie früher die Klassenzugehörigkeit, blieben sie sowohl einander fremd, als auch in sich heterogen.
Zum anderen haben sich Dubet zufolge die relevanten Vergleichskriterien und damit die Dimensionen und Ausprägungen sozialer Ungleichheit vermehrt. Wo früher Wohlstand, eventuell auch Bildungschancen und allenfalls noch Konsumgewohnheiten und Lebensstile[9] die Koordinaten sozialer Ungleichheit bildeten, lasse sie sich heute an unzähligen weiteren Kriterien festmachen (S. 31):
On peut mesurer les inégalités de revenu, de patrimoine, de consommation, de santé, d’accès aux études, de pratiques culturelles et de loisirs, de temps consacré à la famille, de mobilité spatiale, sociale ou professionnelle, sans oublier le risque d’être discriminé, le plafond de verre, les inégalités en matière de sécurité, d’environnement ou de bonheur.
Ungleichheiten lassen sich in Bezug auf Einkommen, Vermögen, Konsum, Gesundheit, Zugang zur Hochschulbildung, kulturelle und Freizeitaktivitäten, Zeit für die Familie, räumliche, soziale oder berufliche Mobilität messen, nicht zu vergessen die Gefahr der Diskriminierung, die gläserne Decke, Ungleichheiten in Bezug auf Sicherheit, Umwelt oder Glück.
Erschwerend – doch für den heutigen Charakter sozialer Ungleichheit entscheidend – komme hinzu, dass diese einzelnen Dimensionen nicht länger miteinander korrelierten, sondern bei jedem Individuum unterschiedlich ausgeprägt seien. Damit werde jede und jeder Einzelne dazu animiert, sich situationsabhängig mit wechselnden gesellschaftlichen Gruppen zu identifizieren und sich dabei unter unzähligen Gesichtspunkten mit jeder und jedem zu vergleichen. Man werde dazu angetrieben, sich unablässig, „in seiner Eigenschaft als“ (en tant que), also im Hinblick auf soziale Stellung, Identität, Werdegang, Lebensumfeld usw. mit jenen zu messen, die einem „am nächsten“ (au plus près) stehen. Derart durch das Prisma singulärer Merkmale gebrochen, werde soziale Ungleichheit heute als individuelle Diskriminierung gedeutet und angeprangert – wenn sie nicht als persönliches Schicksal und Versagen passiv erlitten werde. Diese Individualisierung und die „Atomisierung des Frusts“ (atomisation [des] frustrations, S. 54) ließen allenfalls gruppen- oder problemspezifische Mobilisierungen und Forderungen zu, verhinderten aber den gemeinsamen Kampf für soziale Gerechtigkeit – die viel beschworene convergence des luttes. Das Ziel einer gerecht(er)en Gesellschaft gehe vielmehr in den Rufen nach rechtlichen Sanktionen und Maßnahmen gegen Diskriminierung unter; Forderungen nach sozialer Gerechtigkeit würden vor allem in Kategorien der Anerkennung artikuliert, als Einfordern des Respekts, der in einer demokratischen Gesellschaft jedem Einzelnen zusteht.
Begleitet und befördert werde die Fragmentierung sozialer Kämpfe zudem durch eine Sozialpolitik, die den unzähligen „kleinen Ungleichheiten“ mit gezielten Programmen und spezifischen Maßnahmen abzuhelfen versuche. Unter den Bedingungen des „Wettbewerbs der Ungleichheiten“ (concurrence entre les inégalités, S. 35) werde das Ziel, den Abstand zwischen sozialen Stellungen durch Erringung sozialer Rechte, Umverteilung, Sozialversicherung und öffentliche Dienstleistungen zu verringern, durch die Förderung der (individuellen) sozialen Mobilität verdrängt. Darin schlüge sich ein normativer Paradigmenwechsel nieder: Weg von der „Gleichheit der sozialen Positionen“ (égalité des places), die die industrielle Klassengesellschaft der Nachkriegszeit gekennzeichnet hatte, hin zur neoliberalen Chancengleichheit (S. 19)[10], die, wie Dubet nicht müde wird zu betonen, weniger darauf abziele, soziale Ungleichheit zu verringern, als „gerechte Ungleichheiten“ im Rahmen eines fairen meritokratischen Wettbewerbs zu erzeugen (S. 58).
Dass die alten egalitären Wertvorstellungen ihre Wirkmächtigkeit gleichwohl nicht gänzlich eingebüßt haben, zeigt sich Dubet zufolge allerdings in einem weit verbreiteten Unbehagen an der neuen Ordnung multipler Ungleichheit. Mangels angemessener intellektueller Artikulation und politischer Repräsentation gerinne dieses Unbehagen jedoch in „düsteren Leidenschaften“ (passions tristes) der Wut, Empörung und des Ressentiments gegen die „Elite“, die „Migranten“ und Minderheiten aller Art, die den Nährboden des Populismus bildeten.
Populismus als Kehrseite der Ordnung multipler Ungleichheit
Den Bogen von der Gesellschaftsdiagnose zum Populismus schlägt Dubet – von der Einleitung einmal abgesehen – erst im vierten und letzten Kapitel. Darin versucht er zu verstehen, warum das individuelle Leiden und die Kritik an den neuen Formen sozialer Ungleichheit nicht linken Kräften zugutekommen, sondern vielmehr Populisten, die,
[p]lutôt que de combattre les injustices qu’ils condamnent, [...] s’indignent et dénoncent les élites, l’oligarchie, les pauvres et les étrangers.
[...] sich empören und die Elite, die Oligarchie, die Armen und die Ausländer anprangern, anstatt die Ungerechtigkeiten zu bekämpfen, die sie verurteilen.
– wenn sie nicht, wie in manchen Ländern, mit ihrer Politik diese Schieflagen noch weiter verschärfen (S. 71).
Obwohl Dubet damit den Kern des Problems trifft, nämlich die fehlgeleitete politische Bearbeitung gesellschaftlicher Missstände und Unzufriedenheit, fällt sein Erklärungsversuch durchwachsen aus. Das liegt zum einen an seiner überaus knappen, ja dürftigen Bestimmung des Begriffs „Populismus“. Dubet belässt es bei einem Hinweis auf die lange Geschichte und die Heterogenität des Phänomens – von den russischen Populisten des 19. Jahrhunderts über die faschistischen Parteien der 1930er-Jahre bis zu den lateinamerikanischen Ausprägungen des Populismus – und der Feststellung, dass „Populismen von links und von rechts“ heute trotz sehr unterschiedlicher ökonomischer und ideologischer Ausgangsbedingungen in ganz Europa verbreitet sind. Bei seiner Definition orientiert er sich letztendlich – entgegen Durkheims Warnung vor den sogenannten „Vorbegriffen“ (prénotions) – am allgemeinen Sprachgebrauch (S. 92):
[...] comme la notion de populisme s’est imposée, faisons avec, pour désigner un style politique assez nettement identifiable, en dépit de tout ce qui distingue les différents partis et mouvements populistes.
[...] da sich der Begriff Populismus durchgesetzt hat, finden wir uns damit ab und bezeichnen wir damit einen Politikstil, der trotz aller Unterschiede zwischen den verschiedenen populistischen Parteien und Bewegungen ziemlich klar identifizierbar ist.
Sicher kann populistischen Kräften eine gewisse „Familienähnlichkeit“ – etwa dichotomes Weltbild, Beschwörung des „Volkes“, aggressive Rhetorik – nicht abgesprochen werden. Doch blendet ein derart unkritisches und undifferenziertes Vorgehen wichtige Fragen aus: Wer verwendet den Begriff und warum? Lassen sich derart diverse Bewegungen und Parteien (inhaltlich, aber auch soziologisch) auf einen Begriff bringen? Warum sollten liberale Kräfte vor einem solchen „politischen Stil“ gefeit sein?[11] Vor allem die fehlende Unterscheidung zwischen Links- und Rechtspopulismus ist problematisch, suggeriert sie doch, dass sich die verschiedenen Spielarten des Populismus auf die gleichen Ursachen zurückführen ließen und dass ideologische und programmatische Unterschiede für deren Verständnis nachrangig seien.
Der Vorwurf der Eindimensionalität trifft ebenso auf Dubets Erklärungsansatz zu. Für den Aufstieg des Populismus nennt er zwar verschiedene Erklärungen: den Wandel der Öffentlichkeit mit der digitalen Debattenkultur, das Bedürfnis nach Ordnung und Orientierung angesichts unübersichtlicher gesellschaftlicher Verhältnisse, sozialpsychologische Abwehrmechanismen gegen die Angst vor sozialem Abstieg, die Intransparenz einer zunehmend fragmentierten Sozialpolitik, das fehlende intellektuelle und politische Angebot im Kampf gegen Ungleichheit. All diese (Teil-)Erklärungen verweisen jedoch letztendlich auf die neue „Ordnung multipler Ungleichheit“ als wesentliche Triebkraft des Populismus. Wider besseres Wissen (S. 89) –
[i]l serait absurde d’expliquer toute la vie politique par les inégalités sociales et l’expérience des inégalités.
[e]s wäre absurd, das gesamte politische Leben durch soziale Ungleichheiten und die Erfahrung von Ungleichheiten zu erklären.
– erweist sich Dubets Erklärungsversuch somit am Ende doch als monokausal. Unklar bleibt außerdem, inwiefern der postulierte Zusammenhang zwischen dem Unbehagen an der Ordnung multipler Ungleichheit und dem Aufstieg des Populismus auch auf andere Länder (zum Beispiel Großbritannien oder die USA) zutrifft, die die schon von Tocqueville beobachtete französische Liebe zur Gleichheit (passion de l’égalité) nicht teilen.
Indem er den Populismus allein durch die „soziologische Brille“ als Symptom für (unbearbeitete) gesellschaftliche Spannungen und Konflikte behandelt, blendet Dubet zudem die Autonomie des Politischen aus. Als genuin politisches Phänomen sollte der Populismus indes – zumindest auch – im Lichte spezifisch politischer und ideologischer Entwicklungen betrachtet werden, wie beispielsweise der „Postdemokratie“, der Entpolitisierung des Politischen beziehungsweise „Post-Politik“, der Krise der politischen Parteien und der Repräsentation, der Erosion der Demokratie oder des Wandels von Staatlichkeit – um nur einige, mittlerweile nicht mehr ganz neue politikwissenschaftliche Zeitdiagnosen und Stichwörter zu nennen.
Im Übrigen ließe sich der Spieß auch umdrehen und im Sinne einer kritischen Sozialwissenschaft nach den politischen und ideologischen Hintergründen der Ordnung multipler Ungleichheit fragen. Wie kam diese Ordnung in die Welt? Welche (wirtschafts-, steuer-, sozial-)politischen Reformen haben das Ende der Ordnung der (abnehmenden) Ungleichheit der Klassen besiegelt? Welche ideologischen Verschiebungen und politische „Blockbildung“ (im Sinne Gramscis) haben den Boden für die Individualisierung von Ungleichheit und das Primat der meritokratischen Chancengleichheit vorbereitet?[12] Wem nützen die Fixierung auf die „kleinen“ alltäglichen Abwertungserfahrungen und der „Wettbewerb der Ungleichheiten“? Wer profitiert von der Schrumpfung des politischen Angebots auf die Alternative zwischen (neo-)liberaler Mitte und populistischen Rändern? Wird eine Beschreibung des Populismus als affektgetriebene und irrationale Bewegung dem Phänomen überhaupt gerecht? Sorgt gerade eine solche Charakterisierung nicht dafür, dass die berechtigten Sorgen und Interessen derjenigen kein Gehör finden, die sich als die großen Verlierer der neoliberalen Ordnung multipler Ungleichheit sehen – und es möglicherweise auch sind?[13]
Fazit
Dubets größtes Verdienst besteht darin, die Frage nach der Bedeutung von Gleichheit für und in demokratischen Gesellschaften in den Vordergrund zu rücken – im erfrischenden Kontrast zur derzeitigen Konjunktur von Themen wie Identität und Singularität. Damit liefert er einen weiteren Beleg für den anhaltenden Stellenwert des Themas im französischen sozialwissenschaftlichen Diskurs. Trotz mancher, der Knappheit der Darstellung geschuldeter Überzeichnungen leuchtet seine Diagnose eines Wandels der Ungleichheitsordnung – von der Ungleichheit der Klassen zur individuellen, von der „Gleichheit der sozialen Stellungen“ zur Chancengleichheit – durchaus ein. Auch gelingt es ihm, die noch junge und schwer zu fassende Ordnung multipler Ungleichheit in seinen unterschiedlichen Facetten einzufangen.
Doch so sehr Dubets Gesellschaftsanalyse beeindruckt, kann er die von ihm geweckten Erwartungen nur teilweise erfüllen. Seine Analyse des Populismus als politischer Ausdruck des Unbehagens an der Ordnung multipler Ungleichheit erweist sich zwar als ungleich subtiler und plausibler als alleinige Verweise auf das wachsende Ausmaß der ökonomischen Ungleichheit oder kulturell-lebensweltliche Gegensätze, vermag aber letztendlich nicht wirklich zu überzeugen. Denn so differenziert und anschlussfähig Dubets Verständnis von sozialer Ungleichheit ist, so verkürzt und vor allem unkritisch bleibt sein Populismusbegriff.
Fußnoten
- David Goodhart, The Road to Somewhere: The Populist Revolt and the Future of Politics, London 2017.
- Vgl. dazu für den französischen Fall zu Beispiel Pascal Perrineau: Cette France de gauche qui vote FN. Paris 2017; Yann Algan / Elizabeth Beasley / Daniel Cohen / Martial Foucault, Les origines du populisme. Enquête sur un schisme politique et social, Paris 2019; einschlägig für die internationale Diskussion ist Dani Rodrik, Populism and the economics of globalization, in: Journal of International Business Policy 1 (2018), S. 12–33; für den deutschsprachigen Diskurs hat Philip Manow eine Synopsis geliefert: Die politische Ökonomie des Populismus, Berlin 2018.
- Vgl. François Dubet / Danilo Martuccelli, À l'école: Sociologie de l'expérience scolaire, Paris 1996; François Dubet, Faits d'école, Paris 2008; François Dubet / Marie Duru-Bellat / Antoine Vérétout, Les Sociétés et leurs écoles: Emprise du diplôme et cohésion sociale, Paris 2010; François Dubet, La Galère: Jeunes en survie, Paris 1987; François Dubet / Didier Lapeyronnie, Im Aus der Vorstädte: Der Zerfall der demokratischen Gesellschaft, Stuttgart 1994; François Dubet / Joël Zaffran, Trois Jeunesses: La révolte, la galère, l’émeute, Lormont 2018; François Dubet, Ungerechtigkeiten: Zum subjektiven Ungerechtigkeitsempfinden am Arbeitsplatz, Hamburg 2008.
- Vgl. Francois Dubet, Le travail des sociétés, Paris 2009; François Dubet, Les places et les chances: Repenser la justice sociale, Paris 2010; Francois Dubet, La Préférence pour l'inégalité: Comprendre la crise des solidarités, Paris 2014; Francois Dubet, Ce qui nous unit: Discriminations, égalité et reconnaissance, Paris 2016.
- Vgl. natürlich vor allem Thomas Piketty, Das Kapital im 21. Jahrhundert, München 2013 und Branko Milanović, Die ungleiche Welt. Migration, das eine Prozent und die Zukunft der Mittelschicht, Berlin 2016.
- Vgl. Pierre Bourdieu, Position und Perspektive, in: ders. et al., Das Elend der Welt. Zeugnisse und Diagnosen alltäglichen Leidens an der Gesellschaft, Konstanz 1997, S. 19: „[I]ndem man die große Not zum ausschließlichen Maß aller Formen der Not erhebt, versagt man sich, einen ganzen Teil der Leiden wahrzunehmen und zu verstehen, die für eine soziale Ordnung charakteristisch sind, die gewiß die große Not zurückgedrängt hat (allerdings weniger als zuweilen behauptet wird), im Zuge ihrer Ausdifferenzierung aber auch vermehrt soziale Räume (spezifische Felder und Sub-Felder) und damit Bedingungen geschaffen hat, die eine beispiellose Entwicklung aller Formen kleiner Nöte begünstigt haben.“
- Pierre Rosanvallon, Die Gesellschaft der Gleichen, Hamburg 2013, S. 309–318.
- Dubet verwendet den Gruppenbegriff ausdrücklich: „Les groupes touchés par les inégalités se sont multipliés“ (S. 31), „Die von Ungleichheit betroffenen Gruppen haben sich vermehrt“.
- Die Erschließung von Bildung und Lebensstil als Dimensionen sozialer Ungleichheit war in Frankreich bekanntlich maßgeblich das Verdienst Pierre Bourdieus; vgl. insbesondere ders. / Jean-Claude Passeron, Les héritiers. Les étudiants et la culture, Paris 1964; ders., La distinction: Critique sociale du jugement, Paris 1979.
- Zur Unterscheidung zwischen „Gleichheit der sozialen Positionen“ und Chancengleichheit vgl. François Dubet, Les places et les chances. Repenser la justice sociale, Paris 2010.
- Vgl. dazu die provokante These von Bernd Stegemann, Das Gespenst des Populismus: Ein Essay zur politischen Dramaturgie, Berlin 2017.
- Vgl. dazu die jüngst auf Deutsch erschienene Studie von Grégoire Chamayou, Die unregierbare Gesellschaft – Eine Genealogie des autoritären Liberalismus, Berlin 2019.
- Vgl. dazu, mit Blick auf die Gelbwesten: Guillaume Paoli, Soziale Gelbsucht, Berlin 2019.
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Andreas Häckermann.
Kategorien: Soziale Ungleichheit Demokratie Affekte / Emotionen Gesellschaftstheorie
Zur PDF-Datei dieses Artikels im Social Science Open Access Repository (SSOAR) der GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gelangen Sie hier.
Empfehlungen
Die Unwahrscheinlichkeit der Spaltung
Rezension zu „Die gespaltene Gesellschaft“ von Jürgen Kaube und André Kieserling
Vom Generalgefühl der Überforderung
Rezension zu „Triggerpunkte. Konsens und Konflikt in der Gegenwartsgesellschaft“ von Steffen Mau, Thomas Lux und Linus Westheuser
Einladung zur Enthemmung
Rezension zu „Zerstörungslust. Elemente des demokratischen Faschismus“ von Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey