Jens Bisky | Rezension | 20.11.2025
Einladung zur Enthemmung
Rezension zu „Zerstörungslust. Elemente des demokratischen Faschismus“ von Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey
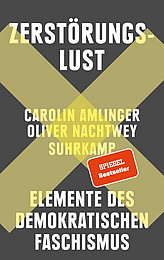
Manche Leute wollen die Welt einfach brennen sehen. Sie spüren freudige Erregung, wenn über Naturkatastrophen in fernen Ländern berichtet wird; sie fantasieren mit Wonne von der Auslöschung des größten Teils der Menschheit und dem Neubeginn, den daraufhin die kleine Gruppe der Überlebenden unternimmt; sie langweilen sich, wenn nicht Chaos herrscht; sie glauben, dass die bestehende Gesellschaft in Schutt und Asche gelegt werden sollte. Einer von ihnen ist Kevin Roberts, Präsident der Heritage Foundation und einer der führenden Köpfe hinter „Project 2025“. Er bezeichnete 2024 die Institutionen der liberalen Demokratie als „dekadent und wurzellos“. Es sei falsch, sie zu reformieren. Damit Amerika wieder aufblühen könne, müssten sie verbrannt werden (S. 7).
Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey zitieren diese Beschwörung eines reinigenden Feuers in Washington zu Beginn ihres neuen Buches, das destruktive Sehnsüchte, Vernichtungswillen und andere Varianten der titelgebenden „Zerstörungslust“ untersucht, um die Krise der liberalen Demokratien und die andauernden Triumphe postfaschistischer Bewegungen besser zu verstehen. Sie greifen dabei unter anderem auf das von Michael Bang Petersen, Mathias Osmundsen und Kevin Arceneaux entwickelte Konzept des „Need for Chaos“ zurück, das eine destruktive Einstellung im Spannungsfeld von sozialer Marginalisierung und Statusorientierung beschreibt.[1] Vor allem aber aktualisieren Amlinger und Nachtwey wie schon in ihrer Studie Gekränkte Freiheit ältere Überlegungen der Kritischen Theorie.[2] Diesmal folgen sie in erster Linie Erich Fromms Thesen zur „Furcht vor der Freiheit“ und der aus dieser resultierenden Flucht ins Destruktive und Autoritäre.
Das Ziel der Destruktivität, schrieb Fromm in seinem erstmals 1941 unter dem Titel Escape from Freedom im US-amerikanischen Exil erschienenen Buch, sei die „Vernichtung ihres Objektes“: „Ich kann dem Gefühl der Ohnmacht gegenüber der Welt außerhalb von mir dadurch entrinnen, daß ich sie zerstöre. […] Die Zerstörung der Welt ist der letzte, verzweifelte Versuch, mich davor zu retten, von ihr zermalmt zu werden.“[3] Wie es um die destruktiven Tendenzen der Gegenwart bestellt ist, haben Amlinger und Nachtwey in einem eigenen Forschungsprojekt untersucht, das den Kern ihres Buches bildet. Im Herbst 2024 beantworteten 2995 Personen aus Deutschland Fragen zu ihren sozidemografischen Merkmalen und politischen Einstellungen. Die folgenden drei Items dienten dabei der Messung destruktiver Tendenzen:
„1. Wenn man gute Gründe hat, ist auch gewalttätiges Verhalten gerechtfertigt.
2. Ich denke, diese Gesellschaft sollte in Schutt und Asche gelegt werden.
3. Wenn ich an unsere politischen und sozialen Institutionen denke, kann ich nicht anders, als zu denken: ,Sollen sie doch einfach alle untergehen.‘“ (S. 195)
Die Ergebnisse des Online-Panels lassen sich nicht umstandslos auf die Gesamtbevölkerung übertragen, ergeben jedoch ein aufschlussreiches Bild: Gut 60 Prozent der Befragten fallen demnach in die Kategorie der Nicht-Destruktiven, 27,6 Prozent gehören zu den Niedrig-Destruktiven und 12,5 Prozent erwiesen sich als mittel- oder hoch-destruktiv. Auffällig ist, dass es sich bei den Letztgenannten überwiegend um junge Männer handelt, wohingegen Einkommen und Bildung nach Auskunft der Autoren „keinen robusten Einfluss“ haben (S. 197). Was die parteipolitischen Präferenzen betrifft, gibt ein beachtlicher Teil der Gruppe zwar an, CDU oder SPD wählen zu wollen, doch finden sich die meisten Destruktiven in dieser Stichprobe unter den Anhängern der AfD (S. 199).
Ergänzend zur Umfrage wurden außerdem 41 problemzentrierte Interviews mit Personen geführt, die aufgrund ihrer Antworten als hoch-destruktiv eingeschätzt wurden, sich auf Anfragen als Unterstützer der AfD gemeldet hatten oder sich in einem rechtslibertären Verein engagierten. Einigen Personen und ihren aus den Interviews rekonstruierten Lebensgeschichten begegnet man im Zuge der Lektüre immer wieder; sie veranschaulichen die Argumentation des Buches. Dieses will zunächst und vor allem zeigen, dass „Destruktivität eine spezifische Dimension der faschistischen Drift sein“ kann (S. 201), die nicht mit Autoritarismus, Unterwürfigkeit oder Konventionalismus verrechnet werden sollte, auch wenn sie oft mit diesen einhergeht. Sie verbindet verschiedene rechte, gegen die Liberalität der Demokratie gerichtete Strömungen, vor allem die Gemeinschaftsversessenen und die Libertären, die auf den ersten Blick wenig gemein haben. Sie ist, einer einprägsamen Formulierung der Autoren zufolge, gewissermaßen „der Beschleunigungsstreifen auf einer mehrspurigen Autobahn der Radikalisierung“ (S. 10).
Die Logik der Unvernunft
Die Zerstörungslust ins Zentrum der Analyse zu rücken, erweist sich als produktiv und scheint geeignet, Diskussionen über das scheinbar unaufhaltsame, zumindest bislang nicht aufgehaltene Erstarken des Rechtspopulismus und des Postfaschismus zu beleben. In den faschistischen Bewegungen der 1920er- und 1930er-Jahre sicherte Gewalt den inneren Zusammenhalt der aufstrebenden totalitären Bewegungen, vor allem in den Kampfbünden, sie war entscheidendes Propagandainstrument und bevorzugtes Mittel zur Problemlösung. Den heutigen Faschisten hingegen, so der Historiker Sven Reichardt, fehlten sowohl „der ausufernde Paramilitarismus“ als auch „der aus dem Ersten Weltkrieg gespeiste Gewalt- und Totenkult“.[4] An deren Stelle, so lässt sich mit Amlinger und Nachtwey vermuten, ist nun die Zerstörungslust getreten. Der Appell an destruktive Affekte birgt das Versprechen der großen Enthemmung in sich, er lockt mit der Lizenz, sich über Konventionen, Moral und Recht hinweg- und zivilisatorische Normen hintanzusetzen. Das blutige Showevent des Sturms auf das Kapitol in Washington im Januar 2021,[5] die martialische Inszenierung der Deportationen durch die vermummten Kräfte der US-Einwanderungs- und Zollbehörde ICE oder die ebenso regelmäßig wie lautstark vorgetragenen Drohgebärden und Abrechnungsfantasien hiesiger AfD-Politiker:innen – all das diente und dient so gesehen der politischen Bewirtschaftung von Zerstörungslust.
Weder Destruktivität noch deren Politisierung sind historisch neue Phänomene. Nicht umsonst steht am Beginn des Buches ein Zitat aus Ernst Jüngers Aufsatz „,Nationalismus‘ und Nationalismus“, einer 1929 für die Wochenschrift Das Tage-Buch verfassten Kampfansage an Bürgertum, Bürgerlichkeit und Republik. In seiner Antwort auf Jünger diagnostizierte der liberale Publizist Leopold Schwarzschild damals „Heroismus aus Langeweile“.[6] Amlinger und Nachtwey dagegen verstehen die destruktiven Affekte der Gegenwart als regressive Reaktion auf „Paradoxien und Widersprüche moderner, hochindividualisierter Gesellschaften“ (S. 26).
Eine solche im „Dunkel des gelebten Augenblicks“ (Ernst Bloch) formulierte Analyse ist ein ebenso notwendiges wie riskantes Unterfangen. Dass die von ihnen vorgelegte Faschismusdiagnose im Handgemenge überzeugt, liegt vor allem daran, dass die Beiden mit Umsicht und Neugier vorgehen und verschiedene Deutungen heranziehen. Weil sie um den Wert früherer Analysen des Postfaschismus wissen, greifen sie neben Fromm auch auf Arbeiten und Überlegungen zahlreicher weiterer Theoretiker zurück, darunter Theodor Geiger („Panik im Mittelstand“), Walter Benjamin, Theodor W. Adorno, Seymour Martin Lipset und Arlie Russell Hochschild. Vor allem mit Hochschild verbindet sie die Absicht, der Logik der Unvernunft auf die Spur zu kommen.[7]
Zu diesem Zweck suchen Amlinger und Nachtwey in der Gruppe der als hoch-destruktiv eingeschätzten Interviewten drei unterschiedliche Typen zu erkennen: „die Erneuerer (sie wollen liberale Institutionen erschüttern, um traditionelle Hierarchien wiederaufzubauen), die Zerstörer (sie glauben nicht an Erneuerung und sehen die Zerstörung des Systems als Selbstzweck) und die Libertär-Autoritären (sie streben aus ideologischen Gründen nach einer Abschaffung des regulierenden Staates und wollen ihn durch autoritäre Alternativen ersetzen)“ (S. 19 f.).
Interessanter als diese vertretbare, aber wenig fruchtbare Einteilung sind die von Amlinger und Nachtwey rekonstruierten Lebensgeschichten und Einstellungen der von ihnen Befragten, wie die von Fabian Leonhard, der Biochemie studiert. Er „spricht überlegt und kontrolliert“ (S. 236), legt großen Wert auf Rationalität, folgt vulgärdarwinistischen Kalkülen und zeigt eine besondere Faszination für Krieg, Töten und Foltern. Darüber hat er viel nachgedacht und dazu auch viel zu sagen. Es scheint ihm unvernünftig, unterlegene Konkurrenten zu foltern, das würde nur zu emotionalen Aufwallungen führen. Sei Folter nicht zu vermeiden, müsse sie bestmöglich durchgeführt werden. In der SS seien beispielsweise Leute gewesen, die nur ihre Arbeit getan hätten: „Man konnte auch in der SS etwas ,Gutes‘ vollbringen, und zwar indem man das Ganze ,sauber‘, ,korrekt‘ und ,ehrenvoll‘ machte.“ (S. 236). Da es zu viele Menschen auf der Erde gebe und diese nicht alle den gleichen Lebensstandard erreichen könnten, müsse man am Ende – wie im Fall von Bakterien – einen Teil der Population ausrotten. Der Student mit seiner Nekrophilie, der Neigung zum Leblosen als dem Kontrollier- und Beherrschbaren, ist sozial gut integriert, gehört zur Freiwilligen Feuerwehr. Er scheint der ideale Adressat für Forderungen nach „wohltemperierter Grausamkeit“ (Björn Höcke).
Im Gegensatz dazu hat Manfred Gruber, in Südwestdeutschland geboren, 57 Jahre alt, sein Leben der Hilfe für andere gewidmet und dabei sehr vieles richtig gemacht. Er war Maschinenschlosser, außerdem Mitglied der IG Metall. Das große Stahlunternehmen, für das er arbeitete, verließ er, bevor es massenhaft Beschäftigte entließ. Nach Jahren auf Montage folgte er seinem Wunsch, etwas „Soziales“ zu machen und begann, Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen zu betreuen. In den Pandemiejahren half er im Pflegeheim und pflegte zugleich seine Mutter. Dann erkrankte er selbst nach der dritten Impfung an Long Covid. Seitdem, so sagt er, sei er ein anderer Mensch. Seine Frau, „als nichtweißes ,Besatzungskind‘ im Kinderheim aufgewachsen“ (S. 27), eilte 2021 ins überflutete Ahrtal, um die Menschen dort zu unterstützen. Erschöpft und krank kehrte sie heim, „mit nur noch zehn Prozent Herzleistung. Die Berufsgenossenschaft erklärte sich für unzuständig, die Krankenkasse übernahm die Reha nicht. Sie habe ja ohnehin nur noch ein halbes Jahr zu leben.“ (S. 28) In diesem Punkt irrten die Zuständigen, Frau Gruber lebt heute mit Erwerbsminderungsrente. Ihr Mann glaubt, dass sich alles verschlechtert, dass man ihn verraten habe – und wählt – wie 30 Prozent in seiner Gemeinde – die AfD. Seinen Lebensstandard kann er nur schwer halten, aber die „Araber-Clans“, glaubt er, führen auf Staatskosten Ferrari (S. 28). Manfred Gruber erlebt Politik als Verhängnis, sozialen Wandel als Abstieg und Verlust von Zusammenhalt, begleitet von immer neuen Verboten, Vorschriften, Pflichten.
Wie man richtig lebt, weiß Anette Kowalski, Mitte 50, Sozialpädagogin, nebenberuflich auch Fitnesstrainerin: so wie sie. Kowalski kam kurz vor dem Mauerfall mit ihrem Mann, dem gemeinsamen Kind und sonst fast nichts aus Polen in die Bundesrepublik – und hat sich durchgebissen. Sie blicke, heißt es im Buch, „wie eine Sozialingenieurin auf die Welt, die Gesellschaft gemäß rationalen Maximen plant“ (S. 152). Dabei folgt sie der Maxime „Jedem das Seine“. Dass diese Worte am Tor zum KZ Buchenwald standen, weiß sie und kokettiert damit. Sie engagiert sich in einem rechtslibertären Verein gegen Gleichmacherei, befürchtet den Untergang Deutschlands, weil so viele hier „verhätschelt“ würden. Sie wünscht sich einen wie Javier „Kettensäge“ Milei.
Verluste, Blockaden, Zumutungen
Diese wie andere Lebensgeschichten illustrieren und ergänzen eine große Bestandsaufnahme gesellschaftlicher Entwicklungen, vor allem in den USA und der Bundesrepublik, sowie ungezählter Deutungen der Polykrise. In dieser dominiere, heißt es, „ein Gefühl der Ohnmacht“ (S. 32). Die Polykrise wird in den Kapiteln 1 – „Nach dem Fortschritt“ – und 2 – „Blockierte Leben“ – ausbuchstabiert. Dazu greifen Amlinger und Nachtwey auf eine solche Fülle an Studien, Überlegungen und Thesen aus verschiedenen Jahrzehnten zurück, dass mancher Rezensent sich von der Menge des Materials irritiert zeigte. Dem Gegenwartsgefühl einer veränderungsmüden Gesellschaft, dass von überall schlechte Nachrichten eintreffen und selbst unbestreitbare Fortschritte der Emanzipation das Gesamtbild kaum aufhellen, kommen sie auf diese Weise jedoch besonders nahe. Auch verstehen sie es, ihre Argumentation geschickt zuzuspitzen. Ausschlaggebend sind der Verlust von Zukunftshoffnungen und Fortschrittserwartungen, eine wachsende Ungleichheit, blockierte Aufstiegsversprechen, ein frustriertes Autonomiebegehren. All das widerspricht den Selbstbeschreibungen moderner Gesellschaften, die nach wie vor dem meritokratischen Prinzip huldigen, auf Fortschritt geeicht sind und weiterhin den „Wohlstand für alle“ beschwören. Dieser Widerspruch befördert die Entfremdung von Institutionen und Routinen liberaler Demokratien.
So habe liberale Politik in den zurückliegenden Jahrzehnten vorrangig „bildungsvermittelte Chancengleichheit“ (S. 56) gefördert, sodass Kinder aus der Arbeiterklasse bessere Chancen auf gute Abschlüsse und berufliche Positionen hatten. Zugleich wuchs, da man „Eigentums- und Vermögensstrukturen unangetastet“ (ebd.) ließ, die für unsere Zeit charakteristische, obszöne Vermögensungleichheit. Einer Studie aus dem Jahr 2023 zufolge verfügten 35-jährige Millennials aus den unteren Einkommensschichten in den USA über weniger Vermögen als ihre Vorgänger aus der Kohorte der Babyboomer. Sie besaßen weniger häufig Wohneigentum, hatten aber mehr Schulden angehäuft. In der Bundesrepublik liegen die Verhältnisse günstiger, doch auch hier wird der Aufstieg aus den unteren Schichten in die mittleren seltener und schwerer, erkennen die Mittelschichten wie prekär ihr Status ist, wie nah der mögliche Abstieg. Manche Sorgen, die lange als Statuspanik abgetan wurden, verdanken sich dem kühlen Blick auf Kontoauszüge, Rentenbescheid und Lebenshaltungskosten. Der Verfall der Infrastrukturen nach jahrzehntelanger Austeritätspolitik und ebenso langem Schlendrian ist nicht geeignet, Hoffnungen auf eine bald wieder bessere Zukunft zu nähren.
Neoliberale Politiken gewannen mit Kritik am sozialadministrativen Staat Zuspruch, verhießen Autonomie und Selbstverwirklichung dank Deregulierung und Entfesselung der Märkte. Der Neoliberalismus ist zwar seither reichlich kritisiert und auch schon wiederholt für tot erklärt worden, doch die Folgen neoliberaler Gouvernementalität dauern bis heute an: „Statt traditioneller Hierarchien ist nunmehr fast jedes soziale Feld Benchmarks, Zielvorgaben und Best-Practices unterworfen, die es zu internalisieren und kooperativ umzusetzen gilt. Diese Form der Regierung ist zwar weniger autoritativ, aber in ihrem Kern hoch paternalistisch.“ (S. 77)
Und das vermeintlich autonome, sich selbst verwirklichende, seine Investitionen kalkulierende, sich ständig mit anderen messende, an der eigenen Optimierung arbeitende Individuum spürt, dass es trotz aller Anstrengungen nur langsam oder kaum vorankommt. Das bringt Kränkungen mit sich, das Leben erscheint blockiert. Diese Erfahrung, so Amlinger und Nachtwey, speise sich aus drei Quellen: „aus der Verschlechterung von Lebenschancen durch soziale Ungleichheiten und seltenere Aufstiege, aus dem Abbau gesellschaftlicher Schranken, die zuvor Privilegien absicherten, und aus der Empfindung, die Politik errichte Hindernisse und befördere so einen unfairen Wettbewerb“ (S. 137).
Wenn die Zukunft verbaut, der Fortschritt unwahrscheinlich scheint, gehorchen Konflikte einer „Grammatik des Nullsummendenkens“ (ebd.). Gewinne anderer Gruppen erscheinen dann als eigene Verluste. Hat sich diese Sicht erst einmal verfestigt, schwindet die Bereitschaft zu Solidarität oder politischen Kompromissen. Die aktuellen Debatten über Wohnungsnot, Klimaschutz oder Migrationspolitik liefern dafür Beispiele am laufenden Band. Da gemeinsamer Fortschritt ausgeschlossen scheint, liegt es nahe, sich zuerst um sich selbst und die eigenen Ansprüche zu kümmern. Wenn der Kuchen nicht größer wird, muss man, so die Logik, die Zahl der Esser klein halten, besser noch: verringern.
Das paternalistische Agieren des steuernden Staates kann in diesem Zusammenhang rasch zu Demütigungen führen. Da ist zum einen die neue Dienstleistungsmittelklasse, die Amlinger und Nachtwey im Anschluss an Überlegungen zur „professional-managerial class“ von Adam Tooze analysieren. Staatlich zertifiziert und ausgestattet mit symbolischer und sozialer Macht, belehren und begutachten sie ihre Mitbürger:innen und weisen sie zurecht, ob nun als Ärzt:innen, Erzieher:innen, Professor:innen oder Behördenleiter:innen. Sie werden „als Personifikation symbolischer Herrschaft“ wahrgenommen, als Personen, die sich für etwas Besseres halten; sie seien „der gemeinsame Gegner der Koalition gegen ,Genderwahn‘, ‚Identitätspolitik‘ oder die ,Woken‘ im von Tooze diagnostizierten neuen ,class war‘“ (S. 70).
Zum anderen erscheinen die Verhältnisse alternativlos, obwohl doch die Problemlösungsfähigkeit moderner Gesellschaften derzeit aus Gründen vielfach angezweifelt wird und tiefgreifende Veränderungen, nicht zuletzt wegen des Klimawandels, dringend notwendig wären. Überall herrschen Sachzwänge, und vom bespotteten liberalen Triumphalismus der 1990er blieb doch dies: „Weil die liberale Demokratie sich als alternativlos vernünftig betrachtet, gilt Kritik an ihr – ob sie nun Ungleichheit oder Migration beanstandet – als antidemokratischer Populismus.“ (S. 85). In dieser, im Buch ausführlich dargestellten Lage, gedeiht Zerstörungslust.
Was ist „demokratischer Faschismus“?
Aspekte des libertären Autoritarismus lautet der Untertitel des Vorgängerbuches Gekränkte Freiheit. Zerstörungslust, auch äußerlich aufgrund der ähnlichen Covergestaltung unschwer als Fortsetzung erkennbar, wartet an gleicher Stelle mit Elemente des demokratischen Faschismus auf, einer scheinbar paradoxen Formulierung, die gewohnten Vorstellungen zuwiderläuft. Worin besteht nun dessen Besonderheit? Er sei, heißt es, im Gegensatz zum historischen Faschismus „in der Demokratie verankert“ und verstehe sich als deren Erneuerer (S. 12). Dabei untergrabe er, getrieben von Zerstörungslust, deren soziomoralische und institutionelle Grundlagen: „Mit seiner lustvollen Grausamkeit sowie dem frivolen Spiel mit der Gewalt geht der demokratische Faschismus über den Rechtspopulismus hinaus.“ (Ebd.) Im vierten und letzten Kapitel präsentieren Amlinger und Nachtwey einige Beobachtungen zur Beschreibung dieser neuen, von ihnen auf den Begriff gebrachten Herrschaftsform als einer destruktiven Form des Aufbegehrens gegen die liberale Demokratie. Dazu zählen: die Betrachtung des Ausnahmezustandes als Normalzustand; das enthemmte Begehren nach und die Lust an Grausamkeit; das destruktive Verlachen anderer; die Pflege und Verbreitung von Mythen und Verschwörungstheorien wie der Mär vom „Großen Austausch“; das geschickte Agieren in den Sozialen Medien, wo von unten und auf dezentrale Weise rechtsextreme popkulturelle Inhalte entstehen und Verbreitung finden; sowie schließlich der Kult maskuliner Dominanz, die sich beweist, indem sie andere unterwirft.
Diese verschiedenen Aspekte ergeben noch kein geschlossenes Bild, erst recht keine Definition des „demokratischen Faschismus“. Aber darauf kommt es auch nicht an. Die historischen faschistischen Bewegungen waren Kinder des Ersten Weltkriegs, die heutigen sind Produkte liberaler, demokratisch verfasster, kapitalistischer Gesellschaften. Das schmälert ihre Gefährlichkeit nicht, bringt aber die Aufgabe mit sich, die Merkmale und Funktionsweise der demokratisch-faschistischen Bewegungen möglichst genau zu erfassen. Ob sie in faschistische Diktaturen münden werden oder nicht, weiß aktuell niemand. Zwar ähneln sie in wesentlichen Momenten den faschistischen Bewegungen der Zwischenkriegszeit, auf deren begriffliches und symbolisches Repertoire sie immer wieder zurückgreifen, doch würde man zu viele Differenzen übersehen, wollte man sie mit diesen gleichsetzen. Die Prägung „demokratischer Faschismus“ erfasst das Zugleich von partieller Wiederkehr und Neuartigkeit. Sie soll, so kann man die Intentionen von Amlinger und Nachtwey wohl verstehen, zur Untersuchung der vielen Quellen auffordern und anregen, die sich derzeit vor aller Augen „zu einem großen Strom vereinen“ (S. 306). Der Minderheit der Destruktiven folgend haben Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey gezeigt, worin deren Attraktivität für enttäuschte Angehörige der Mittel- und Oberklassen sowie für Rassisten und Ultranationalisten besteht. Man sieht nach der Lektüre dieses Buches, das gleichermaßen durch Neugier auf Wirklichkeit und theoretischen Ehrgeiz besticht, klarer, worauf es in der Gegenwart ankommt, welche Polarisierungen zu wünschen, welche Konflikte zu führen wären.
Über historische Einzelheiten und theoretische Details lässt sich, wie immer im Fall derart breit angelegter Synthesen, gut und gerne streiten, etwa darüber, inwiefern Theodor Geigers eher beruhigend, denn warnend gemeinte These von der „Panik im Mittestand“ 1930/31 davon ablenkte, die Hitlerbewegung als genuin politisches Phänomen zu begreifen. Ein zeitgenössischer Kritiker hielt Geiger damals soziologischen Impressionismus vor. Damit war die Frage nach dem angemessenen Verhältnis von sozialpsychologischer und politischer Analyse verbunden. Auch hätte man auf den inhaltlich wenig präzisen Terminus der „Nachmoderne“ gut verzichten können, bringt er doch geschichtsphilosophische Begründungszwänge mit sich, ohne viel zu erklären. Und wenn weit vor Claus Offe und Jürgen Habermas schon, worauf die Beiden eigens hinweisen, Theodor Geiger vom „Spätkapitalismus“ sprach (S. 163), was soll uns dieses „spät“ dann heute noch bedeuten?
Der Max Horkheimer variierende und enttäuschende Schlusssatz lautet: „Wer aber vom Kapitalismus und vom Liberalismus nicht reden will, sollte auch vom Faschismus schweigen.“ (S. 321). Nun wird über beide, den Kapitalismus wie den Liberalismus, ständig geredet. Dass die neoliberale Politik der vergangenen Jahrzehnte dem Rechtspopulismus wie den faschistischen Bewegungen der Gegenwart den Boden bereitet habe, wurde von zahlreichen Autor:innen in mannigfachen Varianten diskutiert, von Colin Crouch bis Nancy Fraser, von Wendy Brown bis Quinn Slobodian. Nicht wie ein Liberaler denken, der als Maxime formulierte Titel von Raymond Geuss’ gleichnamigem Buch,[8] wird von Amlinger und Nachtwey selbst zitiert. In ihrem Sinne eines neuen, eines „postliberalen Antifaschismus“ (S. 316) wäre politisch ebenso entschlossen zu fragen, warum die in sich vielfältige Linke, allen voran die traditionsreiche Sozialdemokratie, von der verbreiteten Enttäuschung über gebrochene Versprechen und blockierte Leben nicht hat profitieren können. Hat die Schwäche der politischen Linken bloß kontingente oder strukturelle Gründe? Über Krisen und Gefährdungen offener Gesellschaften lässt sich mit Blick auf deren Verteidiger und Anhängerinnen gewiss ebenso viel lernen wie aus der Untersuchung ihrer Gegner. Deren geistige und soziale Physiognomie lernt man in Zerstörungslust auf neue, Gewissheiten verstörende Weise kennen. Das Buch wird in wenigen Tagen, am 25. November, zu Recht mit dem Geschwister-Scholl-Preis ausgezeichnet, mehrfach wurde es das „Buch der Stunde“ genannt. Vieles spricht dafür, dass es als Kartierung des Destruktiven in unserer Gegenwart über Tag und Saison hinaus Bestand haben wird.
Fußnoten
- Vgl. Michael Bang Petersen / Mathias Osmundsen / Kevin Arceneaux, The „Need for Chaos“ and Motivations to Share Hostile Political Rumors, in: American Political Science Review 117 (2023), 4, S. 1486–1505.
- Carolin Amlinger / Oliver Nachtwey, Gekränkte Freiheit. Aspekte des libertären Autoritarismus, Berlin 2022.
- Erich Fromm, Die Furcht vor der Freiheit (1941a), übers. von Liselotte und Ernst Mickel, in: ders., Gesamtausgabe, hrsg. von Rainer Funk, Bd. 1: Analytische Sozialpsychologie, München 1989, S. 215–392, hier S. 322.
- Sven Reichardt, Was ist Postfaschismus?, in: Soziopolis, 08.05.2025.
- Siehe Thomas Hoebel, Showtime. Der Sturm auf das Kapitol als inszenatorische Praxis betrachtet, in: Soziopolis, 18.01.2021.
- Siehe Ernst Jünger ,Nationalismus‘ und Nationalismus, in: Das Tage-Buch 10 (1929), Heft 38, S. 1552–1558; Leopold Schwarzschild, Heroismus aus Langeweile, in: Das Tage-Buch 10 (1929), Heft 39, S. 1585–1591.
- Zu Hochschild vgl. Berthold Vogel, Wie man Empathiebrücken baut. Rezension zu „Geraubter Stolz. Verlust, Scham und der Aufstieg der Rechten” von Arlie Russel Hochschild, in: Soziopolis, 18.11.2025.
- Raymond Geuss, Nicht wie ein Liberaler denken, übers. von Karin Wördemann, Berlin 2023. Siehe dazu auch Matheus Hagedorny, Unklarheit als Tugend. Rezension zu „Nicht wie ein Liberaler denken“ von Raymond Geuss, in: Soziopolis, 09.10.2023.
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Karsten Malowitz.
Kategorien: Affekte / Emotionen Demokratie Gesellschaft Gesellschaftstheorie Gewalt Kapitalismus / Postkapitalismus Kritische Theorie Moderne / Postmoderne Politik Politische Ökonomie Politische Theorie und Ideengeschichte Rassismus / Diskriminierung Soziale Ungleichheit Sozialer Wandel
Empfehlungen
Die Klimaanlage des bürgerlichen Selbst
Rezension zu „Bürgerliche Kälte. Affekt und koloniale Subjektivität“ von Henrike Kohpeiß
Lektionen für Liberale
Rezension zu „Über Ungerechtigkeit. Erkundungen zu einem moralischen Gefühl" von Judith N. Shklar
