Philip Roth | Rezension | 06.10.2022
Die Substanz sozialer Netzwerke
Rezension zu „Social Networks of Meaning and Communication” von Jan Fuhse
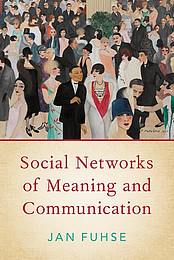
Die Analyse sozialer Netzwerke hat sich in diversen soziologischen Forschungsfeldern als äußerst fruchtbar erwiesen. Entsprechend erleben netzwerkanalytische Verfahren in den letzten Jahrzehnten eine starke Konjunktur. Gleichwohl soziale Netzwerke und Beziehungen damit faktisch eine Zentralstellung in der Soziologie der Gegenwart einnehmen, sind sie anders als andere zentrale Konzepte sozialtheoretisch nur unzureichend integriert. Darunter leidet die Netzwerkforschung in zweierlei Hinsicht. Zum einen ist der ontologische Status von sozialen Beziehungen und Netzwerken weniger präzise definiert als der vieler anderer Gegenstände soziologischer Forschung. Es ist davon auszugehen, dass die Erhebung und Interpretation von Netzwerkdaten erheblich von einer präziseren sozialtheoretischen Definition profitieren würden. Zum anderen ist das Verhältnis von sozialen Beziehungen und Netzwerken zu anderen zentralen soziologischen Konzepten nur unzureichend geklärt. Es fehlt dementsprechend an Sozialtheorien, an denen sich Forschung zum Zusammenhang von sozialen Netzwerken und anderen sozialen Phänomenen orientieren kann.
Jan Fuhse hat in den letzten 20 Jahren entscheidend dazu beigetragen, diesen Mangel zu beseitigen. In seinem Buch „Social Networks of Meaning and Communication“, das jüngst bei Oxford University Press erschienen ist, führt er seine wichtigsten Überlegungen zusammen und integriert sie sozialtheoretisch. Dazu konzipiert er soziale Beziehungen und Netzwerke als Bedeutungsmuster, die durch Kommunikation hervorgebracht werden und die Kommunikation zugleich strukturieren. Grundlegend für die Bedeutung von Beziehungen und Netzwerken sind Bündel sozial geteilter Erwartungen darüber, wie sich Alter und Ego zueinander verhalten werden. Dabei begründet das aufeinander bezogene Verhalten von Alter und Ego in der Vergangenheit wechselseitige Erwartungen über ihr Verhalten (und Erwarten) in der Zukunft. Diese relationalen Erwartungen strukturieren, wie sie gegenwärtige Kommunikation miteinander ausgestalten. Sie wirken insofern über einzelne Kommunikationsakte und Beziehungen hinaus, als Akteure sie bündeln, indem sie für sich selbst und für andere kohärente Identitäten konstruieren. Die relationalen Erwartungen und Identitäten der Akteure bilden die „meaning structure”, die die sozialen Netzwerke konstituieren.
Ausgehend von diesen grundlegenden Überlegungen gelingt es Fuhse, das Verhältnis zu anderen zentralen, klassischen wie neueren, soziologischen Ansätzen schlüssig und informativ zu bestimmen. Besonders wichtig dafür ist Fuhses Konzept der „relationalen Institution“. Anschließend an Berger und Luckmann[1] definiert Fuhse relationale Institutionen als in Kulturen geteilte Modelle zum Verhalten in sozialen Beziehungen. Er argumentiert, dass Akteure diese Modelle sowohl anwenden, wenn sie kommunizieren, als auch, wenn sie auf deren Grundlage Erwartungen dazu bilden, wie sie sich in Zukunft zueinander verhalten werden. Formation und Wirkung von sozialen Netzwerken werden dementsprechend grundlegend durch kulturspezifische relationale Institutionen strukturiert.
Diese grundlegenden Ideen entfaltend zeigt Fuhse in seinem Buch zum einen, wie die Formation und Wirkung von Netzwerken durch institutionalisierte soziale Rollen, Gruppengrenzen, soziale Kategorien (wie etwa Geschlecht) und Typen von Beziehungen (wie etwa Freundschaft) strukturiert werden und zum anderen, wie diese sozialen Phänomene umgekehrt in Netzwerken kommunikativ konstituiert werden. Beispielsweise ist „Liebe“ eine relationale Institution, deren kommunikative Aktivierung Erwartungen begründet. „By adopting the frame of love, they define their tie as conforming to the culturally available ideal, at least roughly. Saying ,I love you’ thus translates into ,I allow you to expect of me the behaviors typically associated with the frame ,love’ in our socio-cultural context. And I want to expect the same of you.’ That is a mouthful, and not very romantic. Better stick to the short version.“ (S. 175)
Fuhse ist nicht der erste, der Verbindungen zwischen Netzwerken und den genannten sozialen Phänomenen herstellt oder auf die Bedeutung von Kultur für Formation und Wirkung von Netzwerken hinweist. Bisher sind diese Brückenschläge aber eher in vereinzelten Beiträgen mit spezifischem konzeptionellem oder gegenständlichem Fokus vorgenommen worden. Das vorliegende Buch geht hier in die Tiefe und bietet eine gleichermaßen breite wie fundierte Integration der Konzepte. Auf Grundlage eines beeindruckend breiten sozialtheoretischen Œuvres entwickelt Fuhse ein überzeugendes Tiefenverständnis von sozialen Beziehungen und Netzwerken und zeigt detailliert und nachvollziehbar auf, wie sie mit anderen sozialen Phänomenen verwoben sind. Er legt damit die theoretische Grundlage dafür, Formation und Wirkung sozialer Netzwerke besser zu verstehen, als das bisher möglich war. In Anbetracht der Erklärungskraft, die Netzwerkanalysen ausgehend von simplizistischen Annahmen zu ihrem Gegenstand zeigen konnten, verspricht die empirische Anwendung von Fuhses Theorie tiefgreifende Einsichten in die soziale Welt.
Meine Kritikpunkte berühren diesen zentralen Beitrag des Buches nur peripher. Der erste bezieht sich auf die sozialtheoretische Rahmung des Theorieentwurfs. Fuhse verortet seine Arbeit von Anfang an in der Systemtheorie Niklas Luhmanns und in Harrison Whites Entwurf einer Relationalen Soziologie – zwei Ansätze, mit denen sich Fuhse bereits in seinen frühen Publikationen intensiv befasst hat. Von daher sind diese Referenzen für Fuhse-Kenner erwartbar. Bemerkenswert ist jedoch, dass sich Fuhse bei der Verankerung seines Ansatzes immer wieder explizit von den beiden Theorien abwendet, um wissenssoziologische und interaktionistische AutorInnen und Konzepte zu verwenden. Beispielsweise argumentiert er, dass sich die Institutionalisierungsprozesse, durch die Kulturen entwickelt werden, nicht mit Luhmanns Systemtheorie fassen lassen und bezieht sich an dieser für seinen Theorieentwurf zentralen Stelle auf die wissenssoziologische Theorie von Berger und Luckmann (vgl. S. 147). Da Fuhse konsequent auf diese Ansätze baut, gelingt es ihm, eine in sich konsistente und dadurch informative Theorie zu formulieren. Dabei entsteht jedoch ein wenig der Eindruck, als sei Fuhse im Laufe der Jahre von seiner frühen sozialtheoretischen Prägung durch Luhmann und White abgekommen, hätte das aber selbst noch nicht vollständig akzeptiert.
Die Diversität der sozialtheoretischen Bezüge bereichern das Buch ungemein und es ist Fuhse hoch anzurechnen, dass er sie so überzeugend integriert. In zweierlei Hinsicht ergeben sich jedoch auch Schwierigkeiten aus der starken wissenssoziologischen Fundierung und der Verortung bei White und Luhmann. Erstens grenzt sich Fuhse zu Beginn von bereits vorliegenden Netzwerktheorien (Nick Crossley, John Levi Martin, Mustafa Emirbayer) ab, indem er darauf verweist, dass er mit Luhmann und White wenig Gewicht auf „subjektiven Sinn“ im Sinne von Akteursperspektiven legt. Wenn er dann aber doch stark auf Sozialtheorien baut, die die alternativen netzwerkanalytischen Theorieangebote begründen, stellt sich die Frage, wie genau sich Fuhses Ansatz von zum Beispiel dem Crossleys unterscheidet, für den Erwartungen ebenfalls zentral sind: „To say that two actors are related is to say that they have a history of past and an expectation of future interaction and that this shapes their current interactions.”[2] Hier scheint eine tiefergehende Auseinandersetzung lohnenswert, um die Theorien stärker voneinander abzugrenzen und die unzweifelhaft vorhandenen Stärken von Fuhses Zugang herauszustellen. Zweitens macht Fuhse insbesondere im Schlusskapitel an Luhmann und White anschließend (und in Übereinstimmung mit der gängigen Praxis in der Netzwerkforschung) stark, dass die empirische Forschung sich nicht mit „subjektivem Sinn“, sondern mit „kommunikativen Ereignissen“ befassen sollte, deren Bedeutung sich Forschenden aus der Kommunikation selbst erschließt. In Anbetracht der zentralen Bedeutung kulturspezifischen Wissens für die Zuschreibung von Sinn, die Fuhse in den grundlegenden Kapiteln herausarbeitet, überrascht diese Festlegung auf die Intersubjektivität von Sinngehalten. Eine zentrale Annahme des Symbolischen Interaktionismus und der Wissenssoziologie ist, dass der subjektiv gemeinte Sinn der Akteure insofern sozial ist, als jene sich auf sozial geteiltes Wissen beziehen, um Sinn zuzuschreiben. Da dieses sozial geteilte Wissen zwischen Gruppen und anderen sozialen Kollektiven variieren kann, wie auch Fuhse hervorhebt, ist es aber erforderlich, sich empirisch mit ihm auseinanderzusetzen, um den Sinn von Kommunikation angemessen bestimmen zu können. Sicherlich hängt es von der jeweiligen Forschungsfrage ab, wie intensiv man sich mit den Perspektiven der Akteure befasst. Vor dem Hintergrund von Fuhses eigener Theorie erscheint es aber nicht geboten, die Marginalisierung der Akteursperspektive in der empirischen Forschung zu fordern. Sowohl die Abgrenzung von vergleichbaren Theorieangeboten als auch eine Reflexion der methodologischen Implikationen der Theorie sind aber eindeutig nicht die Kernziele des Buches. Vielmehr handelt es sich bei beidem um Fragen, die an jedes große Theoriebuch gerichtet werden, weshalb es sehr zu begrüßen ist, dass sich Fuhse im Buch selbst streitbar dazu positioniert, statt sich auf die bloße Darstellung seiner Theorie zu beschränken.
Dasselbe gilt auch für den zweiten Kritikpunkt. Im sechsten Kapitel wendet Fuhse seine Theorie auf den Beziehungstyp „Liebe“ und die soziale Kategorie „Geschlecht“ an. Es ist bemerkenswert, dass in einem Buch mit so starkem Theoriebeitrag die ausführliche Anwendung selbiger an einem empirischen Beispiel vorgenommen wird – insbesondere, weil das gewählte Beispiel nicht nur viele Elemente der entworfenen Theorie herausfordert, sondern auch lebensweltlich für viele LeserInnen greifbar und gesellschaftlich von großer Relevanz ist. Fuhse legt das Kapitel erfreulich ambitioniert an, indem er in Aussicht stellt, das vorhandene Wissen zum Thema anhand seiner Theorie neu zu systematisieren, entsprechende Hypothesen abzuleiten und diese anschließend empirisch zu überprüfen (S. 192). Seine Literaturarbeit beschränkt sich dann allerdings stark auf einzelne Beiträge von ForscherInnen, die dezidiert netzwerkanalytisch arbeiten, und bildet den gegenwärtigen Stand der Forschung zum Thema daher nur rudimentär ab. Infolgedessen hilft die Anwendung der Theorie auf die Literatur zwar, jene zu veranschaulichen, sie bleibt aber eher oberflächlich. Zuletzt analysiert Fuhse auf Grundlage seiner theoretischen Überlegungen Daten des US General Social Survey von 2004 und zeigt so, dass Frauen wichtige Angelegenheiten eher mit Frauen besprechen während Männer dafür Männer bevorzugen. Diese Befunde sind wenig originell.
Dass Fuhse seine Theorie nicht auch noch im selben Buch, in dem er sie entwickelt, dazu nutzt, einen signifikanten empirischen Beitrag zur Geschlechterforschung zu leisten, kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass er mit „Social Networks of Meaning and Communication“ einen herausragenden Beitrag zur sozialtheoretischen Fundierung der Netzwerkforschung vorgelegt hat. In Anbetracht der Bedeutung von sozialen Beziehungen und Netzwerken für ausnahmslos jeden Gegenstandsbereich der Soziologie besteht für mich kein Zweifel daran, dass die in diesem Buch entworfene Theorie Wege für zahlreiche wichtige Einsichten ebnen wird. Alle, die sich in ihrer Forschung mit sozialen Beziehungen und Netzwerken befassen, sollten dieses Buch so bald wie möglich lesen.
Fußnoten
- Peter L. Berger / Thomas Luckmann, The social construction of reality. A treatise in the sociology of knowledge, Garden City, N.Y. 1966.
- Nick Crossley, Towards relational sociology, New York 2012, S. 28.
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Hannah Schmidt-Ott.
Kategorien: Gesellschaftstheorie Gruppen / Organisationen / Netzwerke Systemtheorie / Soziale Systeme
Zur PDF-Datei dieses Artikels im Social Science Open Access Repository (SSOAR) der GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gelangen Sie hier.
Empfehlungen
Grenzen der Entscheidbarkeit
Rezension zu „Schriften zur Organisation 2. Theorie organisierter Sozialsysteme“ und "Schriften zur Organisation 3. Gesellschaftliche Differenzierung“ von Niklas Luhmann
Ein Betriebsgeheimnis sozialer Ordnung
Rezension zu „Brauchbare Illegalität. Vom Nutzen des Regelbruchs in Organisationen“ von Stefan Kühl
