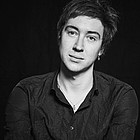Vincent Dubois, Marc Ortmann | Interview | 11.01.2023
„In den Sozialwissenschaften sind Text und Forschungsergebnis eins“
Vincent Dubois im Gespräch mit Marc Ortmann
Welche Rolle nimmt das Schreiben in Ihrer Forschung und in Ihrem Alltag ein?
Ich möchte einleitend sagen, wie sehr ich mich durch Ihre Einladung zu diesem Gespräch geehrt fühle und wie sehr ich an dem dadurch angestoßenen Austausch interessiert bin. Ich bin davon überzeugt, dass wir deutlicher über das akademische Schreiben und seine Beherrschung reflektieren müssen. Denn die Art und Weise, wie wir das Soziale beschreiben, ist stark beeinflusst von akademischen Positionen und Dispositionen. Sie werden häufig nicht mitgedacht und deshalb selten besprochen; genau darum müssen wir ihren Einfluss auf unser Schreiben identifizieren. Wir sollten zum Beispiel ernsthaft untersuchen, was die Ausbildung zum essayistischen Schreiben an US-amerikanischen Universitäten, zur französischen Dissertation oder zur deutschen Seminararbeit an intellektuellen Dispositionen und Kompetenzen hervorbringt, wie diese im Studium erworbenen Dispositionen und Kompetenzen unsere professionelle Art zu Schreiben beeinflussen und wie leicht oder glücklich sie sich mit den standardisierten Modellen der großen internationalen Zeitschriften vereinbaren lassen. Auf jeden Fall glaube ich sagen zu können, dass ich mir des Systems, das meine Art zu Schreiben hervorgebracht hat, mit all seinen Vor- und Nachteilen einigermaßen bewusst bin, und ich danke den Lesern im Voraus dafür, dass sie beim Lesen dieser wenigen Überlegungen die gleiche geistige Übung machen.
Der erste Teil Ihrer Frage nach der Rolle des Schreibens in meiner Forschung würde eine viel längere Antwort erfordern, als ich hier geben kann. Ohne zu behaupten, dass nur ich diese Auffassung habe, bin ich der Ansicht, dass das Schreiben nicht auf den abschließenden Vorgang der Ergebnispräsentation reduziert werden kann, sondern dass es ein integraler Bestandteil von Forschung ist. Hierzu drei einfache Überlegungen: Erstens beginnt das Schreiben nicht erst mit dem Verfassen eines Artikels oder eines Buches, wenn der Forscher dazu angehalten ist, sich als Autor eines unterzeichneten und zur Veröffentlichung bestimmten Textes zu denken. Ich persönlich lege großen Wert auf Zwischeneinträge. Zunächst einmal das Schreiben eines Forschungsprogramms, das die Überlegungen, die Auswahl der Lektüre, die Wahl des Forschungsfeldes und der Methode sowie eine erste Formulierung der Hypothesen anleiten wird. So gesehen beginnt alles mit dem Schreiben, insbesondere, wenn man wie ich eine vor allem hypothetisch-deduktive Methode verfolgt, anstatt sich in ein Feld zu vertiefen, bevor man weiß, was man damit machen wird. Ich bin mir bewusst, dass diese Vorgehensweise Fallstricke birgt. Das ursprüngliche Gerüst kann zu einem Korsett werden, in dem man bereits vor dem Ende der Untersuchung Schlussfolgerungen ankündigt und verkündet, ohne Platz für mögliche Entdeckungen zu lassen, die nicht mit dem ursprünglichen Projekt übereinstimmen. Ich bemühe mich also, kohärent zu sein und gleichzeitig flexibel zu bleiben, offen für Überraschungen, Nuancen und Widersprüche, die bei der Durchführung der Forschung auftauchen. Ich möchte hinzufügen, dass dieses erste programmatische Schreiben besonders dann notwendig ist, wenn es sich um eine kollaborative Forschung handelt. Denn das Teilen und Diskutieren eines Textes ist eine der Möglichkeiten, um sich zu vergewissern, dass man wirklich nach denselben Dingen sucht, und um Missverständnisse zu vermeiden. Weiterhin werden die Forschungsarbeiten, die manchmal viele Jahre andauern (die Arbeit an meinem letzten Buch erstreckte sich über mehr als zwanzig Jahre), von Lektüreblätter, Feldnotizen, Zwischenreflexionen und Vorträgen auf Kolloquien begleitet. Vieles entwickelt sich in diesen Arbeitstexten.
Zweite Überlegung: Ich verstehe das Schreiben als Forschungsoperation; eine entscheidende Operation, die man mit denselben methodologischen Vorsichtsmaßnahmen und der gleichen Reflexivität angehen muss wie technische und theoretische Handlungen, etwa eine Stichprobe oder einen Korpus zusammenstellen, eine statistische Auswertung anfertigen oder ethnografische Beobachtungen auf eine bestimmte Art und Weise durchführen. Dies ist eine Möglichkeit, das Schreiben zu ‚entweihen‘ und es gleichzeitig stärker zu kontrollieren. Denn wenn man sich über den Aufbau eines Satzes oder den Platz eines Interviewauszugs im Text Gedanken macht, ähnlich wie man über das Raster eines Fragebogens oder die Durchführung eines Interviews nachdenkt, achtet man nicht nur auf den Stil (im literarischen Sinne des Wortes), sondern man ist auch wachsam in Bezug auf die Wissenseffekte, die man produziert, und auf die soziologischen Fehler, die man begehen könnte.
Aus diesem Grund – und das ist die dritte Überlegung – scheint es mir so zu sein, dass in den Sozialwissenschaften Text und Forschungsergebnis eins sind; außer man entscheidet sich für die mathematisierte Modellierung eines Teils der Wirtschaftswissenschaft. Es gibt nicht auf der einen Seite das Ergebnis, das man in einer Formel darlegen kann, und auf der anderen Seite den Text, der es präsentiert und erklärt. Es gibt einen Prozess, wie in den besten ethnografischen Arbeiten, oder eine demonstrative Verkettung, die durch die Schrift und in der Schrift produziert wird. Das soziologische, das heißt das theoretische und zugleich empirische Ergebnis wird zum Teil im Akt des Schreibens erarbeitet und nimmt im Wesentlichen die Form eines Textes an. Dies zu sagen bedeutet keineswegs, in die postmodernen Auswüchse eines unkontrollierten Schreibens zu verfallen, bei dem die Konzepte freischweben und die empirischen Bezüge sehr unklar sind. Es bedeutet im Gegenteil, sich daran zu erinnern, dass man beim Schreiben die gleiche Haltung und die gleiche Strenge haben muss wie bei der Durchführung der anderen Forschungspraktiken, mit denen es verbunden ist.
Der Stellenwert des Schreibens in meiner täglichen Arbeit ist wiederum äußerst variabel. Im Jahr 2020 beispielsweise bekam ich einen Forschungsurlaub genehmigt, um ein Buch zu schreiben; das wäre unter den üblichen Arbeitsbedingungen eines Dozenten und Forschers in Frankreich unmöglich zu verfassen gewesen. Der Forschungsurlaub war als Schreibperiode zwischen den Vorbereitungen für das Buchprojekt und dem nächsten akademischen Jahr angesiedelt. So konnte ich sieben volle Monate meine gesamte Zeit dem Schreiben widmen, acht bis zwölf Stunden pro Tag, je nachdem wie gut ich mit meiner Arbeit vorankam. Das heißt, mein Alltag bestand nur aus Schreiben. Aber 2022 zum Beispiel konnte ich zwischen dem Semesterbeginn im September und dem 28. Juni nicht mehr als sechzig Tage zum Schreiben nutzen, einschließlich der Ferien. Die Tage waren größtenteils mit anderen Dingen gefüllt, wie dem Lesen von Studienarbeiten oder der Vorbereitung meiner Vorlesungen. So hatte ich nur drei oder vier Tage im Monat Zeit zum Schreiben, was sehr wenig ist, vor allem für längere Texte, die ein Mindestmaß an Kontinuität erfordern. Das ist etwas, das viele von uns erleben.
Die Beschleunigung der Zeit, von der Hartmut Rosa spricht, fällt im Fall von Akademikern zusammen mit der Multiplikation und Diversifizierung von Aufgaben innerhalb eines einzigen Tages. Diese Multiaktivität (pluriactivité) macht den Beruf zwar attraktiv, man ist abwechselnd als Lehrer, Feldforscher, Herausgeber, Begutachter, Referent, Organisator von wissenschaftlichen Veranstaltungen oder als Kursentwickler und Autor tätig. Ich befürchte jedoch, dass die Mehrfachbeschäftigung zunimmt und dass Verwaltungs- und Bewertungstätigkeiten, die nicht zum Kern unseres Berufs gehören, immer mehr Platz einnehmen. Dies geschieht auf Kosten des nichtutilitaristischen Schreibens und Lesens, kurzum der „skholè“. Pierre Bourdieu nutzte diesen Begriff der alten Griechen, um das besondere Verhältnis zur Zeit und zu täglichen Notwendigkeiten zu bezeichnen, das die Voraussetzung für echte intellektuelle Tätigkeit bildet.
Wie muss ein Tag, an dem Sie schreiben bei Ihnen aussehen? Gibt es persönliche Voraussetzungen oder Rituale?
Wie ich gerade erläutert habe, gibt es weniger ganze Schreibtage als vielmehr Tage, an denen man – unter anderem – ein wenig schreiben kann... Aber glücklicherweise tun sich auch diese ganzen Tage von Zeit zu Zeit auf! Sie bestehen, worauf Sie in Ihrer Frage anspielen, aus den kleinen Ritualen, die jene für kontinuierliches Schreiben unerlässliche Routine bilden. Zum Beispiel den Tee oder die Wasserflasche in Reichweite bereitstellen: Ich rauche nicht, und Trinken ist für mich das Gleiche wie eine Zigarette in den Mund zu nehmen, es hilft der Konzentration und ermöglicht Mikropausen. Oder auf den beiden Bildschirmen, die ich benutze, die verschiedenen Dokumente anordnen: den aktuellen Text, den detaillierten Plan, Zotero und das Internet für zusätzliche bibliografische Recherchen. Oder in der warmen Jahreszeit nach der Fertigstellung eines Kapitels ein oder zwei Stunden im Wald in der Nähe meines Hauses spazieren gehen...
Je nach Lebensphase konnte ich an verschiedenen Orten gut schreiben; allerdings nie in einem Café oder in einer Bibliothek, wahrscheinlich weil ich zu neugierig auf die Menschen um mich herum bin und mich das ablenken würde! Dafür konnte ich sehr gut neben meinen kleinen Söhnen schreiben, auch wenn die Tatsache, dass man körperlich anwesend, aber geistig woanders ist, ein wenig seltsam ist und voraussetzt, dass sich die Umgebung anpasst! Es gab eine Zeit, in der ich nur oder fast nur an meinem Schreibtisch in der Universität schrieb, selbst wenn die Heizung während der Winterferien ausfiel... Heute ist es mehr mein Haus, weil ich dort mit meinen Büchern die Ruhe der Natur um mich habe. Aber das kann sich durchaus nochmal ändern.
Ich mag Musik sehr gerne und wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum ich während der Arbeit nur wenig Musik höre. Denn mein Hörverhalten ist in der Regel aktiv und daher nur schwer mit der Konzentration auf eine andere Aufgabe vereinbar. Und wenn, dann gelingt mir dies eher bei den Goldberg-Variationen als bei den ersten Alben der Einstürzende Neubauten, um zwei deutsche Referenzen zu nennen, die ich besonders mag.
Sie haben sich ausgiebig mit den Regeln des soziologischen Schreibens auseinandergesetzt. Welchen impliziten, aber auch expliziten Regeln folgen Sie selbst?
Ich habe den Ausdruck „Regeln des soziologischen Schreibens“ (règles de l’écriture sociologique) sehr explizit in Bezug auf Émile Durkheims Regeln der soziologischen Methode verwendet. Ich wollte damit etwas verdeutlichen, das ich in meinen obigen Antworten zu erklären begonnen habe: Bei Fragen des Schreibens, die nicht auf die persönlichen Vorlieben oder Qualitäten der Autoren reduziert werden können (wenn man sagt, dass manche Menschen gut oder schlecht schreiben), ist epistemologische Wachsamkeit angebracht. Allerdings – und das ist das Problem insbesondere bei ihrer Vermittlung – lassen sich diese Regeln nur schwer systematisch formalisieren. Dafür gibt es viele Gründe: unter anderem der unterschiedliche Status der Texte (man schreibt einen theoretischen Essay nicht wie einen Bericht über eine Umfrage), verschiedene Medien und ihre jeweilige Leserschaft (Dissertation, wissenschaftlicher Artikel oder ein Buch, das über den akademischen Kreis hinausgeht), Unterschiede in den Methoden (eine makrosoziologische Synthese mit historischer Dimension weist ganz andere Schreibprobleme auf als eine ethnografische Monografie, die wiederum wenig mit einem Text gemeinsam hat, der auf logischen Regressionsanalysen anhand umfangreicher Datenbanken beruht), ganz zu schweigen von den theoretischen Ausrichtungen, die sich formal im Stil, aber auch konzeptuell in der Schreibweise niederschlagen. Ich habe wie die meisten von uns die Gelegenheit, Texte mit unterschiedlichem Status in verschiedenen Medien, auf Französisch und Englisch, ausgehend von soziohistorischen, ethnografischen und statistischen Methoden zu schreiben, und ich kann nicht behaupten, dass ich nach einem Satz streng definierter und immer identisch angewendeter Regeln schreibe. Das schließt jedoch nicht aus, dass allgemeine Richtlinien für das Schreiben bestehen.
Zunächst gibt es allgemeine Prinzipien: (1) die von mir erwähnte Reflexivität systematisch ausüben, (2) immer auf einen empirischen Bezugspunkt hin denken und schreiben, (3) auch in eher theoretischen Texten oder Passagen schockierende oder denunziatorische Formulierungen vermeiden, die einen Text von der soziologischen Kritik in die Sozialkritik abgleiten lassen...
Dann gibt es wiederkehrende Anforderungen: (1) die Struktur des Textes von vornherein demonstrativ gestalten, anstatt den Leser das Argument nach und nach entdecken zu lassen, (2) möglichst viele Vergleichsmöglichkeiten geben, auf anderen Gebieten oder zu anderen Gegenständen als den eigenen. Der letztgenannte Punkt hängt unter anderem mit einem ständigen Bestreben zusammen, das sich aus meiner eigenen Leseerfahrung ergibt, nämlich potenziell auch diejenigen anzusprechen, die nicht von vornherein ein direktes Interesse an dem von mir behandelten Gegenstand haben. Aus diesem Grund schätze ich es besonders, wenn meine Arbeit in Texten zu Bereichen oder Kontexten auftaucht, die sich sehr von meinen eigenen unterscheiden.
Schließlich gibt es praktische Schreibregeln, die den soziologischen Gehalt des Textes garantieren. Ich denke zum Beispiel daran, niemals ein Kollektiv (‚der Staat‘ oder ‚die Regierung‘) als Subjekt eines Verbs der Absicht (wünschen), der Handlung (entscheiden) oder der Meinung (denken, bevorzugen) zu verwenden. So lässt sich das Risiko der Verdinglichung vermindern, weil man dazu angehalten ist, diejenigen Akteure und ihre Beziehungssysteme zu identifizieren, die der zu analysierenden Absicht, Handlung oder Meinung zugrunde liegen. Dasselbe gilt für die im Französischen häufig verwendeten Passivkonstruktionen, wenn sie die Ursache, den Akteur oder den konkreten Prozess, um den es geht, verschleiern. Formulierungen wie „Es wurde etwas beschlossen“ (Il a été décidé que) vermeiden die Fragen, durch wen, in welchem Kontext und nach welchen genauen Modalitäten so etwas wie eine Entscheidung zustande kam.[1] Dies sind nur einige Beispiele aus einer Reihe von mehr oder weniger wichtigen Elementen, aus denen sich nach und nach eine Schreibstrategie entwickelt hat.
Wie wechseln Sie zwischen Schreiben und Lesen?
Die Arbeiten, die ich als grundlegende Lektüre, als Klassiker, als theoretisch wichtige Texte oder als Untersuchungsmodelle bezeichnen würde, kommen in mehreren Phasen zum Tragen. Für mich ist das insbesondere Bourdieu, sekundär Weber und Goffman, um nur die drei wichtigsten Autoren zu nennen. Diese gesammelten Lektüren haben bei mir eine Denkweise und bestimmte Arten von Fragen geprägt, die am Anfang jeder Forschung stehen und das Schreiben strukturieren. Sie dienen mir auch als Unterstützung, wenn ich ein Argument verstärken oder meinen Ausführungen eine größere Tragweite verleihen möchte. Aber im Sinne der von mir propagierten Reflexivität versuche ich, den Gebrauch dieser Art von Referenzen zu kontrollieren. Ich mobilisiere sie, weil sie mir helfen, zu denken und meine Argumente zu organisieren. Aber ich vermeide es so weit wie möglich, mich nur unter die Schirmherrschaft großer Autoren zu stellen, um dadurch meine Argumente zu veredeln.
Ich hatte dieses Problem ganz konkret bei meinem letzten Buch, das sich mit der Politik der Kontrolle und Bestrafung von Sozialhilfeempfängern befasst.[2] Ich las dafür natürlich Michel Foucault – eigentlich habe ich ihn erneut gelesen, selbst wenn ich mich in meinen anderen Arbeiten kaum auf ihn beziehe. In diesem Fall hätte ich ihn auf jeder oder fast jeder Seite zitieren können, über die Regierung von Bevölkerungen, zu Dispositiven, zum ungleichen Umgang mit illegalen Handlungen, zu Überwachung, Disziplin und so weiter. Aber ich habe versucht, gegen diese Bequemlichkeit anzukämpfen, indem ich alle evokativen Verweise eliminierte, die die Aufmerksamkeit des Lesers zwar eingenommen, aber letztlich wenig zum Kern meines Arguments beigetragen hätten. Ich habe mir also ständig zwei Fragen gestellt, um zu entscheiden, ob ich mich auf Foucault beziehen sollte oder nicht. Die erste: Kann ich das Gleiche sagen, ohne notwendigerweise auf mehr oder weniger kosmetische Weise auf Überwachen und Strafen oder Die Geburt der Biopolitik zu verweisen? Und umgekehrt: Wann muss ich Foucault zitieren, um nicht Gefahr zu laufen, missverstanden zu werden und damit man mir nicht vorwerfen kann, ich würde meine Ausführungen nicht ausreichend in eine Denk- und Debattentradition zu diesen Fragen stellen? Letztendlich zitiere ich ihn relativ wenig, etwa 15 Mal in einem Buch von fast 450 Seiten, aber ich glaube jedes Mal auf eine nützliche Weise und zu ziemlich unterschiedlichen Punkten.
Abseits der strukturierenden Lektüren gibt es solche, die ich als informativ oder dokumentarisch bezeichnen würde. Sie sind auch wichtig, besonders wenn man wie ich empirisch arbeitet. Sofern die Bereiche, die ein Text abzudecken versucht, groß und vielfältig sind (was bei einem Buch meist der Fall ist), spielt diese Art von Lektüre sowohl im Vorfeld als auch während des Schreibens dann eine Rolle, wenn in den Details eines Absatzes oder eines Arguments ein zusätzliches Beispiel, eine Zahl oder eine andere ergänzende Präzisierung benötigt wird. Eine Schreibpraxis, die derlei zusätzliche Lektüren einbezieht, ist eng mit der Nutzung einer guten bibliografischen Datenbank und mit Internetrecherchen verzahnt.
Neben der grundlegenden und der informativen Lektüre nutze ich mindestens zwei weitere Arten von Referenzen: diejenigen, die sich direkt auf meinen Untersuchungsgegenstand beziehen. Abgesehen von Ausnahmefällen verwende ich sie nicht im Sinne eines Kontrapunkts, den ich mit meinen Aussagen widerlege, was in den Sozialwissenschaften üblich ist, sondern vielmehr, um meine Analyse zu untermauern. Nicht, dass ich Polemik, die durchaus nützlich und anregend sein kann, generell vermeide, aber wenn ich keinen analytischen Fehler korrigieren muss oder wenn meine wissenschaftlichen Gegner mir nicht die Gelegenheit geben, in der Analyse weiterzugehen, ziehe ich es vor, die Arbeiten, die ich für schlecht halte, beiseite zu lassen, anstatt Zeit und Seiten damit zu verbringen, ihnen Kommentare zu widmen, die sie in meinen Augen nicht wirklich verdienen... Schließlich gibt es noch die Lektüren, die ich als Analogie oder zum Vergleich heranziehe, weil sie mir geholfen haben, meine Analyse besser aufzubauen und/oder weil sie es mir ermöglichen, die Aussage über meinen empirischen Gegenstand in komparatistischer Perspektive zu erweitern.
Eine letzte Frage, die besonders für Nachwuchsforscher interessant sein dürfte: Auf welche Probleme stoßen Sie immer wieder beim Schreiben und welchen Umgang haben Sie persönlich dafür gefunden?
Es gibt viele, und ich bin mir nicht sicher, ob ich sie alle überwunden habe! Ich möchte nur eine allgemeine Herausforderung ansprechen, die sich besonders für die Soziologie stellt, wie ich sie verstehe und zu praktizieren versuche, das heiß als Disziplin, die untrennbar mit Theorie und Empirie verbunden ist. Wenn man mit Begriffen hantiert, wenn man vorgibt, eine argumentative Analyse zu entfalten, unterliegt das Schreiben den Regeln der Logik, wie bei einer Beweisführung. Wenn man Informationen präsentiert, seien es statistische Reihen oder qualitative Lebensberichte, unterliegt das Schreiben den Imperativen der Datentreue, der Achtung der Vielfalt der Realität und manchmal auch ihrer Widersprüche. In der Soziologie bewegen wir uns in beiden Registern und sind daher mit verschiedenen Arten von Anforderungen konfrontiert, die sich nicht immer widersprechen, sich aber oft als äußerst komplex erweisen, wenn sie zugleich erfüllt werden sollen. Wie kann man eine logische Argumentation entfalten, ohne dass die Daten allzu weit in den Hintergrund rücken oder alle Unebenheiten der Realität geglättet werden? Wie kann man umgekehrt der Empirie treu bleiben (was nicht bedeutet, positivistisch zu sein), ohne sich in Details zu verlieren und jegliche erklärende Absicht aufzugeben?
Diese Fragen sind schon lange Teil der epistemologischen Reflexion und knüpfen an die Vorschläge an, die Max Weber mit seiner idealtypischen Methode formulierte. Sie stellen sich ganz praktisch für jeden von uns, der eine auf Statistiken basierende Forschung betreiben will, ohne sich damit zu begnügen, die Arbeit eines Statistikers zu machen; der anders über ein Ereignis berichten will als ein Journalist, welcher vorgibt, nur die vermeintlichen Fakten zu präsentieren; der anders Einsicht in soziale Situationen gewähren will als durch die bloße Wiedergabe seines ethnografischen Feldtagebuchs; kurz gesagt: jeder, der soziologisch schreiben will.
Die schlimmste Art und Weise, dieses Problem (nicht) zu lösen, besteht meiner Meinung nach darin, das, was man eigentlich artikulieren will, zu trennen. Die immer noch vorhandenen zweiteiligen Thesen, bestehend aus einem theoretischen Teil und einem Part, der die Untersuchungsergebnisse präsentiert, veranschaulichen dies in karikaturistischer Weise. Ihre Schlussfolgerung sieht sich der Schwierigkeit ausgesetzt, das, was künstlich getrennt und nicht ausreichend zusammengedacht wurde, wieder zusammenfügen zu müssen.
Wie sollte man also vorgehen? Zunächst einmal sollte man genau genommen nicht trennen, was zusammengehört, und seine Forschung von Anfang an zusammen konzipieren, ausgehend von theoretischen Fragen und einem Feld oder Daten, die es ermöglichen, diese Fragen zu beantworten. Hier zeigt sich wieder die Bedeutung von Zwischeneinträgen, die ich oben erwähnt habe. Anschließend sollte man die Struktur des Textes selbst durchdenken. Es erfordert viel Talent und geeignete Methoden, um zu einem befriedigenden Ergebnis zu gelangen und den Leser nicht durch einen Textaufbau zu verlieren, der mit einer allgemeinen Darstellung ohne wirkliche Problematik beginnt, das Material darlegt und dann mit einer Schlussfolgerung endet, die die aus theoretischer und analytischer Sicht wesentlichen Elemente herausarbeitet. Schreiben ist immer eine Rekonstruktion. Den Studenten, die ich betreue (manchmal auch einigen Kollegen, wenn ich eine gemeinsame Veröffentlichung koordiniere), sage ich mitunter, dass das, was in der Schlussfolgerung steht, in die Einleitung gehört, in der zu Beginn die Leitlinien vorgestellt werden, nach denen die verschiedenen Teile des Textes und die darin enthaltenen empirischen Elemente angeordnet sind. Dadurch erhält die Empirie den Status von Beweisen, anstatt Rohinformationen zu bleiben. Die detaillierte Beschreibung eines biografischen Porträts oder einer statistischen Tabelle erfüllt den empirischen Anspruch der Soziologie und steht nicht im Widerspruch zu ihrem theoretischen und analytischen Anspruch, wenn der Autor vorab in der Einleitung oder den Teileinleitungen dargelegt hat, zu welchem Zweck er dieses Porträt oder diese Tabelle heranzieht.
Die empirische Darstellung kann Nuancen hinzufügen, außerdem kann sie dabei helfen, einen dogmatischen Charakter oder andere Bestätigungsfehler zu vermeiden. Zu diesen Zwecken sollte man die idealtypische Argumentation auf die eigene Schreibpraxis anwenden. Von Idealtypen weiß man, dass sie in der empirischen Realität nicht vorkommen, sondern eine Verständlichkeit ermöglichen sollen, die logischen Anforderungen genügt. Die idealtypische Argumentation besteht darin, zwischen der Konstruktion ‚reiner‘ Typen und der empirischen Darstellung zu unterscheiden, um die Abweichung zu messen zwischen der Realität und den Idealtypen, die konstruiert wurden, um ebenjene Realität zu erfassen.
Fußnoten
- Anm. des Übersetzers: Auch in Texten der deutschsprachigen Soziologie finden sich diese Passivformen, die, in den Worten Vincent Dubois’, das handelnde Subjekt verschleiern.
- Vincent Dubois, Contrôler les assistés. Genèses et usages d'un mot d'ordre, Paris 2021.
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Henriette Liebhart.
Kategorien: Daten / Datenverarbeitung Methoden / Forschung Universität Wissenschaft
Zur PDF-Datei dieses Artikels im Social Science Open Access Repository (SSOAR) der GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gelangen Sie hier.
Teil von Dossier
Über Schreiben sprechen
Vorheriger Artikel aus Dossier:
Nachdenken über die ästhetische Form von Ideen
Nächster Artikel aus Dossier:
„Schreiben hat einen kumulativen Charakter“
Empfehlungen
Science Outside the Box
Rezension zu „How to do social research with…“ von Rebecca Coleman, Kat Jungnickel und Nirmal Puwar (Hg.)
Big Data
Ein Soziopolis-Themenschwerpunkt zu einem allgegenwärtigen Begriff
Was war KI?
Rezension zu „Soziologie der Künstlichen Intelligenz. Perspektiven der Relationalen Soziologie und Netzwerkforschung“ von Roger Häußling, Claudius Härpfer und Marco Schmitt (Hg.)