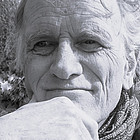Christoph Weischer | Rezension | 26.02.2025
Von Klimawandel und Klassenfrage
Rezension zu „Der neue sozial-ökologische Klassenkonflikt. Mentalitäts- und Interessengegensätze im Streit um Transformation“ von Dennis Eversberg, Martin Fritz, Linda von Faber und Matthias Schmelzer
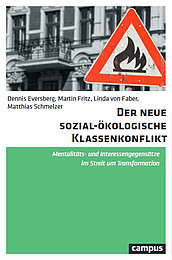
Das von Dennis Eversberg, Martin Fritz, Linda von Faber und Matthias Schmelzer verfasste Buch Der neue sozial-ökologische Klassenkonflikt widmet sich der Frage, wie sozioökonomische Bedingungen die politische Einstellung zu sozialökologischen Transformationsprozessen prägen. Vergleichbare Studien der jüngeren Vergangenheit billigen sozialstrukturellen Faktoren in diesem Kontext entweder einen sehr hohen oder umgekehrt einen eher geringen Einfluss zu. Mit dem vorliegenden Band positionieren sich die Autor:innen zwischen diesen beiden Polen.
Einleitend werden wichtige Begrifflichkeiten geklärt. Wenn die Autor:innen von einem „sozial-ökologischen Klassenkonflikt“ sprechen, grenzen sie sich sowohl von einem vereinheitlichenden Klassenverständnis (soziale Großgruppen) wie auch von einem deterministischen Zusammenhang zwischen Sozialstruktur und Klassenmentalität ab. Der Begriff soll vielmehr verdeutlichen, „dass es sich um einen gesellschaftlichen, in der inneren Logik moderner Vergesellschaftung und der in sie eingebauten Steigerungszwänge angelegten Konflikt handelt“ (S. 162). Die Konflikte, die mit einem sozialökologischen Gesellschaftswandel einhergehen, müssen entsprechend auf der „Ebene jener gesellschaftlichen Prozesse untersucht werden […], die Klassenverhältnisse hervorbringen“ (S. 15). Folglich hängen die unterschiedlichen (politischen) Haltungen zu Transformationsdebatten immer auch mit Interessengegensätzen zwischen Bevölkerungsgruppen zusammen. Bourdieus Ansatz folgend begreifen Eversberg et al. Mentalitäten als durch soziale Einflüsse verinnerlichte Denk- und Handlungsmuster – demnach als „Produkt der körperlichen, physischen Ablagerung von Erfahrungen mit der sozialen und natürlichen Umwelt“ (S. 17). Ob und wie sie den Mentalitäts- gegenüber dem Habitusbegriff abgrenzen, wird leider nicht deutlich.
Im zweiten Kapitel (S. 23 ff.) verweisen die Autor:innen auf verschiedene nationale Studien, die in der Bevölkerung zwar ein grundsätzliches Bewusstsein für die ökologische Problemlage aufzeigen, zugleich aber auch starke Beharrungskräfte und eine Veränderungsmüdigkeit konstatieren. In der deutschen Gesellschaft herrscht zwar weiterhin das Selbstbild vor, im Bereich des Klimaschutzes eine globale Vorreiterrolle einzunehmen – mit Blick auf international vergleichende Studien erweist sich dieses Narrativ jedoch als empirisch nicht haltbar.
Ausführlicher werden anschließend verschiedene soziologische Ansätze zum Verständnis dieser Transformationskonflikte analysiert: Im Kontext des Cleavage-Konzeptes (S. 33 ff.) wird von einer neuen kulturellen (kommunitaristisch-kosmopolitischen) Spaltungslinie ausgegangen. Andere (S. 36 ff.) wenden sich gegen polarisierende Diagnosen und verweisen darauf, dass viele Gegenwartskonflikte zwar eine Klassenspezifik aufweisen, eine Klassenpolarisierung aber nicht erkennbar sei. Wieder andere verorten die Konflikte um Klima und Ökologie im Lichte umfassenderer Kulturkonflikte (S. 42 ff.) der Spätmoderne, konstatieren eine neue ökologische Klasse (S. 45 ff.) oder sprechen von einer Doppelstruktur (S. 49 ff.) – Klassenachse und ökologische Achse.
Die Autor:innen gehen mit ihrer Diagnose eines „neuen sozial-ökologischen Klassenkonflikts“ (S. 54 ff.) davon aus, dass Verteilungskonflikte eng mit ökologischen Konflikten verwoben sind. So sei über Jahrhunderte ein Modell expansiver Vergesellschaftung entstanden, das durch die Wachstumslogik des Kapitalismus, durch Aufklärung, moderne Wissenschaft und Staatlichkeit aber auch durch Kolonialismus und Gewalt geprägt sei. Das Ergebnis dieser Entwicklung sei ein „flexibel-kapitalistisches Wachstumsregime“ mit Zentren und Peripherien, „in dem sozial-ökologische Lagen und Praktiken über vielfache Vermittlungsschritte zum Vorteil der einen und Nachteil der anderen miteinander verbunden sind“ (S. 62).
Zum Abschluss des theoretischen Teils erweitern die Autor:innen Pierre Bourdieus Ansatz des sozialen Raums um Transformationskonflikte, indem die Struktur der sozialen Positionen nicht nur im Hinblick auf Macht- und Herrschaftsverhältnisse, sondern auch auf gesellschaftliche Naturverhältnisse (S. 68) gedeutet wird. So gehe es in der Vertikalen auch um die aktive oder passive Einbindung in die expansiven Vergesellschaftungsprozesse; in der Horizontalen spiele immer auch das verfügbare Wissen und die Abhängigkeit beziehungsweise Unabhängigkeit vom Gemeinwesen eine Rolle. Der Bourdieu‘schen Logik folgend wird der so erweiterte Raum der sozialen Positionen mit einem Raum der sozial-ökologischen Mentalitäten in Bezug gesetzt (S. 68 ff.).
Für die empirische Modellierung dieses Raums greifen die Autor:innen auf die 2022 durchgeführte Umfrage „BioMentalitäten“ zurück, in der soziale und umweltbezogene Einstellungen, sozial-ökologische Alltagspraktiken und soziodemografische Daten erhoben wurden. Im dritten (S. 75 ff.) und vierten (S. 79 ff.) Kapitel wird die Studie vorgestellt. Die deskriptive Analyse der deutschen Gesamtpopulation untermauert das Bild „einer im Grundsatz einsichtigen, aber veränderungsunwilligen Bevölkerung“ (S. 85) und stützt damit ein in der sozialwissenschaftlichen Forschung häufig herangezogenes Erklärungsmodell.
Für eine differenziertere Aufschlüsselung werden im fünften Kapitel (S. 87 ff.) verschiedene Typen sozial-ökologischer Mentalitäten konzipiert: Diese auf der Basis einer vorbereitenden Hauptkomponentenanalyse und einer Clusteranalyse entwickelten zehn Mentalitätstypen ordnen die Autor:innen drei Spektren zu: einem ökosozialen Spektrum (26 Prozent), einem konservativ-steigerungsorientierten Spektrum (36 Prozent) und einem defensiv-reaktiven Spektrum (26 Prozent); die übrigen 7 Prozent weisen eine pauschale Zustimmungstendenz auf.[1]
Im sechsten Kapitel wird schließlich über eine multiple Korrespondenzanalyse aus den sozioökonomischen Informationen der Raum der sozialen Positionen konstruiert. In diesen werden auf Basis der Clustermittelpunkte die Mentalitäten als passive Variable eingefügt. Der Raum ist in der Vertikalen durch die Verteilung entlang von Ressourcen und Macht geprägt. In der Horizontalen stehen sich Gruppen gegenüber, deren Status eher auf Eigentum und Marktbeziehungen (rechte Seite) beziehungsweise auf Bildung und Strukturen des Gemeinwesens (linke Seite) beruht. Dementsprechend verteilt sich das ökonomische beziehungsweise kulturelle Kapital jeweils entlang einer Diagonalen. Die Schwerpunkte der drei Mentalitätsspektren finden sich im oberen linken (ökosozial) beziehungsweise rechten (konservativ-steigerungsorientiert) Quadranten sowie in der Mitte der beiden unteren Quadranten (defensiv-reaktiv). Die politischen Präferenzen wie die Zugehörigkeit zu Interessenverbänden korrespondieren im Durchschnitt mit den Mentalitätsspektren.
Die Autor:innen identifizieren in dem so aufgespannten Sozial- und Mentalitätsraum vier Konfliktachsen, entlang derer besonders stark differenzierte Haltungen angeordnet sind. Im siebten Kapitel (S. 127 ff.) untersuchen Eversberg et al. diese Konfliktlinien genauer:
- Bei dem Abstraktionskonflikt (Vertikale) spielen die Frage der Selbstwirksamkeit und Veränderungsbereitschaft sowie die Einstellungen zu Medien und Wissenschaft eine zentrale Rolle. Die Forscher:innen halten fest: „So wird die Vorstellung, mit eigenem Handeln etwas gegen ökologische Krisen bewirken zu können, von oben nach unten immer mehr verneint, den Medien wird weniger vertraut, Wissenschaft skeptisch oder kritisch gesehen, Politik wird vor allem unten im Raum als für das eigene Leben bedeutungslos wahrgenommen.“ (S. 132)
- Bei dem Lebensweisekonflikt (Horizontale) geht es um die Gewichtung von öffentlich-allgemeinen und privat-partikularen Interessen. Darunter fällt unter anderem die Präferenz der Befragten für eine stärkere oder schwächere Regulierung der Wirtschaft oder ihre Einstellung zum Auto – etwa als Ausdruck persönlicher Freiheit oder aber als Umweltbelastungsfaktor. Entsprechend unterscheidet sich die klimapolitische Haltung der Befragten entlang dieser Achse. Diese Konfliktlinie ist auch durch eine kulturelle Dimension geprägt, der im öffentlichen Diskurs ein zentraler Stellenwert zugeschrieben wird. Dies verdecke aber die Tatsache, „dass dahinter im Kern Unterschiede sozialer Positionen und damit verbundener Interessen an unterschiedlichen Lebensweisen verhandelt werden“ (S. 144). Dabei würden „Gemeinsamkeiten zwischen konservativ-steigerungsorientierten und defensiv-reaktiven Mentalitäten ins Zentrum gestellt, was die verbale Abgrenzung gegenüber der radikalen politischen Rechten zunehmend weniger überzeugend macht“ (S. 146).
- Der Veränderungskonflikt (Diagonale linksoben-rechtsunten) kreist um die Frage der Notwendigkeit, der Reichweite und der Kosten von Transformationsprozessen. Das macht sich beispielsweise an der Notwendigkeit der Substitution fossiler Rohstoffe und Energieträger, an den finanziellen Lasten aber auch an (unterstellten) Jobverlusten durch den Transformationsprozess fest. Sowohl im politisch medialen wie im wissenschaftlichen Raum findet sich nicht selten eine „Entgegensetzung von ‚grünen städtischen Bildungseliten‘ und ‚einfachen Leuten‘“; dies lenke von der eigentlichen Veränderungsblockade ab: „von den im oberen und rechten Raum und ganz besonders in den wirtschaftlichen Machtzentren bestimmenden Interessen an der Verteidigung von Privateigentum und seiner gegenwärtigen Verteilung“ (S. 152). Auch hier bestehe die Gefahr der „Entstehung dauerhafter Allianzen […] zwischen den konservativ steigerungsorientierten und defensiv-reaktiven Mentalitätsspektren“ (S. 152).
- Derzeit politisch kaum aufgeladen scheint der Externalisierungskonflikt (Diagonale rechtsoben-linksunten) zu sein. Hierbei geht es um Fragen der Verantwortungs- und Kostenverlagerung der ökologischen Krise. Exemplarisch machen die Autor:innen dies an der Bereitschaft der Befragten fest, Wachstumsverzicht zugunsten einer nachhaltigeren Wirtschaft hinzunehmen. Verglichen mit anderen Konflikten sind hier die empirischen Befunde jedoch wenig sozialräumlich differenziert.
Im achten Kapitel (S. 161 ff.) fassen Eversberg et al. die gewonnenen Einsichten zusammen, um daraus schließlich politische Handlungsempfehlungen abzuleiten. Für die gesellschaftlichen Entwicklungen seit der Befragung im Jahr 2022 versuchen sie Interpretationsansätze anhand ihres Analysemodells der Mentalitätsgruppen vorzulegen. Dabei nehmen sie insbesondere das Erstarken der AfD in den neuen Bundesländern in den Blick (S. 186 ff.).
Die vorgelegte Studie überzeugt durch eine stringente theoretische Argumentation und eine in sich schlüssige explorative empirische Analyse. Ausgehend von der sozialräumlich aufbereiteten Positions- beziehungsweise Mentalitätenlandschaft entwickeln die Autor:innen informierte und interessante Argumentationen. Doch bereits die umfangreichen Anmerkungen im Fußnotenapparat lassen darauf schließen, dass Eversberg et al. auch um die Grenzen der vorgelegten zuspitzenden Deutungen wissen. Das wird auch an den theoretisch entwickelten, empirisch aber kaum untermauerten Überlegungen zum Externalisierungskonflikt deutlich.
Abschließend einige verallgemeinernde Bemerkungen zur Einordnung der vorgelegten (und anderer) Publikation(en): Die Studie untersucht den Zusammenhang zwischen der Haltung der Befragten zu Schlüsselthemen der sozio-ökologischen Transformationsprozesse und ihrer sozialen Position beziehungsweise den damit verbundenen Interessenlagen. Sie steht dabei in konstruktiver Konkurrenz zu anderen Untersuchungen, die sich an einer sozialwissenschaftlichen Deutung der anstehenden Transformationsprozesse und der damit verbundenen Konflikte versuchen, auch um daraus politische Handlungsorientierungen entwickeln zu können.
All diese Studien sind mit dem Problem konfrontiert, dass sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt mögliche Konflikte und ihre politischen Folgen allenfalls abzeichnen. Man erfährt hier also vielmehr etwas über die klassischen, medial und politisch ausgetragenen Konflikte fossiler Gesellschaften sowie darüber, wie lagespezifische Erfahrungen die Sichtweise gegenüber den damit verbundenen Problemstellungen prägen.
Eine andere Schwierigkeit ergibt sich aus der typischen Datenbasis solcher Untersuchungen; sie gehen auf die (zumeist standardisierte) Befragung von Individuen zurück. Die mit den Transformationsprozessen verbundenen Konflikte werden daher aus einer sehr speziellen – individuellen und antizipierenden – Perspektive beleuchtet. Wesentliche Felder von Transformationskonflikten, die sich etwa aus den fundamentalen Veränderungen von Produktions- und Lebensbedingungen, aus der Konkurrenz von sich wandelnden Unternehmen, Branchen oder Nationalstaaten ergeben oder die mit neuen regulativen beziehungsweise sozialpolitischen Erfordernissen zusammenhängen, bleiben bei solchen Untersuchungen (zwangsläufig) unberücksichtigt.
Für die hier besprochene Studie heißt das, dass der Anspruch ein wenig ‚heruntergefahren‘ werden sollte. Wir können angesichts der geschilderten methodischen Probleme noch wenig über einen „neuen sozial-ökologischen Klassenkonflikt“ sagen. Wir erfahren etwas darüber, wie verschiedene soziale Gruppen auf Grundlage ihres kumulierten Erfahrungswissens – geprägt durch fossile Strukturen und externalisierende Praktiken – zukünftige Konflikte einschätzen. Nicht mehr und nicht weniger. Auch die wohlbegründete Rede von einem „Klassenkonflikt“ wird den zumeist weitaus differenzierteren Ausführungen nicht unbedingt gerecht.
Fußnoten
- Die Ausführungen zum defensiv-reaktiven Spektrum erinnern stark an eine von Michael Vester et al. 1991 in Westdeutschland durchgeführte Studie, in deren Rahmen die Forscher:innen gesellschaftliche Gruppen mit einer „enttäuscht-apathischen“ (13 Prozent) und „enttäuscht-aggressiven“ (14 Prozent) politischen Grundeinstellung ausmachten (Michael Vester / Peter von Oertzen / Heiko Geiling / Thomas Hermann / Dagmar Müller, Soziale Milieus im gesellschaftlichen Strukturwandel. Zwischen Integration und Ausgrenzung, Frankfurt am Main 2001, S. 464 und S. 467).
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Igor Biberman, Stephanie Kappacher.
Kategorien: Gesellschaft Kapitalismus / Postkapitalismus Ökologie / Nachhaltigkeit Sozialstruktur
Zur PDF-Datei dieses Artikels im Social Science Open Access Repository (SSOAR) der GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gelangen Sie hier.
Empfehlungen
Christoph Deutschmann, Hannah Schmidt-Ott
Wie geht es mit dem Wachstum bergab?
Folge 28 des Mittelweg 36-Podcasts
Die diffuse Angst, zu kurz zu kommen
Sechs Fragen an Eva von Redecker
Jenseits der Moral
Kommentar zu „Verkaufte Zukunft. Warum der Kampf gegen den Klimawandel zu scheitern droht“ von Jens Beckert