Berthold Vogel | Rezension | 18.11.2025
Wie man Empathiebrücken baut
Rezension zu „Geraubter Stolz. Verlust, Scham und der Aufstieg der Rechten” von Arlie Russel Hochschild
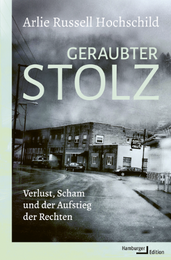
Pikeville im Bundesstaat Kentucky liegt eingebettet in der Bergwelt der Appalachen, fernab von den urbanen Zentren: Ländlicher Raum mit Industriegeschichte, aber eben Geschichte; zudem ein weit überwiegend „weißer“ Wahlkreis – und einer der ärmsten der Vereinigten Staaten. Das ist das geosoziale Umfeld der Studie Geraubter Stolz der amerikanischen Soziologin Arlie Russell Hochschild. In ihrem Landschaftsbild sehen wir Orte der Deindustrialisierung und Infrastrukturverluste, in denen sich Abstiegskämpfe und politische Radikalisierung ebenso finden wie tapfere Versuche der Selbstbehauptung und ein kämpferischer Überlebenswille. In den eindrucksvollen biografischen Porträts, die Hochschild in ihrer Studie zeichnet, zeigt sich, dass Scham und Stolz die Eckpunkte der Selbst- und Gesellschaftswahrnehmung der von ihr Befragten sind. Die Autorin legt sehr viel Wert darauf, zu zeigen, dass es sich hierbei um mehr handelt als um „Gefühle“, die kommen und gehen, aufwallen und abklingen. Scham und Stolz sind soziale Tatsachen. In ihnen spiegeln sich Status und Position. Sie repräsentieren die Koordinaten, an denen sich das Handeln, die Interessen und die Orientierungen der Menschen vor Ort ausrichten. Hochschild zeichnet in ihren soziografischen Exkursionen eine eindrückliche Kultur des Stolzes nach, deren Merkmale das Leben auf dem Land und in der Kleinstadt sind: stark männerdominiert, selbstversorgend und mit einem markanten Hang zum Individualismus. Status gründet auf der Fähigkeit, ein gutes Gehalt zu verdienen und eine eigene Familie versorgen zu können. Wer das erreicht hat und auf Dauer stellen kann, der darf berechtigterweise stolz auf sich sein. Doch wenn die Kohleminen schließen, wenn die lokale Wirtschaft in die Krise stürzt, und wenn die wirtschaftlichen Chancen vor Ort verloren gehen, dann wendet sich das Schicksal. Der Stolz verliert seine Grundlagen. Die eigene Lebenssituation wird als beschämend empfunden.
Die Grundlage dieser Soziografie gesellschaftlichen Wandels, die Status-Emotionen und die sozialen Positions-Affekte in den Vordergrund rückt, sind Interviews und teilnehmende Beobachtungen, die die Autorin über viele Jahre mit sehr unterschiedlichen Personen in der Gegend von Pikeville, Ost-Kentucky, geführt hat. Sie hat dabei eine „zweckgerichtete Stichprobe“ (S. 288) gezogen. So sprach sie mit Vertretern der lokalen Oberschicht, mit Bürgermeistern und Abgeordneten. Aber auch mit Personen, die als Straftäter und Drogensüchtige aus allen Bezügen gefallen oder als Rechtsextreme und „proud boys“ politisch aktiv sind. Ausgangspunkt ihrer Studie ist eine Demonstration von Rechtsextremisten in Pikeville, angeführt von einem landesweit bekannten Aktivisten, der ebenfalls zum Sample der Untersuchung zählt. Im Kern gilt ihre Studie allerdings der örtlichen Mittelschicht, also dem weiten Spektrum sozialer Lebenslagen, von Lehrkräften und Sozialarbeitern über Polizisten, Pastoren und Angestellten bis hin zu Handwerkern und kleinen Gewerbetreibenden. Hochschild praktiziert dabei eine verstehende Soziologie, die sich nicht auf das Verteilen von Fragebögen begrenzt oder auf die Recherche von Strukturdaten. Sie lebt vor Ort, fährt mit ihren Gesprächspartnerinnen und -partnern umher, trifft sich mit ihnen an unterschiedlichen Orten. Sie macht sich vertraut mit der Welt, in der sie forscht und betont die Intensität des Austauschs:
„Mit allen Personen, die in diesem Buch hauptsächlich vorkommen, traf ich mich ein halbes Dutzend Mal und öfter, häufig für mehrere Stunden. In jedem Interview fragte ich nach dem engeren und weiteren Familien- und Freundeskreis, um etwas über das Umfeld einer jeden Person zu erfahren. […] Im Laufe von sechs Jahren sprach ich mit achtzig Personen aus Kentucky.“ (S. 288 f.)
Ein typisches Beispiel für die Forschungsarbeit Hochschilds sind die Treffen der Autorin mit Geschäftsmännern wie Roger Ford, dem Organisator eines Autokorsos für Trump sowie für den Kohlebergbau. Ford ist zugleich ein Bewunderer der „illiberalen Demokratie“ à la Orban.
„Nach einigen einführenden Gesprächen lud Roger mich ein, einen Tag lang mit ihm durch die Bergtäler zu fahren, in denen er geboren wurde und aufgewachsen war. Eines Morgens brachen wir also auf und fuhren südlich von Pikeville über immer schmalere, gewundenere Bergstraßen. Wir passierten die Feuerwehr von Greasy Creek, die Kirche der Freewill-Baptisten, das Waffengeschäft Mountain Firearms, den Mobilheimhändler Adam´s Affordable Homes und fuhren durch Fords Branch zu einem Bergfriedhof. Wir kamen an Orten seiner Kindheit vorbei, an Häusern und kleinen Läden, die Verwandten von ihm gehörten. Unterwegs aßen wir in einem Diner zu Mittag und er erzählte lächelnd von der freundlichen Wirtin: ‚Wir sind verwandt. Ich bin hier mit jedem verwandt‘. Während ich am Tisch sitzen blieb, erzählte er ihr an der Theke, welche Bergdörfer er mir zeigte. ‚Ach, fahr nicht mit ihr da hin‘, riet sie ihm – wie er mir auf dem Rückweg ans Auto erzählte. Man weiß nie, was ein Fremder denken mag.“ (S. 206)
Es ist die besondere Leistung von Hochschild, dass auf diese Weise – wie schon in ihren vorangegangenen Studien – Porträts zustande kommen, die die interviewten Personen auf eindrucksvolle Weise in ihren sozialen, beruflichen, kulturellen und familiären Umgebungen einbinden. Niemand unter den Interviewten wird vorgeführt und in seinen Haltungen qualifiziert beziehungsweise klassifiziert. Die Leserin und der Leser werden nicht belehrt und moralisch unterwiesen. Es zählt der forschende Blick, der Nähe und Distanz ins Gleichgewicht bringt. Dieser soziografische Forschungstypus ist nicht nur hierzulande rar; ein Defizit, das es zu beheben gilt. Hochschild fordert das am Ende der Studie unter dem Stichwort „Empathiebrücken“ (S. 91 ff.) auch explizit ein. Auf diese Empathiebrücken kommen wir noch zurück. Doch was zeigen zunächst die Porträts?
Viele der von Hochschild in Geraubter Stolz porträtierten Gesprächspartnerinnen und -partner sind davon überzeugt, dass die Menschen vor Ort in Pikeville um etwas gebracht wurden, das sie verdient haben. Für sie alle ist der Zugang zu einem bescheidenen Wohlstand, der eine Stolzökonomie begründet, schwieriger geworden – ein Wohlstand, der ihnen aus ihrer Sicht aufgrund ihrer Lebensleistungen zustünde. Viele von ihnen sehen sich als Gefangene eines gesellschaftlichen Wandels, der sie beschämt, da er keinen Rückgriff auf die Vergangenheit zulässt, aber auch nach vorne kein Fortkommen ermöglicht. Doch der entscheidende Punkt ist, dass sie den Eindruck haben, man verweigere ihnen den Respekt. Sie sehen sich als Zurückgebliebene stigmatisiert, als Hinterwäldler ohne Bildung und ohne Manieren, die falsch leben, lieben, essen und wählen. Sie spüren die abschätzigen Blicke und Kommentare der Bessergestellten, der Akademikerklasse, der wohlhabenden Stadtbewohner. Die kulturelle Elite – so ihre Wahrnehmung – blickt auf sie herab, bemitleidet sie und glaubt zu wissen, was sie zu tun und zu denken haben. Daher sehen sie sich ein weiteres Mal ihres Stolzes beraubt. Denn es sind nicht nur die materiellen Verluste, die sie beschämen, sondern auch die symbolische Degradierung. Genau an diesem Punkt schlägt die Stunde derjenigen, die virtuos die Schamgefühle in Stolz transformieren. Die Bewohner Pikevilles – so zeigen die Ergebnisse bei Hochschild – sind keineswegs naiv; jedenfalls nicht so naiv wie diejenigen, die hierzulande kopfschüttelnd danach fragen, warum eigentlich die Arbeiter in den USA gegen ihre (von außen definierten) Interessen wählen, wenn sie pro Trump votieren. Die Trump-Unterstützer in Hochschilds Studie glauben nicht, dass Donald Trump und seine MAGA-Bewegung ihre Probleme grundsätzlich lösen könnten oder würden. Aber sie haben bei Trump und den Seinen das Gefühl, ihre Probleme würden gesehen, ihre Lebensweise fände die ihr gebührende Anerkennung. Am Ende des Buches wird von einem Bergmann berichtet, der sich als Teil des „Abraums“ in einer Kohleregion empfand.
„Als Bergmann hatte er einen Arbeitsunfall gehabt und gegen die Schmerzen OxyContin genommen, das ihn süchtig gemacht hatte. Der Mann hatte seine Arbeit, seine Ehe und sein Sorgerecht für die Kinder verloren und erst kürzlich seinen Weg aus der Medikamentenabhängigkeit gefunden. Er sah 2016 eine Wahlkampfrede von Donald Trump und erzählte […]: ‚Als Trump uns sagte, er würde die Kohle wiederbringen, wusste ich, dass er log. Aber ich hatte das Gefühl, dass er sah, wer ich war‘.“ (S. 275)
Die Trumpsche Bewegung erweist sich als Stolz-Unternehmen, das die Menschen direkt bei ihrer sozialen Scham – wie es so schön heißt – abholt. Wie schon in ihren vorhergehenden Publikationen[1] rückt auch diesmal, in Kentucky, das Thema der Fremdheit beziehungsweise der politischen Entfremdung in den Mittelpunkt. Menschen aus der Arbeiterschaft oder der unteren Mittelklasse finden sich in den öffentlich so viel debattierten Themen introvertierter Identitätsfindung mit ihren eigenen Sorgen und Anliegen nicht mehr wieder. Die Frage lokaler Lebensbedingungen, die Sorge um die Arbeit der Kinder, die zu großen Teilen Pikeville bereits den Rücken gekehrt haben, die Unsicherheit der Gesundheitsversorgung finden keinen Widerhall, wenn sich öffentliche Debatten und wissenschaftliche Expertise auf individuelle Identitätsproblematiken konzentrieren. Politik scheint ungerecht, nicht im Sinne höherer Prinzipien, sondern im Sinne einer Politik, die den Anliegen der Menschen nicht mehr entspricht. So zählen aus der Perspektive vieler Befragter nicht mehr die Probleme der weißen Arbeiterklasse, sondern die weiße Arbeiterklasse wird selbst als das Problem definiert. Denn sie hält traditionelle Familienwerte und deren Geschlechterordnung hoch, sie isst gerne Fleisch und sie fährt mit spritfressenden Verbrennungsmotoren durch die Gegend. Politische Kräfte, die darauf verweisen, dass die, die ihr ganzes Leben hart gearbeitet haben, es nicht nötig haben, sich ihren Lebensstil vorschreiben zu lassen, haben dann ein leichtes Ressentiment-Spiel. Dieser Mechanismus greift nicht nur in den USA, sondern überall – und ist im Prinzip nicht so schwer zu verstehen. Fremdheitsverstärkend kommt hinzu, dass aus dem unmittelbaren Lebensumfeld der Bewohner von Pikeville öffentliche Infrastrukturen sukzessive verschwinden. Aspekte sozialräumlicher Disparität gewinnen an Gewicht. Wie werden das eigene Wohnquartier oder Dorf, die eigene Nachbarschaft und die lokalen Verhältnisse erlebt und bewertet? Finden sich hier unterstützende Strukturen oder ist der Wohnort nur noch Ballast und Statusnachteil? Prozesse der Deinfrastrukturalisierung und des Entzugs öffentlicher Güter verändern nachhaltig die Wahrnehmung sozialer Ungleichheit.
Das Buch enthält zahlreiche Details und soziale Miniaturen aus dem Alltagsleben in Ost-Kentucky. Das macht die Geschichte des geraubten Stolzes und der brennenden Scham anschaulich. Doch bemerkenswert an Hochschilds Buch sind weniger die konkreten Befunde. Im Prinzip erzählt sie in Geraubter Stolz die Geschichte aus „Fremd in ihrem Land“ fort. Seinerzeit war sie in Louisiana unterwegs, nun in Kentucky. Die Haltungen, die Orientierungen, die Mentalitäten ähneln einander. Hochschild folgte damals schon der richtigen Spur. Mit ihrer aktuellen Untersuchung bekräftigt sie noch einmal, dass Gesellschaftswahrnehmung nicht allein von Gehaltszahlungen abhängt, nicht nur Ausdruck von materiellem Sein ist. Stolz, Scham, Respekt, Neid – das ist die harte Währung, in der gezahlt wird. Die Grundlage und die Referenzpunkte dieser Währung sind eben nicht nur Betrieb und Arbeitsplatz, sondern auch Familie, Nachbarschaft und Lebensumfeld.
Von höchster Relevanz und stilprägend sind zwei andere Punkte in Geraubter Stolz: Erstens die besondere Methode, mit der Hochschild forscht. Sie macht sich wiederum soziografisch, lokal gebunden, qualitativ-offen und mit ausdauernder Beharrlichkeit auf den Weg in eine fremde Welt im eigenen Land. Hochschild verfügt über die Gabe des analytischen Verstehens und vermag es, aus ihren Exkursionen durch Ost-Kentucky und aufgrund ihrer langjährigen Gespräche und Kontakte im ärmsten und weißesten Wahlbezirk der USA zeitdiagnostische Erkenntnisse zu gewinnen, die weit über die Untersuchungsregion hinaus gehen. Ihre Vorgehensweise bestätigt erneut, dass aus der Praxis der lokalen Fallstudie immer wieder die produktivste Sozialforschung erwächst. Das war zu Zeiten der Marienthal-Studie[2] so und das setzt sich fort. Damit ist ein zweiter Punkt verknüpft, der höchste Aufmerksamkeit für unsere Diskussion zu Zustand und Zukunft unserer Gesellschaften verdient. Die Rede ist von Hochschilds Konzeption der Empathie. Während sie in ihrer Studie „Fremd in ihrem Land“ noch von „Empathiemauern“ sprach, nimmt sie nun die „Empathiebrücken“ und die „Brückenschläger“ in den Blick, für die sie deutlich mehr soziologische und gesellschaftliche Aufmerksamkeit einfordert. Dabei definiert sie Empathie und macht in ihrem Untersuchungsfeld zwei Empathiemuster aus:
„Empathie bedeutet nicht, zuzustimmen oder Gemeinsamkeit zu suchen, auch wenn dies leichter daraus folgen mag. Es heißt lediglich, sich in andere hineinzuversetzen. Mir fiel auf, dass manche Brückenschläger zwei biografische Muster in Bezug auf Stolz und Scham aufwiesen. Ein Lebensmuster ist, ‚aufsteigen, zurückgeben und die Hand ausstrecken‘. Eine solche Person erhebt sich über die Angst vor Scham, […] was es ihr ermöglicht, anderen die Hand zu reichen. Ein zweites Lebensmuster ist, ‚einen Tiefpunkt zu erreichen, aufzustehen und die Hand auszustrecken‘. Eine solche Person ist nicht über Scham erhaben, sondern durchlebt Scham, leidet darunter, verliert die Angst davor und macht von da aus weiter.“ (S. 255)
Hochschilds Empathie-Definition erinnert an die Debatten über gesellschaftlichen Zusammenhalt, die auch hierzulande seit einigen Jahren intensiv geführt werden. Viel zu oft wird Zusammenhalt als eine konsensuelle Gemeinschaftsbildung klassifiziert, die kritisch zu betrachten oder abzulehnen sei. Dabei geht es bei der Frage nach der Qualität des Zusammenhalts einer Gesellschaft weder um den Zwang zur Zustimmung noch um gemeinschaftlich erzeugten Konsens (der sich im Zweifelsfall gegen andere richtet).
Zusammenhalt als soziale Praxis ist im Hochschildschen Sinne des Brückenbauens eher die Praxis des Aufeinander-Zugehens, ist Ausdruck der Fähigkeit, Beziehungen herzustellen und mit dem sozialen Gegenüber in Kontakt und Austausch zu treten. Wer Brücken baut, der schafft zunächst die Gelegenheit zur Begegnung. Er trifft damit noch keine Aussage darüber, ob ihm oder ihr alle sympathisch sein werden, die diese Brücke betreten. Aber dass sie eine Brücke betreten, ist der erste Schritt zu einem gesellschaftlichen Miteinander, zu Gespräch und Verständigung, zu Kompromissbildung und Balance. Wer Mauern baut, welcher Art und gegen wen auch immer, wird diesen ersten Schritt niemals ermöglichen. Doch ob in den USA oder in unseren Breitengraden – zu oft ist die Soziologie selbst ein Schauplatz der Zurschaustellung vermeintlich korrekter Einstellungen oder Haltungen. Doch liest man Hochschild, dann wird deutlich, dass nicht der politische Kampf oder die richtige Gesinnung das wissenschaftliche Ethos orientieren sollten, sondern das Prinzip des Verstehens und der Empathie. Soziologie und Sozialforschung dürfen keine Methode sein, Mauern zu errichten. Vielmehr können die Gesellschaftswissenschaften in diesen Zeiten für sich das Privileg in Anspruch nehmen, Brücken zu bauen. Und um Brücken zu bauen, braucht es konkrete Orte, mit ihrer je spezifischen Atmosphäre und ihrem besonderen sozialen Klima. Das Lokale zählt. Von dort aus kann die Erneuerung einer offenen, freien, demokratischen Gesellschaft gelingen. Das ist die Hoffnung, die uns Hochschild mitgibt. Sie fordert nicht weniger als eine neue soziologische Aufklärung – und das heißt: Menschen zu sehen, sie in ihrer sozialen Wirklichkeit sichtbar zu machen und vor allen Dingen ihre Gesichter zu zeigen, sie als Personen erkennbar zu machen. Eine kluge, empathische Sozialforschung besitzt diese Kraft zum Porträt – Hochschild zeigt das in Geraubter Stolz auf eine sehr eindrückliche Weise.
Fußnoten
- Arlie Russell Hochschild, Fremd in ihrem Land. Eine Reise ins Herz der amerikanischen Rechten, übers. von Ulrike Bischoff, Frankfurt am Main 2017.
- Marie Jahoda / Paul F. Lazarsfeld / Hans Zeisel, Die Arbeitslosen von Marienthal. Ein soziographischer Versuch über die Wirkungen langandauernder Arbeitslosigkeit, Frankfurt am Main 1982 [1933].
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Jens Bisky.
Kategorien: Affekte / Emotionen Arbeit / Industrie Gesellschaft Politik Soziale Ungleichheit
Empfehlungen
Anerkennung als Schlüsselkategorie
Rezension zu „Prekäre Arbeit, prekäre Liebe. Über Anerkennung und unsichere Lebensverhältnisse“ von Christine Wimbauer und Mona Motakef
„Das Gleichheitsversprechen der Demokratie läuft empirisch für sehr viele Menschen ins Leere“
Fünf Fragen an Naika Foroutan zum Thema des diesjährigen DGS-Kongresses
Vom Generalgefühl der Überforderung
Rezension zu „Triggerpunkte. Konsens und Konflikt in der Gegenwartsgesellschaft“ von Steffen Mau, Thomas Lux und Linus Westheuser
