Marc Strotmann | Rezension | 27.05.2025
Bioethik als flexible Machtform
Rezension zu „Biegsame Expertise. Geschichte der Bioethik in Deutschland“ von Petra Gehring
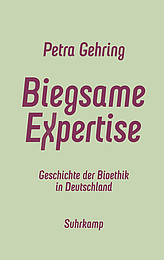
In ihrer groß angelegten Studie Biegsame Expertise untersucht die Darmstädter Philosophin Petra Gehring die Geschichte der deutschen Bioethik. Ihre Analyse ist – dies lässt sich direkt zu Beginn festhalten – eine hochgradig originelle Wissen(schaft)sgeschichte. Warum sich Bioethik (auch in Deutschland) so erfolgreich als erwünschter Modus der Problematisierung durchsetzen konnte, erscheint bei näherer Betrachtung nicht selbstverständlich. Gehring vermeidet es, typische Erklärungsansätze zu bedienen: Weder beschreibt sie den vielfach beschworenen Ethikbedarf der vergangenen drei Jahrzehnte als Stabilisierung einer jungen Disziplin noch setzt sie ihn mit zunehmender Professionalisierung gleich. Doch wovon handelt Biegsame Expertise und die in ihr behandelte Geschichte der Bioethik in Deutschland dann? Folgt man Gehring durch das Gestrüpp biopolitischer Grundsatzfragen, erscheint Bioethik als eine Form des Handelns und Sprechens, die sich als ausreichend plastisch, weich – bioethische Ratschläge sind formal-rechtlich nicht bindend – und griffig erwiesen hat, um Verflechtungen zu tradierten Wissensbereichen (Recht, Medizin, Philosophie) herzustellen und sich so im Grenzgebiet zwischen Wissenschaft, Politik und Medien zu bewegen. Durch ihren anwendungsorientierten Zugriff und ihr „interdisziplinäres Pathos“ (z.B. S. 248) konnte sich die Bioethik als biegsame Haltung in „Wissens- und Wertkonflikten“[1] behaupten. Die Frage nach ihrem Einfluss zieht sich als roter Faden durch Gehrings verästelte, überaus faszinierende Untersuchung.
Bioethische Debatten sind zu einem alltagspolitischen Aushandlungsmodus[2] geworden, der existenzielle Fragen rahmt und verhandelbar macht: Zu denken ist an Auseinandersetzungen über Sterbehilfe, Embryonenschutz, Organtransplantation oder Reproduktionsmedizin. Auch wenn die genannten Phänomene und die sie begleitenden Kontroversen nicht zu vereinheitlichen sind, zeugen sie alle von den immens gewachsenen Handlungsspielräumen in den Biowissenschaften und der Biomedizin seit dem Zweiten Weltkrieg. Beide Disziplinen prägen unser Verständnis davon, was Leben ist und wie veränderlich es sein sollte. Das Interesse Gehrings gründet indes nicht in der Annahme, dass es der Bioethik gelungen sei, die gestiegenen Gestaltungspotenziale der Lebenswissenschaften einzuhegen oder ihnen eine Verantwortung für das eigene Tun abzuringen.
„Was ist Bioethik eigentlich? Was macht sie aus, […] was gibt ihr – als ‚angewandte Ethik‘, die sie sein will – Erfolg und Macht?“ (S. 8)
Zu Beginn ihres fast 1200 Seiten umfassenden Buches merkt sie an, dass Bioethik, zumal in Deutschland, ein junges Phänomen sei, dessen konkrete Wirkung Rätsel aufgebe: „Was ist Bioethik eigentlich? Was macht sie aus, […] was gibt ihr – als ‚angewandte Ethik‘, die sie sein will – Erfolg und Macht?“ (S. 8) Gehring will verstehen, wie Bioethik „verfertigt“ (S. 7) wird. Diese Bezeichnung erinnert unweigerlich an das Vorhaben bekannter laborethnografischer Untersuchungen, der „Fabrikation von Erkenntnis“[3] nachzuspüren; mit dem Unterschied, dass Bioethik keinen leicht aufzusuchenden Ort wie das Labor hat. Die Studie auf einzelne Schauplätze zu beschränken – soziologische Arbeiten identifizierten hierfür Gremien wie den Deutschen Ethikrat[4] –, würde das Dasein der Bioethik als „permanent improvisierenden Diskurs inmitten anderer Diskurse“ (S. 21) missachten und wäre taub für ihre „rhetorische Seite“ (S. 9). Gehrings Analyse, die sie auf den Zeitraum von 1970 bis 2010 eingrenzt, ist lose am Diskursverständnis der frühen Arbeiten Michel Foucaults[5] orientiert, wobei die Autorin einräumt, es bedürfe eines „maßgeschneiderten wie zugleich gemischten Zugangs“ (S. 9). Entsprechend bezieht sie eine Fülle von textbasierten Materialien ein: Gesetzestexte, wissenschaftliche Beiträge, Medienerzeugnisse und politische Stellungnahmen. Hervorzuheben sind aber vor allem die von ihr geführten Interviews mit neunzig Zeitzeug:innen, die aktiv an der Etablierung der Bioethik in Deutschland beteiligt waren. Über das gesamte Buch zitiert sie Auszüge aus diesen Gesprächen, zumeist in Fußnoten. Sie verleihen Gehrings Arbeit eine Konkretheit, die es ihr gewährt, über vorliegende Ausführungen zur Bioethik hinauszugehen.[6]
Biegsame Expertise ist in vier Abschnitte unterteilt. Zunächst ordnet Gehring in der Einleitung den deutschen Weg der Bioethik ein (Abschn. 1), um im Anschluss die verästelte Genese der Bioethik zwischen denjenigen etablierten Disziplinen nachzuzeichnen, die an ihr teilhaben, sich aber auch von ihr abgrenzen (Abschn. 2), sowie wichtige „Spielorte“ (S. 19) der Bioethik außerhalb der Wissenschaft dahingehend zu untersuchen, wie sie bioethische Problematisierungen fixieren und bewegen (Abschn. 3). Den Abschluss bildet die Darstellung von Bioethik als Form und eine Diskussion der Macht dieser Form (Abschn. 4). Die einleitenden Überlegungen zum deutschen Entstehungszusammenhang nehmen wenig Raum ein, erhellen aber wichtige Aspekte für Gehrings Argumentation. Zunächst kartiert sie einige konstante „bioethische Diskussionsstoffe“ (zum Beispiel Sterbehilfe, S. 30) sowie ereignishafte Einschnitte, wie den Fall des sogenannten Erlanger Babys,[7] die öffentlich-medial teilweise schockartig erlebt wurden und (wissens-)politisch den Ruf nach Ethik plausibilisiert haben. Der Überblick zu einer sich entwickelnden „Themenlandkarte“ (S. 30) der Bioethik bietet eine willkommene Orientierungshilfe für die Leser:in und ist zudem methodologisch instruktiv: Denn obgleich einzelne Themen und Ereignisse aus dem Strom bioethischer Diskurse auffällig herausstechen, bieten sie keine Erklärung dafür, warum die Bioethik in Deutschland (erst) ab den 1980er-Jahren – damit zehn Jahre später als in den USA – erkennbare Konturen annahm. Da Bioethik in Gehrings Interpretation „Sprechen und Handeln komplex verklammert“, lässt sich „keine schlierenlose Anordnung von allem, was wichtig war“ vornehmen (S. 72). Eine Ereignisgeschichte wäre somit genauso ungenügend wie die Vermutung, Bioethik in Deutschland stehe in einer Kontinuität mit der Aufarbeitung der NS-Medizin und NS-Forschung. Gehring markiert frühzeitig, dass der Nationalsozialismus für Bioethikdebatten zwar eine „wichtige Hintergrundfolie“ (S. 40) abgebe, die Verurteilung von NS-Menschenversuchen nach 1945 sei allerdings nicht erkennbar Thema einer Ethik gewesen, „die danach quasi von sich aus in Bioethikdebatten münden würde“ (S. 41).
In der Folge ist es das Anliegen der Philosophin, „das Gewimmel von Ereignissen“ zu ersetzen durch „eine Ebene des professionell geordneten ‚Redens über…‘“ (S. 73). Dafür wählt sie einen Zugang, der die Verfertigung von Bioethik durch das Prisma der Disziplinen und Institutionen bricht, die sich an ihr abgearbeitet haben: bestimmte Bereiche des Rechts, der Medizin und der Philosophie, außerdem Gentechnologie, Theologie und Sozialwissenschaften. Als Institutionen nennt Gehring die Politik, die Medien, aber auch zivilgesellschaftliche Bewegungen wie den Feminismus sowie die Bioethikkritik. Diese Ordnung mutet nur auf den ersten Blick etwas starr an. Denn auch wenn die einzelnen Kapitel chronologisch aufgebaut sind und die Autorin bestimmte Schlüsselmomente der Bioethik wiederholt aufgreift – so etwa den Streit um die utilitaristischen Positionen des Philosophen Peter Singer Mitte der 1990er-Jahre –, verfügen die Kapitel nicht über eine einheitliche Systematik und sind auch einzeln lesenswert.
Gehring gelingt es mit eindringlicher analytischer Schärfe, die heterogenen Einflüsse darzustellen, die Bioethik als angewandte Ethik auf die genannten Disziplinen und Institutionen hat. Einerseits sorgen bioethisch aufgeworfene Problemstellungen dafür, dass sich etablierte Wissensfelder genötigt sehen, auf biomedizinische und biotechnische Themen zu reagieren und praktische Lösungen bereitzustellen. Andererseits nutzen Akteure und Institutionen bioethische Kontroversen, um ihre Handlungs- und Einflussmöglichkeiten zu vergrößern (zum Beispiel bezüglich der Regulierung neuer Technologien). Am zwiespältigen Verhältnis zur Philosophie zeigt sich allerdings, dass Bioethik nicht immer instrumentell eingesetzt wird, um disziplinär begrenzte Gestaltungschancen zu erweitern. Nach wie vor zögern Philosoph:innen, den breiten „Grenzstreifen“ zu überqueren, um sich „auf angewandte oder bereichsethische Fragen“ einzulassen (S. 614), bei denen es sich angesichts der Entwicklungen in der KI-Forschung längst nicht mehr nur um biopolitische Problemstellungen handelt.
Bioethik manövriert zwischen wissenschaftlich angewandter Reflexion, politisch inklusivem Meinungsaustausch und medial lukrativen Debatten.
Es ist vor allem Gehrings Sensibilität für die informellen, performativen Anteile der Bioethik, weshalb ihre Analyse eine überaus lehrreiche Lektüre ist. Biegsame Expertise macht die stilisierten, oft mit Pathos versehenen, aber auch mit Härte vollzogenen Sprech- und Handlungsakte sichtbar, durch die „Zwischenräume“[8] überhaupt erst entstehen: Bioethik manövriert zwischen wissenschaftlich angewandter Reflexion, politisch inklusivem Meinungsaustausch und medial lukrativen Debatten. Treffend konstatiert Gehring, bioethische Expertise stehe offenbar für das „Verlassen einer bestimmten, fixierten Fachlichkeit und für eine flexible Adaption auch an das, wofür man […] keine Expertise besitzt“ (S. 1089). Angesichts der Beweglichkeit bioethischer Diskurse und der darin involvierten Akteure ist es beeindruckend, wie die Philosophin Zugang zu ihrem Gegenstand gewinnt. Insbesondere da es Letzterem vor allem zum Zeitpunkt seiner Entstehung an einer „in welchem Sinne auch immer ‚empirisch‘ zu nennenden Beobachtbarkeit“ (S. 624) fehlte. Ihr Schreiben ist wendungsreich und formulierungsfreudig, behält aber durchgehend seine analytische Klarheit. Dabei sorgt Gehring durch ihr Gespür für die performativen (Zwischen-)Töne bioethischer Positionierungen für eine Verschiebung bisheriger Bewertungen: Das Phänomen einer feldübergreifenden „Ethisierung“[9] von Wissens- und Technikkonflikten zeigt sich in seiner Multifunktionalität, „sofern sehr viele auf sehr unterschiedliche Weise“ von der Existenz der Bioethik „und den flexiblen Verfahrensformaten, gepaart mit Diskursstrategien, die sie bereitstellt, profitieren“ (S. 1186).
Doch worin liegt nun die Macht der Bioethik als Form, die sie, selbst als Abgrenzungsfolie, attraktiv erscheinen lässt? Im Anschluss an ihre weitläufigen Untersuchungen zur Entstehung von Bioethik in der Landschaft etablierter Disziplinen und Institutionen spannt Gehring den Bogen zu ihrer eingangs gestellten Frage. In der abschließenden Diskussion erörtert sie die möglichen Funktionen, die Bioethik in Deutschland an der Schnittstelle von Wissenschaft und Gesellschaft (nicht) ausfüllt. Wer diesen Punkt von Biegsame Expertise erreicht hat – beim Umfang von über tausend Seiten sind einige Längen zu passieren –, ist kaum verwundert darüber, dass Gehring keine einfache Diagnose stellen will und verspürt vielleicht Enttäuschung darüber, dass der Begriff der Form selbst unterbestimmt bleibt. Allerdings wird Gehring nur so ihrem Gegenstand gerecht, der sich als „enorm flexible Machtform“ (S. 1193) erweist, die „biegsam“ ist, „aber alles andere als passiv“ (S. 1194) verfährt. Bioethik in Deutschland hat entscheidend an einem biopolitischen Normwandel mitgewirkt, der die Grenzen zwischen Labor, Therapie und Lebenswelt sukzessive aufweicht. Scheinen durch die daraus resultierende Veralltäglichung biomedizinischer und biotechnischer Dienstleistungen bioethische Probleme weniger dringlich? Diese und andere reizvolle Anschlussfragen trägt Gehrings eindrückliche Analyse zukünftigen Forschungsvorhaben auf.
Fußnoten
- Alexander Bogner / Wolfgang Menz, Wissen und Werte im Widerstreit. Zum Verhältnis von Expertise und Politik in der Corona-Krise, in: Leviathan 49 (2021), 1, S. 111–132.
- Typische Mittel dieses Modus sind die Gegenüberstellung von Pro und Kontra wissenschaftlicher und technologischer Neuerungen sowie ihre Engführung auf potenzielle Dilemmata.
- Karin Knorr-Cetina, Die Fabrikation von Erkenntnis. Zur Anthropologie der Naturwissenschaft, Frankfurt am Main 1984.
- Vgl. Armin Nassehi / Irmhild Saake / Niklas Barth, Die Stärke schwacher Verfahren. Zur verfahrensförmigen Entdramatisierung von Perspektivendifferenzen im Kontext der Organspende, in: Zeitschrift für Soziologie 48 (2019), 3, S. 190–208.
- Michel Foucault, Die Archäologie des Wissens, übers. von Ulrich Köppen, Frankfurt am Main 1973. Vgl. zudem Petra Gehring, Was ist Biomacht? Vom zweifelhaften Mehrwert des Lebens, Frankfurt am Main / New York 2006, insbes. Kap. 7.
- Gehring hat ihr Anliegen bereits vor gut zehn Jahren skizziert. Vgl. dies., Fragliche Expertise. Zur Etablierung von Bioethik in Deutschland, in: Michael Hagner (Hg.), Wissenschaft und Demokratie, Berlin 2012, S. 112–139.
- 1992 hatte ein Team von Mediziner:innen am Universitätsklinikum Erlangen versucht, den Fötus einer schwangeren, nach einem schweren Unfall für Hirntod erklärten Frau am Leben zu erhalten. Der Fall erzielte ein breites mediales Echo, wobei das Vorgehen der Mediziner:innen unter anderem aus feministischer Sicht scharf kritisiert wurde.
- Zum Verständnis von Zwischenräumen vgl. Gil Eyal, Spaces between Fields, in: Philip S. Gorski (Hg.), Bourdieu and Historical Analysis, Durham, DC / London 2013, S. 158–182; sowie Philippe Saner, Datenwissenschaften und Gesellschaft. Die Genese eines transversalen Wissensfeldes, Bielefeld 2022.
- Alexander Bogner, Die Ethisierung von Technikkonflikten. Studien zum Geltungswandel des Dissens, Weilerswist 2011.
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Henriette Liebhart.
Kategorien: Gesundheit / Medizin Körper Macht Medien Normen / Regeln / Konventionen Philosophie Recht
Zur PDF-Datei dieses Artikels im Social Science Open Access Repository (SSOAR) der GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gelangen Sie hier.
Empfehlungen
Herausforderndes Verhalten
Rezension zu „Staatliche Ordnung und Gewaltforschung. Zur Rolle von Gewalt in der stationären Pflege von Menschen mit Demenz“ von Jonas Barth
„Die ungeheure Geschwätzigkeit des Todes“
Literaturessay zur Thanatosoziologie
Die Möglichkeit der Normen
Ein Buchforum in Kooperation mit theorieblog.de und voelkerrechtsblog.com
