Ekkehard Coenen | Rezension | 07.09.2023
Herausforderndes Verhalten
Rezension zu „Staatliche Ordnung und Gewaltforschung. Zur Rolle von Gewalt in der stationären Pflege von Menschen mit Demenz“ von Jonas Barth
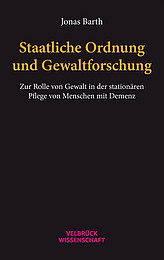
Das Thema Gewalt in der Pflege wird immer wieder in den Medien diskutiert. Die entsprechenden Berichte thematisieren meistens nur die Gewalt, die von Pflegekräften ausgeht, und stellen sie als moralisch verwerflich dar. Handlungen von Gepflegten, die in einem anderen Kontext als Gewalt gelten könnten, finden wiederum selten Berücksichtigung. Warum wird Gewalt in der stationären Pflege so einseitig betrachtet? Gibt es im Pflegebereich andere Normen, Deutungsmuster und Legitimationsweisen von Gewalt? Diese Fragen beschäftigen Jonas Barth in seiner kürzlich veröffentlichten Dissertation.
Gesellschaftstheoretisches Warm-up
Bisherige Studien zu Gewalt in der Pflege thematisieren Barth zufolge kaum bis gar nicht, dass die Deutung von Handeln als Gewalthandeln aus der uns umgebenden sozialen Ordnung resultiert. Stattdessen analysierten sowohl die Pflegewissenschaften als auch die Soziologie Gewalt zumeist als normatives Problem – als ein Übel, das vor allem destruktiv wirke und deshalb einzuhegen sei. Eine solche Perspektive hält Barth für grundsätzlich schwierig, da Gewalt dabei von Anfang an als etwas Illegitimes konzipiert würde. Die bisherigen empirischen Befunde und theoretischen Werkzeuge der Gewaltforschung seien somit wenig zur Untersuchung des Verhältnisses von Gewalt und Ordnung zu gebrauchen. Sie gehörten selbst viel zu sehr zu einem für die Moderne typischen institutionalisierten Verständnis von Gewalt, das sie nicht erfassen könnten, sondern nur unkritisch reproduzierten. Barth sieht es daher als Notwendigkeit, „Gewalt nicht substanziell zu definieren, sondern als institutionalisierten Sachverhalt zu begreifen“ (S. 38).
Wie der Autor selbst einräumt (vgl. S. 16), ist seine Arbeit ungewöhnlich aufgebaut: Vor den sozialtheoretischen Grundlagen und der methodischen Umsetzung der Arbeit erörtert er seine gesellschaftstheoretische Perspektive. Allerdings ist die vorangestellte Gesellschaftstheorie durch die erst später vor der Leserschaft ausgebreiteten Empirie beeinflusst, sodass bereits zu Beginn Erkenntnisse aus der ethnografischen Untersuchung vorweggenommen werden. Barths Ergebnisdarstellung ist zwar konsequent und nachvollziehbar, der Vorgriff erschwert jedoch die Lektüre.
Das gesellschaftstheoretische Fundament der Untersuchung bilden Gesa Lindemanns Überlegungen zu den Verfahrensordnungen der Gewalt,[1] die er produktiv weiterentwickelt. Personalität und Gewalt seien zwei nicht voneinander zu trennende Bedingungen sozialer Prozesse. Die Würde einer Person sei nicht nur an Anerkennung gebunden, sondern stehe auch in einem engen Verhältnis zu Gewalt. Ersichtlich sei diese Verknüpfungen daran, „dass sich Personalität heute schlecht ohne Menschenrechte und dass sich Menschenrechte heute schlecht ohne Gewalt denken lassen“ (S. 70). Gewalt definiere sich, im Rückgriff auf Lindemann, als „ein vermittelt unmittelbares leiblich-symbolisches Geschehen“ (S. 170). Sie sei darüber hinaus eine Reaktion auf enttäuschte Erwartungen, also ein Ausdruck der Gültigkeit von Normen.
Von gewaltlosen Gepflegten und Pflegekräften als potenziellen Gewalttäter:innen
Barths Untersuchung basiert auf einer sechsmonatigen ethnografischen Beobachtung in einer Pflegeeinrichtung, die auf die Pflege von Demenzkranken spezialisiert ist. Zudem bezieht er sich auf teilnarrative Interviews mit Pflegepersonal und Bewohner:innen, bestehende Forschungen und den öffentlichen Diskurs zu Gewalt in der Pflege, insbesondere auch das SGB XII.[2] In der Darstellung seiner Ergebnisse widmet sich Barth zunächst system- und praxistheoretischen Überlegungen zur Pflege. Sie sei kein eigenständiges Teilsystem der Gesellschaft, sondern ein Exklusionsbereich innerhalb der Medizin. Damit ist gemeint: Dass eine demente Person in die dauerhafte Pflege aufgenommen wird, hängt von der funktionalen Leistung der Medizin ab, die sich daraufhin von der:dem unheilbar Kranken zurückzieht. Für Demenz gibt es derzeit keine Heilungsmöglichkeit, die Würde der Betroffenen ist Barth zufolge im weiteren Verlauf der Krankheit zunehmend beschädigt. Die Pflege basiere somit auf einer „Inklusion der Entwürdigten“ (S. 242).
Anhand des SGB XI verdeutlicht Barth, was in der Pflege als Gewalt gilt: „Praktiken, die die Würde von Pflegebedürftigen in stärkerer oder weniger starker Weise verletzen und die auf Handlungen bzw. Entscheidungen von Pflegekräften bzw. Pflegeeinrichtungen zurückzuführen sind“ (S. 273). Insbesondere der angemahnte Schutz der Würde von Menschen mit Demenz hätte wichtige Konsequenzen: Es werde dadurch einfacher, die Verletzungen von Würde, zum Beispiel durch fehlende Empathie oder Perspektivübernahmen seitens der Pflegenden, aufzuzeigen und als illegitime Gewalt gegenüber den Gepflegten zu deuten. Menschen mit Demenz würden dagegen kaum als Gewalttäter:innen bezeichnet: Um Gewaltzuschreibungen zu vermeiden, nutzen Pflegende oftmals den Begriff des herausfordernden Verhaltens. Die Möglichkeiten, in der Pflege Gewalt ausüben zu können, seien darüber hinaus ungleich verteilt, denn Menschen mit Demenz würden zum einen pathologisiert, zum anderen medikalisiert. Psychopharmaka zu verabreichen, ist Barth zufolge eine Form vermittelter legitimer Gewalt, durch die sich wiederum die oben bereits angesprochene Gewaltasymmetrie verstärkt. Denn die medikamentöse Einstellung reduziert die Chance, dass Menschen mit Demenz Verhaltensweisen aufzeigen, die die Pflegenden als Gewalt deuten könnten.
Im Gegensatz zu einer „Verfahrensordnung der Gewalt“,[3] in der prinzipiell alle moralischen Akteure Gewalt ausüben können, sei der Kreis potenzieller Täter:innen in der Pflege also auf das Pflegepersonal beschränkt, während die Gepflegten mal implizit, mal explizit als jene angesehen würden, die von illegitimer Gewalt betroffen sein können. Allerdings werde die Annahme, dass Menschen mit Demenz keine Gewalt ausüben können, in der Praxis stets aufs Neue widerlegt, nicht jedem Verhalten der Gepflegten lasse sich der Gewaltstatus einfach aberkennen. Jedoch sei es für die Pflegekräfte nahezu undenkbar, sich zu fragen, ob das Verhalten der Gepflegten Gewalt sei oder nicht. Da die Pflegebeziehung darauf basiere, den dementen Bewohner:innen kein intentionales Verhalten zuzuschreiben, könne ihr Verhalten auch nicht als Gewalt verstanden werden.
Vor dem Hintergrund seiner empirischen Befunde stellt Barth abschließend fest, dass in der Pflege zwar keine eigenständige Ordnung bestimmt, welches Handeln als Gewalt gilt. Sie tendiere jedoch zu einer „Verfahrensordnung ohne Gewalt“ (S. 412). Einzelne Akteure – die Gepflegten mit Demenz – gelten nicht als Gewaltausübende, sie sind entweder mithilfe von Medikamenten ruhiggestellt oder man erkennt ihnen – aufgrund ihrer Krankheit – Intentionalität und somit auch den Akteursstatus ab. Durch diese Verfahrensweise, so resümiert Barth, sei die Pflege „eine recht erfolgreiche Gewaltausschlussinstitution“ (S. 412).
Eine herausfordernde, aber lohnenswerte Lektüre
Dem hier besprochenen Buch hätte ein sorgfältigeres Lektorat sicherlich gutgetan. Gerade weil sich Barth an der Frage abarbeitet, wie sich die Pflege zur modernen Verfahrensordnung der Gewalt verhält, mag es zudem überraschen, dass er sich gar nicht mit dem Begriff der Moderne auseinandersetzt. Er umgeht vielmehr die Frage, wie die untersuchte Verfahrensordnung angesichts multipler Modernen,[4] einer flüchtigen Moderne,[5] einer Zweiten Moderne[6] etc. zu denken ist. Ähnlich verhält es sich mit der Pflege, die er ohne weitere Begründung und ohne Berücksichtigung ihrer Sozial- und Kulturgeschichte[7] als ein per se modernes Phänomen ausflaggt.
Dies sind jedoch Kritikpunkte, die Barths argumentative Leistung nicht schwächen, sondern eher auf ihre Verfeinerung zielen. Insgesamt handelt es sich bei der Dissertationsschrift um eine sehr anspruchsvolle und lohnende Lektüre. Der Autor diskutiert das Thema Gewalt im Allgemeinen und Gewalt in der Pflege im Besonderen auf einem theoretisch hohen Niveau. Dabei lässt er die Leser:innen detailliert an seinen Gedankengänge teilhaben, indem er einen Großteil seiner Argumente akribisch entfaltet. Seine gesellschaftstheoretischen Vorüberlegungen nehmen jedoch bisweilen zu viel Platz ein. Über weite Strecken fehlen im Buch die Bezüge zur Pflege und die Leser:innen erlangen erst spät empirische Einsichten. Der Theorieteil lässt sich allerdings nicht einfach überspringen, sondern ist – wenn auch nicht in Gänze – ein notwendiger Bestandteil, um die ethnografischen Befunde nachvollziehen zu können; und er lohnt sich allein wegen seiner äußerst sorgfältigen Ausarbeitung.
Insgesamt macht Jonas Barths Buch auf ein sehr wichtiges Thema aufmerksam und trägt dazu bei, die Diskussion über die Pflege von Menschen mit Demenz voranzutreiben. Es ist eine notwendige Lektüre für alle, die sich für die Pflege von Menschen mit Demenz interessieren, und es bietet interessante Antwortet auf die Frage, wie wir Gewalt in diesem Kontext als Ordnungszusammenhang beobachten können.
Fußnoten
- Vgl. Gesa Lindemann, Verfahrensordnungen der Gewalt, in: Zeitschrift für Rechtssoziologie 37 (2017), 1, S. 57–87; dies., Gewalt und Ordnungsbildung, in: dies., Theorie der modernen Gesellschaft, Bd. 1: Strukturnotwendige Kritik, Weilerswist 2018, S. 60–82.
- Barth stützt sich methodologisch auf die Grounded Theory Methodologie. Hinsichtlich der Frage, wie Gewalt vor dem Hintergrund der von ihm gewählten Prämissen kodiert und analysiert werden kann, bezieht er sich vor allem auf einen von ihm mitveröffentlichten Artikel. Jonas Barth et al., Wie Gewalt untersuchen? Ein Kodierschema für einen reflexiven Gewaltbegriff, in: Forum Qualitative Sozialforschung 22 (2021), 1, Art. 9.
- Vgl. Lindemann, Verfahrensordnungen der Gewalt.
- Shmuel N.Eisenstadt, Die Vielfalt der Moderne, übers. und bearb. von Brigitte Schluchter, Weilerswist 2000.
- Zygmunt Bauman, Flüchtige Moderne, übers. von Reinhard Kreissl, Frankfurt am Main 2003.
- Ulrich Beck, Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, Frankfurt am Main 1986.
- Siehe hierzu bspw. Eduard Seidler, Geschichte der Pflege des kranken Menschen [1970], Stuttgart u.a. 1980; Irene Messner, Geschichte der Pflege, Wien 2017.
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Henriette Liebhart.
Kategorien: Gesundheit / Medizin Gewalt Körper Normen / Regeln / Konventionen
Zur PDF-Datei dieses Artikels im Social Science Open Access Repository (SSOAR) der GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gelangen Sie hier.
Empfehlungen
Bioethik als flexible Machtform
Rezension zu „Biegsame Expertise. Geschichte der Bioethik in Deutschland“ von Petra Gehring
