Wolfgang Kapfhammer | Rezension | 17.07.2024
Die Geister, die wir riefen
Rezension zu „Eine Neue Wissenschaft des verwunschenen Universums. Eine Anthropologie fast der gesamten Menschheit“ von Marshall Sahlins
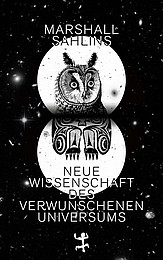
Es ist keine leichte Aufgabe, ein Buch von Marshall Sahlins zu besprechen, einer herausragenden Größe der Anthropologie, die über Jahrzehnte hinweg nicht nur theoretische Diskurse unseres Faches bestimmt, sondern sie meist auch selbst in Gang gebracht hat – von der kulturökologisch begründeten „ursprünglichen Überflussgesellschaft“ über das Bestehen auf der Bedeutung des historischen Ereignisses in Wechselwirkung mit kultureller Struktur bis hin zu einer Neubestimmung von Indigenität. Es sei vorausgeschickt, dass die folgenden Ausführungen von einem Ethnologen verfasst wurden, der seit Jahren mit Angehörigen indigener Communities am Unteren Amazonas in Brasilien zusammenarbeitet und aus einer Position tief empfundener Ehrfurcht heraus formuliert. Das jüngste Buch von Marshall Sahlins wird zugleich sein letztes sein, er selbst nennt es seinen „Schwanengesang“. Er unternimmt eine Reise um die Welt und stellt zahlreiche „immanentistische“ Gesellschaften vor, also jene, die Geister als reale Personen betrachten, sie in ihr Alltagsleben integrieren.
Sahlins betreibt in einer Art Neuauflage von Webers Entzauberungsthese eine religionsethnologische Revision des Verhältnisses der Menschen zu ihren nicht-menschlichen Gefährten. In einem einige Jahre zuvor publizierten Artikel zum selben Thema wollte Sahlins in dieser animistischen – von ihm „immanentistisch“ genannten – Kosmopolitik sogar die „urspüngliche politische Gesellschaft“ wahrgenommen haben.[1]
Dem Titel des Buches nach möchte Sahlins damit einen neuen Diskurs eröffnen, auch wenn die umfangreichen Quellen, auf die er zurückgreift, seine Arbeit bereits von Anfang an begleiten. Es sind heutzutage weitgehend vernachlässigte Klassiker der englischsprachigen Anthropologie aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die Sahlins gekonnt auffächert. Dabei arbeitet er eine in vielen, wenn nicht in den meisten Kulturen vorzufindende Koexistenz zwischen menschlichen und nicht-menschlichen Wesen heraus. Letztere fasst der Autor unter den Begriff der „Metapersonen“. Sie sind Teil der „Kosmopolis“, in der sich soziales, politisches, ökonomisches und ökologisches Leben organisiert. Die menschlichen Mitglieder dieser Gemeinschaft treten mit ihnen in unterschiedlichen Situationen, sei es im Alltagsleben oder zu Festzeiten, in Verbindung, um sich ihren Beistand, oder besser: ihre Allianz zu sichern. Diese Form des Zusammenlebens bezeichnet Sahlins dem Buchtitel nach als „verwunschene[s] Universum“ (enchanted universe). Eine geeignetere Übersetzung von „enchanted“ wäre „verzaubert“ gewesen, um den angespielten Bezug zur Entzauberungsthese Max Webers deutlicher zu machen. Sahlins versammelt einen bunten Reigen von einen ganzen Kosmos durchdringenden Wirkkräften (Mana), Ahnen-, Busch- und Speziesgeistern sowie einer oft in geradezu rauschhaft anmutender Fülle spiritualisierter Naturphänomene und lässt auf diese Art ein „wildes Denken“ vor unseren Augen entstehen. Dies will Sahlins keineswegs im nostalgischen Rückblick auf die Zeit vor Webers Entzauberung der Welt im Jahr 1917 verstanden wissen, sondern vielmehr als Verweis auf eine außerhalb der sogenannten Hochreligionen weiterwirkende „Onto-Logik“.
Die meisten anthropologischen Daten und Erkenntnisse wurden Ende des 19. Jahrhunderts und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gesammelt. Sahlins greift zu deren Einordnung auf zwei Kategorien zurück, die 2019 von dem Historiker Andrew Strathern entwickelt wurden. Dessen Unterscheidung trennt sogenannte „transzendentalistische“ von „immanentistischen“ Kulturen. Strathern wollte mit dieser Dichotomie Lebensbereiche identifizieren, in denen Menschen glaubten, „dass das Erreichen jedes erstrebenswerten Ziels von der Zustimmung und dem Eingreifen übernatürlicher Kräfte oder Metapersonen abhängt“ (Strathern, zitiert nach Sahlins, S. 11) und nannte sie „Zonen der Immanenz“. Diese Kontexte traten vor oder unabhängig von den religiösen und philosophischen Veränderungen der sogenannten „Achsenzeit“ auf – der Philosoph Karl Jaspers bezeichnete so die Epoche von 800 bis 200 vor Christus, in der weltweit Grundsteine für die Entwicklung der heutigen Weltreligionen gelegt wurden. In diesem Kosmos waren übernatürliche Kräfte und deren (meta-)persönliche Vergegenwärtigungen grundlegende Elemente und bildeten die „religiöse Basis“. Erst mit dem achsenzeitlichen Wandel wurden sie in die Sphäre des Transzendenten gerückt.
Gipfelnd in einem langen und gewagten Vergleich der „immanentistischen“ Kulturen der Central Inuit und der antiken Sumerer steckt Sahlins hiermit einen zeitlichen (vor der Achsenzeit) und einen räumlichen (außerhalb der achsenzeitlichen Entwicklung universalistischer Hochreligionen) Rahmen ab.
Es versteht sich, dass mit letzterem insbesondere Indigene Kulturen gemeint sind, die ein Forschungsfeld der klassischen Ethnologie darstellen. Sahlins kann daher für seine Ausführungen aus dem umfangreichen Thesaurus ethnologischer Dokumentation schöpfen. Diese heute oft angeschlagenen und marginalisierten oder gar ausgelöschten Kulturen in ihrem kulturellen Reichtum dokumentiert zu haben, ist meines Erachtens die große Leistung der Ethnologie und allein für sich ein gutes Argument dafür, sich diesem Buch mit Geduld und Unvoreingenommenheit zu widmen. Auch wenn er sich auf die klassischen Quellen der Ethnografie stützt, möchte Sahlins mit seinen Ausführungen nichts weniger als eine „kopernikanischen Wende“ (S. 184) der ethnologischen Perspektive vollziehen. Er rückt von der „anerkannten transzendentalistischen Weisheit“ (ebd.) ab, die – Durkheims „Spiegeltheorie“ entsprechend – von der menschlichen Gesellschaft im Zentrum auf deren religiöses Format schließt. Stattdessen portraitiert er einen Zustand, indem die Gemeinschaft in ein Geflecht aus umfassenden, stets präsenten Mächten und Kräften eingebunden ist.
Sahlins folgt in seinem Text einer Strategie, die mittlerweile für eine ganze Reihe von Argumentationen aus dem weiten Bereich der Environmental Humanities nicht untypisch ist. Um Kritik am kapitalistischen Weltsystem und seinen zerstörerischen Auswirkungen zu üben, baut der Autor seine Betrachtungen nicht auf der Analyse politisch-ökonomischer Verhältnisse auf, sondern wendet sich entgegengesetzten religiösen Formatierungen zu: indigen vs. nicht indigen (Weber[2]), animistisch vs. naturalistisch (Descola[3]), nicht-abrahamitische vs. abrahamitische (Taylor[4]) Religionen.
Derlei Dichotomien liegen unterschiedliche moralische Ansprüche zugrunde, wenn man auf das Rollenverständnis vom Menschen im Bezug zu seiner Umwelt blickt: „Animistische“ (oder eben „immanentistische“) Vorstellungen behandelten ihre belebte Umwelt als gleichgestelltes Subjekt, im Christentum hingegen sei die Unterwerfung der Natur durch den Menschen als göttlicher Auftrag festgeschrieben – so etwa durch die Leseart des Dominium-Terrae-Gebots in der Genesis. Der Historiker Lynn White formulierte bereits 1967 seine berühmte These, wonach die Ausbeutung der Natur durch den Menschen in der anthropozentrischen Weltsicht des Christentums begründet sei. Ein solcher „manichäischer“ Ansatz lässt wenig Raum für Zwischentöne. Schließlich gab es im Christentum stets mal stärker, mal schwächer ausgeprägte Unterströmungen, die die Idee einer göttlichen Präsenz – oder eben „Immanenz“ – in der Natur verfolgten. Diese Denkrichtung reicht von Spinoza zur New Science, von den Physikotheologen hin zu Arkadiern wie Gilbert White, welcher zeitlebens in der Natur seines Pfarrsprengels las wie in einer Bibel[5] – mal ganz zu schweigen von guatemaltekischen oder niederbayerischen „Volkskatholizismen“. Die radikale „Entzauberung“ wurde also vielleicht auch in den Weltreligionen gar nie vollständig vollzogen (Joas[6]) oder aber beispielsweise durch Strömungen wie dem modernen Pfingstlertum und dessen Hang zu spirituellen Erfahrungen und dem Wohlstandsevangelium abgelöst – Sloterdijk spricht in diesem Zusammenhang von einer „magischen Superimmanenz“.[7] Sahlins bezeichnete solche Phänomene in früheren Arbeiten als „Indigenisierung der Moderne“.
Wenn man sich mit der Geschichte von Konversionsbewegungen in indigenen Gesellschaften beschäftigt, wird deutlich, dass selbst intensive Bemühungen von Seiten der Kolonialmächte und Missionare selten dazu geführt haben, dass die ursprünglichen Überzeugungen und Traditionen vollständig ausgelöscht werden konnten. Und selbst wenn übernatürliche oder göttliche Kräfte von der „immanenten“ in eine „transzendente“, jenseitige Sphäre entrückt wurden, blieb ihre Abwesenheit im täglichen Leben auf eine besondere Weise spürbar – und dies kann an sich eine spirituell bedeutsame Wirkung auf Gesellschaften entfalten. Dem (post-)modernen Zeitgenossen mag die Vorstellung eines erweiterten, in das Alltagsleben hineinwirkenden Götterkosmos mitunter kurios und exotisch erscheinen. Es ist jedoch wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass darin ein tief verwurzelter Bestandteil des menschlichen Denkens und Ausdrucks begründet liegt, auf den wir heute noch bauen: „nothing is ever lost“.[8]
Ein „immanentistisches“ Verständnis von Religiosität oder Spiritualität wirkt aus der transzendentalistisch geprägten, westlichen Perspektive inspirierend und unkonventionell, daran lässt Sahlins keinen Zweifel. Die Dichotomie zwischen „transzendentalistisch“ und „immanentistisch“ ist keineswegs eine Konstruktion zu heuristischen Zwecken (was wiederum eine westliche Perspektive von außen bedingen würde), sondern als Feststellung zweier unterschiedlicher Ontologien zu verstehen. Man erlaube mir die etwas flapsige Bemerkung in Anlehnung an einen alten Witz über Atheisten: Niemand spricht so viel über Dualismen wie die Anti-Dualisten. Was daraus folgt, ist ernsterer Natur, nämlich der Ausschluss der unendlich vielen hybriden Formen, welche – ganz nach Sahlins – entweder strukturell angelegt oder historisch gewachsen sind.
Um zu einem Gesamtbild „immanentistischer“ Kulturen zu gelangen, geht Sahlins induktiv vor und arbeitet mit zahlreichen Einzelbeispielen, um über den Vergleich zu Verallgemeinerungen zu kommen. Das prägt den Stil des Buches, welches in großen Teilen aus einer Aneinanderreihung von Zitaten besteht, was wohl auch dem „unfertigen“ Charakter dieses Textes geschuldet ist.
Um das „verwunschene Universum“ der „immanentistischen“ Gesellschaften zu ergründen, lässt uns Sahlins in ein nicht weniger verwunschenes Universum eintauchen, nämlich das der klassischen britischen und amerikanischen Sozialanthropologie (Boas, Radin, Firth, Nadel, Lienhardt und viele andere). Kritisiert wird diese Forschungsrichtung vor allem aus dem Feld der Decolonial Studies, hat sie doch im Allgemeinen unter kolonialen Bedingungen stattgefunden. Die Kritik hat dazu geführt, dass die klassischen Monografien heute kaum noch gelesen werden. Unter Umständen haben die Kritiker:innen damit aber das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, denn gerade diese Arbeiten haben meist als einzige Quellen die Ästhetik (Erzählungen, Riten, Verwandtschaftsregeln, materielle Kunst und Handwerk etc.) solcher „immanentistischen“ Gesellschaften dokumentiert. Und der Ethnologie anzulasten, sie hätte selbst zum Verlust dieser Lebensstile beigetragen, hieße, die wahren kolonialen Machtverhältnisse zu verkennen.
Etwas anderes ist es, wenn diese „immanentistischen“ Gesellschaften bereits vom Kolonialismus gezeichnet sind und diese historischen Wandlungsprozesse (bewusst) ausgeblendet werden. Sahlins einen solchen „Neo-Primitivismus“ vorzuwerfen, wäre sicher kaum gerechtfertigt, hat er in seinen Hauptwerken doch nachdrücklich auf die Wechselwirkungen zwischen Struktur und Geschichte verwiesen. Im vorliegenden Buch jedoch scheint der Ethnologe vorauszusetzen, dass Leser:innen mit der historischen Perspektive vertraut sind. Den Text schreibt er folglich weitgehend im ethnografischen Präsens. Einige der Schlussfolgerungen, zu denen seine „neue Wissenschaft“ gelangt, irritieren, wie untenstehend aufgezeigt werden soll. Aber zunächst zum Weg, dem seine Argumentation folgt:
In Sahlins Beschreibung bevölkern die Menschen innerhalb einer „immanentistischen“ Kultur einen gemeinsamen Kosmos mit sogenannten „Metapersonen“ (Geister, Götter, Ahnen, Seelen etc.). In diesem Gefüge befinden sie sich in einem Zustand der „totalen Abhängigkeit […] von metapersonalen Mächten“ (S. 43) und „fehlender Kontrolle über die eigene Existenzweise“ (S. 49). Die Menschen sind demnach „endlich“ – nicht aufgrund ihrer begrenzten Lebensspanne, sondern vielmehr durch ihre eingeschränkten Handlungsmöglichkeiten. Es sind die schöpferischen Kapazitäten der Metapersonen, welche die Kultur realisieren und den „menschlichen Angelegenheiten immanent“ bleiben (S. 51). Menschen und Geistwesen teilen aufgrund der ihnen zugrundeliegenden Seinsart viele Gemeinsamkeiten: Der Mensch trägt ein „Geistwesen“ als Seele (S. 64), die Metaperson ist im Wesentlichen menschlich. Aufgrund dieser ontologischen Basis können beide miteinander kommunizieren. Dennoch, so insistiert Sahlins, bleiben die Menschen „limitierte Wesen, die mit ihrer ganzen Existenz von einer kosmischen, übergeordneten Schar metamenschlicher Mächte abhängen“ (S. 70). Das Metapersonal – Ahnen, „Gebieter der Arten und Räume“ (also „Herren“, aber auch „Mütter“ des Jagwildes, deren Wohlwollen man sich sichern muss, um ungestraft Beutetiere entnehmen zu dürfen), individuelle Schutzgeister, aber auch „antimenschliche“ Dämonen und Gespenster, ja sogar „Götter“ – bleibt, so Sahlins, in den festlichen und alltäglichen Angelegenheiten der Menschen präsent oder eben „immanent“. Nur handelt es sich in dieser „Kosmopolis“ nicht um Gemeinschaftlichkeit auf Augenhöhe; in dieser umfassenden Kosmologie herrschen hierarchische Verhältnisse trotz Gleichheit in der Gesellschaft. Für den gewöhnlichen Menschen, der nach Handlungsmacht strebt, hält Sahlins einen etwas trostlosen Schluss parat: Es gebe keine egalitären Gesellschaften (und habe sie auch nicht gegeben). Denn die „Hierarchie [ist] […] in die menschliche Art und Weise, die Welt zu denken, eingebaut [und] die genannten Gesellschaften [werden] von kosmischen Autoritäten regiert“. Menschen nähmen darin nur „eine abhängige, beflissene, ehrerbietige und schutzlose Position“ ein (S. 184). Diese Feststellung einer allumfassenden, ja geradezu ausweglosen hierarchischen Abhängigkeit der Menschen von den Metapersonen scheint mir problematisch zu sein.
Sahlins beklagt zu Recht, wie eine westlich-geprägte Lesart das Bild von „immanentistischen“ Kulturen verzerren kann. Umso unverständlicher erscheint es mir daher, warum Sahlins betontermaßen auf der Verwendung von Begriffen wie „Gott“ oder „Götter“ für Metapersonen besteht. „Götter“ bilden meines Erachtens nach ein festes Ensemble personalisierter Gestalten mit klar identifizierbaren Eigenschaften, um nicht zu sagen: Eigenheiten. Der Mensch steht einem Gott gegenüber in „vertikaler Spannung“ (Sloterdijk) und kann mit ihm nicht etwa horizontal vernetzt, ihm daher ebenbürtig sein. Dagegen tauchen zum Beispiel in Amazonien die Protagonisten der Schöpfungsmythen kaum je in der Erfüllung der alltäglichen Lebensregeln oder in den großen Ritualen auf. In den rituellen Gesängen der Sateré-Mawé im brasilianischen Amazonasgebiet, welche die Initiation der Männer begleiten, ergeht man sich in arkanen Anspielungen auf die urtümliche Schöpfungskraft. Ihre Existenz ist in den Mythen überliefert – und es gilt auch in der heutigen Zeit, sie immer wieder neu bereitzustellen: der „Tritt des inambú-Steißhuhns“ etwa, als poetische Formel in den Gesängen oder als Flechtmuster, spielt auf die Episode von der Entstehung der Erdoberfläche aus den Körpern zweier Schwestern an, auf welche in den Riten allenfalls implizit verwiesen wird. Auch stehen die Mitglieder der Gemeinschaft keineswegs in irgendeiner referenziellen, oder gar hierarchischen Beziehung zum Steißhuhn als Metaperson. In Amazonien werden mythische Protagonisten gerade nicht zu übergeordneten Wesenheiten fixiert. Im Gegenteil: Ihre Schöpfungskraft liegt in ihrer Wandlungsfähigkeit. Die Schöpfungskraft vermag es, diese Metamorphosen in Gang zu bringen. Die Rituale der Menschen haben den Zweck, die Schöpfungskraft erneut zu entfalten und mit ihr lebensspendende Prozesse in Gang zu setzen. Ziel ist die „(Re-)Produktion von Produktion“, um mit Terence Turner zu sprechen.
Schließlich, in Kapitel 4, kommt Sahlins zum Kern seiner Argumentation:
Wir brauchen so etwas wie eine kopernikanische Wende in der anthropologischen Perspektive: von der menschlichen Gesellschaft als Zentrum eines Universums, auf das sie ihre eigenen Formen projiziert – also die anerkannte transzendentalistische Weisheit –, zum immanentistischen Zustand: der ethnografischen Realität einer Abhängigkeit der Menschen von allumfassenden lebensspendenden und todbringenden, das Leben auf der Erde beherrschenden Mächten, die im Großen und Ganzen Personen wie sie selbst sind. So etwas wie der Staat, der kosmische Staat, ist die allgemeine Voraussetzung des Menschseins – auch im Naturzustand“ (S. 184).
Der Gedanke, sich von Wesenheiten abhängig zu fühlen, die der eigenen Person gleich sind, wirkt inkonsistent. Wie soll ein ontologisch gewendeter Perspektivismus hier greifen? Den Jägern in Amazonien beispielsweise stehen immer Mittel zur Verfügung, die Grenzen menschlichen Seins (personhood) zu verschieben oder zu manipulieren. Dieses Grenzmanagement dient ihnen als ein Art Kamouflage, um das Jagdwild und seine Besitzerwesen zum eigenen Vorteil hinters Licht zu führen: Jäger, die über solche Jagdzaubermittel verfügen, aber auch Pflanzerinnen auf ihre eigene Art – werden den anders-menschlichen Wesen, deren Fähigkeit darin liegt, transformatorische, produktive Prozesse in Gang zu setzen, (nahezu) ebenbürtig, jedoch nicht von ihnen abhängig. Selbst wenn die Menschen nicht gar so hilflos ausgeliefert sind („Wir glauben nicht, wir fürchten uns“, so angeblich ein Tschuktsche zu Rasmussen), so handeln sie doch gemäß der fundamentalen Einsicht in waltende lebens- und todbringende Kräfte. Sahlins rückt hier richtigerweise ein in seiner zyklischen Natur treibendes Moment kosmopolitischen Lebens in den Vordergrund, welches im starren Gerüst (post-)strukturalistischer Modelle keinen Platz findet. Angesichts von Sahlins‘ Plädoyer für eine „Neue Wissenschaft“ sei an dieser Stelle auf einen schon etwas älteren Beitrag der deutschsprachigen Ethnologie verwiesen: Der Ethnologe Adolf Ellegard Jensen beschrieb Mitte des letzten Jahrhunderts ein wiederkehrendes Motiv, das sich in vielen Mythen und Riten der tropischen Welt niedergeschlagen hatte: die Weisheit, dass das Leben unweigerlich auch den Tod voraussetzt. Jahrzehnte später hat Hans-Peter Duerr in seinem Buch Sedna oder die Liebe zum Leben Jensens allzu protestantisch-düstere Repräsentation – und auch ganz anders als Sahlins‘ Diagnose einer fatalistischen Abhängigkeit – als anarchistisch-sinnliche Feier des Lebens wieder auferstehen lassen.[9]
Ich empfehle Sahlins Buch trotz aller angesprochenen Vorbehalte. Das Buch ist wohltuend frei von theorielastigem Jargon und könnte jungen Studierenden der Ethnologie helfen, eine Vorstellung von den Lebensstilen „immanentistischer“ Kulturen zu gewinnen. Es ist natürlich nicht ganz ohne Grund, dass diese Art der Beschreibung indigenen Lebens durch die klassische social beziehungsweise cultural anthropology, angesichts der Kritik der Writing-Culture-Debatte bis hin zu den postcolonial studies in den Hintergrund gedrängt worden ist. Aber ohne sie, davon bin ich überzeugt, ist alles nichts. In Parintins, einer Stadt am Amazonas, in der ich mich oft aufhalte, können einem die Leute, die Bescheid wissen, genau jene Stelle am Flussufer zeigen, von der aus man in das Unterwasserreich der „encantados“, der „Verzauberten“, gelangt. Dort, je nach Erzählung im Bauch einer großen Schlange, in einem Unterwasserschiff oder einer glitzernden Stadt, leben die encantados in Saus und Braus, aber auch voller Sehnsucht nach dem richtigen Leben. Man kann von dort nur wieder entkommen, wenn man „erlöst“ wird: „desencantado“, „entzaubert“, aber auch: „enttäuscht“. Die Frage lautet: Möchte man ohne Zauber leben?
Fußnoten
- Marshall Sahlins, The Original Political Society, in HAU: Journal of Ethnographic Theory 7 (2017), 2, S. 91-128. Die Anspielung auf Sahlins` epochemachende „ursprüngliche Überflussgesellschaft“ ist wohl beabsichtigt.
- Andreas Weber, Indigenialität, Berlin 2018.
- Philippe Descola, Jenseits von Natur und Kultur, Berlin 2011.
- Bron Taylor, Dark Green Religions. Nature Spirituality and the Planetary Future, Berkeley (CA) 2010.
- Ruth Groh / Dieter Groh, Religiöse Wurzeln der ökologischen Krise. Naturteleologie und Geschichtsoptimismus in der frühen Neuzeit, in: dies., Weltbild und Naturaneignung. Zur Kulturgeschichte der Natur, Frankfurt am Main 1991, S. 11-91.
- Hans Joas, Die Macht des Heiligen. Eine Alternative zur Geschichte von der Entzauberung, Berlin 2017.
- Peter Sloterdijk, Chancen im Ungeheuren. Notiz zum Gestaltwandel des Religiösen in der modernen Welt, im Anschluß an einige Motive bei William James, in: William James: Die Vielfalt religiöser Erfahrung. Eine Studie über die menschliche Natur, Berlin 2014, S.11-34.
- Robert N. Bellah, Der Ursprung der Religion. Vom Paläolithikum bis zur Achsenzeit, München 2021.
- Hans Peter Duerr, Sedna oder die Liebe zum Leben, Frankfurt am Main 1984.
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Igor Biberman, Stephanie Kappacher.
Kategorien: Anthropologie / Ethnologie Kolonialismus / Postkolonialismus Kultur Religion
Zur PDF-Datei dieses Artikels im Social Science Open Access Repository (SSOAR) der GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gelangen Sie hier.
Empfehlungen
Indian Fair and European White
Rezension zu „Skin Colour Politics: Whiteness and Beauty in India“ von Nina Kullrich
Ein Planet im Krieg der Welten
Rezension zu „Ein Planet, viele Welten. Die Klima-Parallaxe“ von Dipesh Chakrabarty
Prokrustes am Amazonas
Rezension zu „Kulturübersetzung als interaktive Praxis. Die frühe deutsche Ethnologie im Amazonasgebiet (1884–1914)“ von Johanna Fernández Castro
