Jens Bisky, Karsten Malowitz | Veranstaltungsbericht | 23.09.2025
Duisburger Splitter I: Montag
Bericht von der Eröffnungsveranstaltung des 42. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Duisburg
Duisburg gehört zu den Städten, die keinen gleichgültig lassen, besonders jene nicht, die noch nie dagewesen sind. Ihnen ist die Stadt Symptom, ein Klischee, das sie aufrufen, wenn es gilt, in kleiner oder größerer Runde Anschlussfähigkeit herzustellen. In der vor wenigen Wochen erstmals ausgestrahlten ZDF-Serie Chabos stellt einer der Protagonisten seine Heimatstadt Duisburg so vor: „Oktober 1944 greifen über 2000 Flugzeuge die Stadt an und werfen über 20 Stunden über 9000 Tonnen Bomben ab. Seitdem ist die Stadt hässlich wie die Nacht. Dann Zechensterben in den Sechzigern und Duisburg ist komplett am Arsch. Wir haben den größten Binnenhafen der Welt, das Ende der neuen Seidenstraße, und trotzdem gibt es hier überall nur Pommes. Duisburg – 500.000 Menschen, der größte Zoo Deutschlands, Verschuldung, Armut, Rhein, Ruhr, Loveparade-Katastrophe, KöPi, MSV, Assis, Arbeiter, Thyssenkrupp … Die Leute hier sind hängengeblieben.“

Der Serienheld vergaß, die Mercatorhalle zu erwähnen, den Kulturtempel der Stadt, untergebracht im ersten Stock des CityPalais, einem Gebäudekomplex mit Shoppingcenter, Weinbar, Autohändler, Casino. Dort, im überraschend eleganten Saal der Duisburger Philharmoniker, wurde am Montagabend der 42. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie (DGS) eröffnet. Sein zuverlässig im Titel nahezu aller Veranstaltungen im über 100 Seiten starken Programmheft aufgerufenes Thema: Transitionen. Gespannt konnte man sein, wie dieser vage und eben deshalb vielseitig einsetzbare Leitbegriff gedeutet wird, welche Wirklichkeiten mit ihm erschlossen werden sollen. Aber auch auf DGS-Kongressen gilt: Erst die Grußworte, dann die Arbeit. So will es die Tradition.
„Der Ablauf ist weitgehend so wie jedes Mal“, sagte denn auch Helen Baykara-Krumme, die Leiterin des Organisationsteams der gastgebenden Universität Duisburg-Essen, die zusammen mit ihren zahlreichen Mitstreiter:innen das erstmals in Duisburg ausgetragene Großereignis vorbereitet hatte. Mit sichtlicher Freude und nicht ohne Stolz ließ sie die Anwesenden wissen, dass sich gut 1800 Wissenschaftler:innen und Interessierte zu dem Kongress mit seinen insgesamt mehr als 250 Veranstaltungen angemeldet haben – und warb mit sympathischer Schicksalsergebenheit zugleich um Verständnis dafür, dass dabei „sicherlich viel schief gehen“ werde. Zu den Unwägbarkeiten des Kongressbetriebs, auf die sie damit anspielte, gehörte unter anderem die kurzfristige Absage der Bundesministerin für Arbeit und Soziales, Bärbel Bas, die eigentlich zur Eröffnung hatte sprechen sollen. Sitzungen des Bundestages kamen dazwischen, es sollen ja unter anderem drei neue Verfassungsrichter:innen gewählt werden. Das freundlich nichtssagende, mit den üblichen Versatzstücken der politischen Sonntagsrhetorik aufwartende Grußwort der SPD-Politikerin – „Duisburg steht für Transition“, „Wandel eröffnet auch neue Möglichkeiten“ – verlas gekonnt und mit sonorer Stimme der Soziologe Frank Kleemann. Sein Kommen zugesagt hatte auch der Duisburger Oberbürgermeister Sören Link, der es sich nicht nehmen lassen wollte, die Kongressteilnehmer:innen persönlich zu begrüßen. Doch auch ihm kam die wechselhafte Wirklichkeit dazwischen, er steht im Stichwahlkampf gegen Herrn Groß von der AfD. Stattdessen sprach seine Stellvertreterin und Parteikollegin, Bürgermeisterin Edeltraut Klabuhn. Sie erinnerte an den berühmten Geografen und Kartografen Gerhard Mercator (1512–1594), den Namenspatron der Duisburger Universität, dessen unermüdliches Bestreben, eine im permanenten Wandel befindliche Welt so genau wie möglich zu beobachten und abzubilden, sie den versammelten Soziolog:innen als Rollenmodell empfahl: „Seien Sie also nicht schicksalsergeben. Seien Sie schlau.“ Ihr folgten – informierend, begrüßend, dankend – die Soziologin Karen Shire, Prorektorin für Universitätskultur, Diversität und Internationales, sowie Petra Stein, die Dekanin der Fakultät für Gesellschaftswissenschaften der Universität Duisburg-Essen. Sie nutzten die ihnen zur Verfügung stehende Redezeit unter anderem dafür, den auswärtigen Gästen Informationen über die heimische Universität zu präsentieren.
Einen anderen Ton setzte sodann Monika Wohlrab-Sahr, die im März dieses Jahres zur Vorsitzenden der DGS gewählt worden war. Am Beginn ihrer wohltuend klaren Ausführungen stand Professionspolitisches: Die DGS zähle derzeit etwa 3700 Mitglieder, knapp die Hälfte davon seien Frauen; 50 Prozent gehörten dem wissenschaftlichen Mittelbau an, 11 Prozent promovierten derzeit, 19 Prozent seien Professor:innen, 11 Prozent Emeritierte, 4,5 Prozent Student:innen. Die Deutsche Gesellschaft für Soziologie sei also eine Organisation des Mittelbaus. Bei der 2017 gegründeten Akademie für Soziologie sehe es nicht anders aus, auch wenn dort anfangs Professor:innen in der Mehrheit gewesen seien; inzwischen stellten sie nur noch 36 Prozent der Mitglieder der Akademie. Wohlrab-Sahr nutzte die Gelegenheit und forderte die versammelten Kolleg:innen dazu auf, das Unbehagen der quantitativ arbeitenden Kolleg:innen, die sich in den DGS-Gremien nicht ausreichend repräsentiert sähen, ernst zu nehmen und bei zukünftigen Vorstandswahlen zu bedenken. Die DGS müsse die wissenschaftliche Heimat des Mittelbaus bleiben, zugleich offen und attraktiv für alle sein.
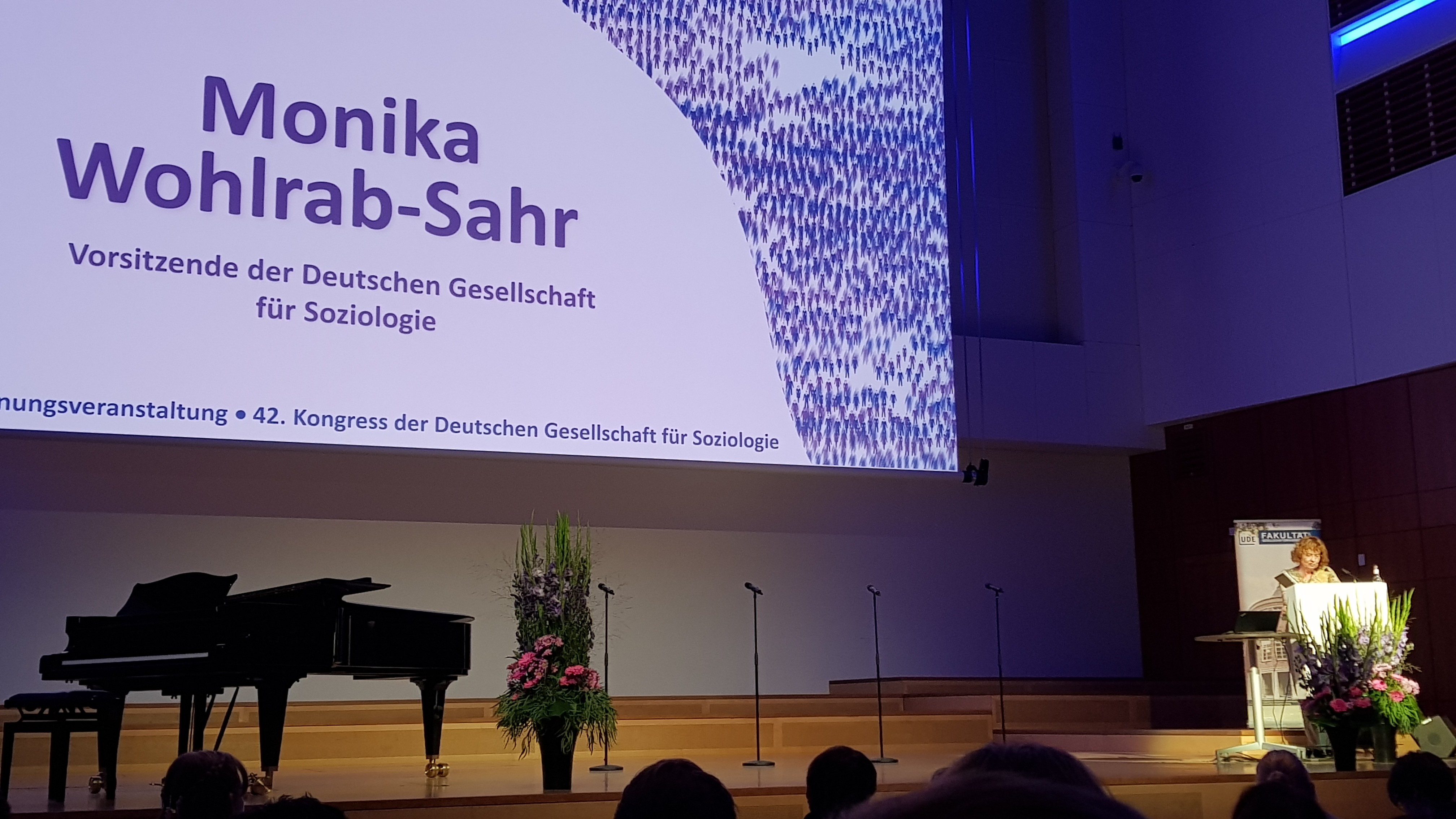
Doch Wohlrab-Sahr hatte nicht nur etwas zur Situation des Fachs, sondern auch zur Sache zu sagen. Der Kongress-Titel rufe auf, was uns als Zeitgenoss:innen wie als Soziolog:innen umtreibe. Transitionen geschähen schleichend oder abrupt, kontingent oder gerichtet. Gegenwärtig ließen sich so viele registrieren, dass der Eindruck entstehe, wir befänden uns mitten in einem großen Umbruch. Die nicht mehr ganz taufrische Marx-Diagnose, alles Stehende und Ständische verdampfe, scheine wieder zu passen, da die Eckpfeiler von Stabilität und Ordnung kollabierten. Die Stichworte sind bekannt: Klimawandel, energiepolitische Kehrtwenden, neue Kommunikationstechnologien, der Angriffskrieg gegen die Ukraine, die weltweite Marginalisierung und Bedrohung des liberalen Skripts. Die rechtsextreme AfD, mittlerweile die größte Oppositionsfraktion im Deutschen Bundestag, stehe in der Nähe einer Regierungsbeteiligung; in den USA sei ein autoritäres Regime entstanden, das abweichende Meinungen bekämpfe, Kritiker:innen kriminalisiere, die Freiheit der Wissenschaft ignoriere, sich in deren interne Angelegenheiten mische und Angehörige von Minderheiten bedrohe, in deren Leben es unkontrolliert eingreife. Die Herrschaft per Dekret habe sich als eine neue Regierungstechnik etabliert
Womit wäre hierzulande zu rechnen? Worauf muss man sich einstellen? An einer Hochschule in Ostdeutschland gebe es inzwischen eine Arbeitsgruppe „Resilienz“, an einer anderen versuche man aus Sorge vor einem Wahlsieg der AfD bei den nächsten Landtagswahlen die vorzeitige Freigabe von Professuren zu erwirken. Die Umfragen für die kommenden Wahlen deuten darauf hin, dass diese Sorge nicht aus der Luft gegriffen ist. Für den nächsten DGS-Kongress in Mainz schlug Wohlrab-Sahr daher die Bildung einer Ad-hoc-Gruppe zum Thema „Resilienz“ vor.
Im Anschluss sprach sie über das Thema, das viele der Anwesenden seit Monaten umtreibt und in jüngster Zeit schließlich auch die DGS als Institution beschäftigt: den militärischen Konflikt zwischen Israel und der Hamas und die Frage der Notwendigkeit einer eigenen Positionierung. Wohlrab-Sahr erinnerte sowohl an den Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 als auch an den darauf antwortenden Krieg Israels gegen Gaza, der inzwischen zum Vernichtungskrieg geworden sei. Und sie verwies auch noch einmal darauf, welche Auswirkungen die öffentlichen Auseinandersetzungen über den Krieg auf die Situation an den deutschen Hochschulen hatten, sie sprach von den Angriffen gegen jüdische Studierende, von den versuchten Eingriffen in die Wissenschaftsfreiheit seitens der Politik sowie den damit verbundenen Veränderungen im moralischen Haushalt der Bundesrepublik. Für die DGS waren der mörderische Konflikt, dessen Ende nicht abzusehen ist, ebenso wie die Reaktionen darauf jüngst neuerlich akut geworden, als die International Sociological Association (ISA) Ende Juni die Mitgliedschaft der Israelischen Soziologischen Gesellschaft (ISS) aussetzte. Diese habe, so der Vorwurf, keine klare Position bezogen, sich nicht entschieden genug vom Vorgehen der eigenen Regierung distanziert und die dramatische Lage in Gaza nicht eindeutig verurteilt. Dieser Entscheidung der ISA hat die Deutsche Gesellschaft für Soziologie in einer eigens verfassten Stellungnahme deutlich widersprochen: Eine Suspendierung schwäche „auch Orte der Kritik und der Wissenschaftsfreiheit in Israel massiv“; sie treffe zudem einzelne Wissenschaftler:innen. In der Widerspruchserklärung heißt es dazu weiter: „Soziologische Forschung sollte gerade in Zeiten von bewaffneten Konflikten, Autoritarismus sowie wachsendem Antisemitismus und Rassismus durch Zusammenarbeit gefördert werden, anstatt diese zu unterbinden.“
Das Thema entzweit, auch Soziolog:innen; die einen würden gern der ISA Antisemitismus ankreiden, andere sehen ein moralisches Versagen der DGS. In ihrer Duisburger Eröffnungsrede versuchte Wohlrab-Sahr nicht weniger als eine Verkehrsform für diesen Konflikt zu finden, eine Möglichkeit, ihn mit Argumenten zu diskutieren und damit zu deeskalieren, statt die Produktion von Resolutionen und Gegenresolutionen zu befördern, immer weiter Ausschlüsse und Verurteilungen zu fordern.
Sie wies auf Generationenunterschiede hin; auch darauf, dass man gute Gründe haben konnte, den Krieg gegen die Hamas und Gaza anfangs anders zu bewerten als heute. Sie erinnerte an die jahrelang anhaltenden Proteste gegen die Politik Benjamin Netanjahus, an die tiefe Spaltung der israelischen Gesellschaft. Komme eine Politik des Ausschlusses israelischer Wissenschaftler:innen nicht der von Regierungsseite geforderten Autarkie-Politik, der Verwandlung Israels in ein neues Sparta, entgegen? Über Einzelheiten wird man nicht nur in den kommenden Tagen weiter streiten müssen. Doch viel wäre gewonnen, wenn in der Diskussion nicht bloß die bekannten Lagerbildungen und Verhärtungen der öffentlichen Debatte gespiegelt würden, sondern die Freiheit der Wissenschaft sich auch als Freiheit erweisen würde, vorgefertigte Positionen zu überwinden. Oft höre man, so Wohlrab-Sahr, in diesem Zusammenhang die Formulierung „ja, aber“; es wäre zu lernen, in Zukunft „ja und auch“ zu sagen und die berechtigten Gründe der verschiedenen Seiten anzuerkennen und ihnen Rechnung zu tragen, statt sie pauschal zu delegitimieren. Mit ihrer Rede und ihrem Appell hatte die DGS-Vorsitzende offensichtlich einen Nerv getroffen. Für die ebenso deutlichen, wie um wechselseitiges Verständnis und anhaltende Diskussionsbereitschaft werbenden Worte gab es jedenfalls starken, langanhaltenden Applaus.
Wie üblich wurden im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung auch drei Preise verliehen, kleine Rituale, aber von großer Bedeutung nicht nur für die Preisträger:innen, sondern für das Fach als Ganzes. Den Thomas A. Herz-Preis für qualitative Sozialforschung erhielt Antje Daniel für ihre Habilitation: Towards a Sociology of Lived Utopia. How the Future Becomes Present in Imaginaries and Aspirations of Lived Utopias in South Africa. Dreimal wurde der Preis der Fritz Thyssen Stiftung für sozialwissenschaftliche Aufsätze vergeben: an Alina Zumbrunn für ihren Aufsatz „Confidence across Cleavage: The Swiss Rural–Urban Divide, Place-Based Identity and Political Trust“, an Julian Hamann für seinen Aufsatz „Meritokratie als Problem. Leistungsbezogene Bewertungen in Berufungsverfahren“ sowie an Lisa de Vries, Mirjam Fischer und David Kasprowski für „,männlich‘, ,weiblich‘, ,divers‘ – Eine kritische Auseinandersetzung mit der Erhebung von Geschlecht in der quantitativ-empirischen Sozialforschung“ (eine Zusammenfassung des letztgenannten Aufsatzes findet sich in Aufgelesen, der Soziopolis-Zeitschriftenschau im Januar 2025).
Anschließend hielt Paula-Irene Villa Braslavsky die Laudatio auf Elisabeth Beck-Gernsheim, die den ihr zuerkannten Preis für ein hervorragendes wissenschaftliches Lebenswerk aus gesundheitlichen Gründen nicht persönlich entgegennehmen konnte und sich deshalb von Angelika Poferl vertreten ließ. In ihrer Laudatio würdigte Villa Braslavsky die Arbeit von Beck-Gernsheim, die Maßstäbe gesetzt habe in der soziologischen Erforschung von Familie, Arbeit, Gender und Care. Sie sei sich „nie zu schade gewesen für empirisches Klein-Klein, und nie zu schüchtern für die große Gesellschaftsanalyse“. Sie habe gut, lakonisch und pointiert geschrieben in einer Zeit, als die von ihr untersuchten Themen vielen noch als ‚Gedöns‘ galten und sich die Zunft vor allem für den oft beschworenen ‚Mann auf der Straße‘ interessierte und nicht für die dort ebenfalls anzutreffende Frau. Beck-Gernsheim sei davon überzeugt gewesen, dass es die kleinen Unerheblichkeiten sind, die Geschichte und Gesellschaft machen. In diesem Geist habe sie die Transformationen von Familie und Intimität, aber auch von Arbeits- und Geschlechterverhältnissen analysiert und strukturelle Benachteiligungen von Frauen offengelegt. Im Stil lässig, nüchtern und bisweilen humorvoll habe sie sich in empirisch gesättigten Studien den Lebenswirklichkeiten der Menschen zugewandt – und so über fünf Jahrzehnte hinweg ein außergewöhnliches wissenschaftliches Werk geschaffen.
Zu der von Baykara-Krumme eingangs aufgerufenen Tradition gehört auch der Brauch, an den Eröffnungsabenden nicht nur Soziolog:innen zu Wort kommen zu lassen. 2022 hatte man Mirjam Wenzel, die Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt am Main, eingeladen, den Hauptvortrag des Abends zu halten. Diesmal fiel die Wahl auf die Schriftstellerin Lena Gorelik, die mit Romanen wie Meine weißen Nächte oder Wer wir sind bekannt geworden ist. 1981 im damaligen Leningrad geboren, wanderte ihre Familie 1992 nach Deutschland aus; sie waren, wie es im Behördendeutsch heißt, jüdische Kontingentflüchtlinge. Erst mit elf Jahren lernte Lena Gorelik deutsch – und dann in der Bundesrepublik auch Latein, wie sie in Duisburg erzählte. Zu dritt saßen sie im Leistungskurs, cool fand das außer ihnen niemand. „Was willst Du denn später mit Latein anfangen?“, fragten ihre Eltern. Eine Frage, auf die sie damals keine rechte Antwort hatte, wusste sie doch noch nicht, dass die Kenntnisse aus ihrem Leistungskurs ihr einmal dabei helfen würden, einen DGS-Kongress zu eröffnen. Das feminine Substantiv transitio bedeutet Übergang, Übergehen, Überqueren. Sie sei, so Gorelik, Schriftstellerin, sie denke in Wörtern, Assoziationen, Geschichten, sehe also einen Fluss vor sich, sehe römische Legionäre am Ufer, denen eine transitio, eine Überquerung bevorstehe. Damit hatte sie mit wenigen Worten nicht nur eines der wiederkehrenden Leitmotive ihres Vortrags benannt, sondern sich auch die Freiheit verschafft, die engen Grenzen eines strengen wissenschaftlichen Vortrags zu sprengen.

Davon ausgehend machte sich Gorelik daran, dem Begriff der transitio und seinen deutschen Entsprechungen nachzuspüren und der Rede vom Übergang, vom Woher, vom Wohin und vom Dazwischen neue Bedeutungen zu entlocken, immer geleitet vom Eigensinn der Wörter und Sätze und vom Zweifel an deren Eindeutigkeit. Dabei ließ sie fortlaufend eigene biografische Erfahrungen, politische Beobachtungen und aufgespießte Floskeln der politischen Sprache in ihr ebenso poetisches wie reflektiertes Gedankenspiel einfließen. Es hat wenig Sinn, diesen literarisch kunstvoll komponierten und mit großer Eindringlichkeit vorgetragenen Text zu paraphrasieren, so wie es bekanntermaßen auch nicht weit führt, den Inhalt von Gedichten wiederzugeben: „Über allen Gipfeln / Ist Ruh“. Nur einige Momente seien hervorgehoben.
Gorelik deutete die Gegenwart als eine Phase des Übergangs in eine zunehmend von rechtem Gedankengut bestimmte Zukunft und vergegenwärtigte das Bedrohungsgefühl einer migrantischen, queeren Autorin im heutigen Deutschland – nach den Morden von Halle und Hanau, nach der Ermordung Walter Lübckes und angesichts der für die AfD glänzenden Umfrageergebnisse. Wie lange noch würde sie öffentlich sprechen dürfen? War nicht auf einem Treffen von Rechtsextremen in Potsdam die massenhafte Deportation von Menschen wie ihr geplant worden? Wie konnte es dazu kommen? Wann hatte diese Transition, dieser schleichende Wandel, in dessen Verlauf eine solche Ungeheuerlichkeit möglich geworden war, eigentlich begonnen? Wann hatten sich die kleinen Risse zu einem Abgrund verbreitert? Vielleicht, als alle sagten, es werde so schlimm schon nicht kommen. Vielleicht, als auf die Sprache nicht aufgepasst wurde, als Wörter wie „Dönermorde“ auftauchten, oder – zunächst im Programm der AfD und inzwischen im öffentlichen Diskurs – Wortungetüme wie „Rückführungsoffensive“, „Identitätserhalt“, „Genderwahn“ oder „Sprachpolizei“. Oder war es, als die Gegengeschichten ausblieben, als diejenigen, deren Sprache das Deutsche ist, dem nichts entgegenzusetzen wussten, als sie schwiegen?
Oft sei sie gefragt worden, woher sie komme, immer wieder habe man sie aufgefordert, sich räumlich-geografisch zu verorten. Aber sie wolle Heimat nicht eindimensional denken. Sie fühle sich in der Sprache zu Hause, wolle lieber im Plural denken, lieber gefragt werden: Wohin wollen Sie? Und mit wem?
Gorelik entwarf das beklemmende Bild einer Form der Transition, die sich ereignet, weil zu viele sie geschehen lassen, ohne sich ihr zu widersetzen, während immer neue Gefahren hinzukommen: abfällige Äußerungen über schwule und lesbische Paare, Wahltriumphe der AfD und deren zunehmend aggressives Verhalten, die Gewöhnung an offenen Rassismus, das Wegsehen, die Verrohung der Sprache, das Schweigen der Mehrheit. Kann gescheite Sozialwissenschaft dieses Gegenwartsgefühl der Bedrohung und Ratlosigkeit aufnehmen, ohne es wegzuerklären?
In ihrem Lateinkurs, so Gorelik, habe sie viel über die Kunst des Kämpfens gelernt und über den Gebrauch der Sprache. In ihrem Vortrag führte sie beides zusammen. Sie enthüllte, mit welchen Mitteln Rechtsextreme die Sprache in eine Waffe verwandeln, die sie gegen ihre Feinde einsetzen; und sie zeigte, wie sich dem entgegentreten, wie sich mit sprachlichen Mitteln kämpfen lässt. Das rhetorische Instrument, das sie hierfür immer wieder zum Einsatz brachte, war das Futur 2. Mit ihrer Vergegenwärtigung persönlicher Erfahrungen, also genauer Empirie, und sorgfältigen literarischen Verfahren, einem Äquivalent strenger Begriffsarbeit, formulierte Gorelik Fragen, über die bis zum Ende der Woche sicherlich viel gesprochen worden sein wird.

Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Henriette Liebhart.
Kategorien: SPLITTER
Zur PDF-Datei dieses Artikels im Social Science Open Access Repository (SSOAR) der GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gelangen Sie hier.
Empfehlungen
Aaron Sahr, Felix Hempe, Hannah Schmidt-Ott
Göttinger Splitter I: Montag
Bericht von der Eröffnungsveranstaltung des 39. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Göttingen
Berliner Splitter III - Der Podcast
Stimmen vom dritten Tag der Konferenz "Emanzipation" am Sonntag den 27. Mai 2018
Berliner Splitter I - Der Podcast
Stimmen vom ersten Tag der Konferenz "Emanzipation" am Freitag den 25. Mai 2018

