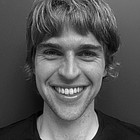Noah Serve, Mechthild Bereswill, Stephanie Kappacher, Leon Wolff | Veranstaltungsbericht | 26.09.2025
Duisburger Splitter IV: Donnerstag
Bericht vom 42. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Duisburg
Düstere Töne
Statt an die festliche Stimmung der Kongressparty am Mittwochabend anzuknüpfen, beginnt das morgendliche Plenum Demokratie in Transition? mit düsteren Tönen. Jenni Brichzin (München) verwies auf aktuelle Daten des schwedischen Varieties of Democracy Institute: Erstmals seit zwanzig Jahren übersteige die Zahl der Autokratien (es sind 91) weltweit die der Demokratien (88). Damit lebten heute rund drei Viertel der Weltbevölkerung in autoritären Regimen – 2004 sei es noch die Hälfte gewesen. Dazu komme, so Brichzin, dass in der Soziologie Demokratie bislang eine theoretische Leerstelle sei, und das obwohl gesellschaftliche Strukturen vom Demokratieabbau keineswegs unberührt blieben. Hierfür genügt ein Blick auf die gegenwärtige politische Lage in den Vereinigten Staaten. Staatliche Angriffe auf Universitäten, kritische Medien, queere Menschen, Migrant:innen und zivilgesellschaftliche Akteure verdeutlichen, wie tief antidemokratische Transitionen in den Alltag der Einzelnen hineinwirken. Auch Deutschland nimmt in diesen globalen Tendenzen keine Sonderrolle ein, so tritt beispielsweise bei der Duisburger Oberbürgermeisterstichwahl am kommenden Sonntag ein AfD-Politiker als Zweitplatzierter an. Brichzin schloss den thematischen Einstieg folgerichtig mit der Frage: Was kann die Soziologie in einer solchen Situation leisten?
Sie kann beispielsweise die demokratischen und antidemokratischen Einstellungen von Menschen messen. Denn an ihnen entscheide sich, wie Bürger:innen auf autoritäre Tendenzen reagieren, ob sie sich dagegen mobilisieren oder nicht, und wie resilient eine Demokratie bleibt. So zumindest lautete das Plädoyer von Jürgen Gerhard (Berlin) in seiner Präsentation mit dem Titel „Gegner und Befürworter des Liberalen Skripts. Ergebnisse einer Umfrage aus 26 Ländern aus verschiedenen Regionen der Welt“. Anhand eines umfangreichen Datensatzes untersuchte Gerhard, wie Bürger:innen weltweit zu den Grundprinzipien der liberalen Demokratie (dem „liberalen Skript“) stehen und wodurch sich regionale Unterschiede erklären lassen. Als „liberales Skript“ für die Demokratie definierte er vier zentrale Säulen: erstens die Kernprinzipien liberalen Denkens (Freiheit und Universalität), zweitens die politische Ordnung (Demokratie und Rechtsstaatlichkeit), drittens die Ökonomie (Meritokratie und Marktwirtschaft) sowie viertens gesellschaftliche Vorstellungen (Toleranz und Nicht-Diskriminierung). Die Ergebnisse zeigten: Im Globalen Norden befürworte etwas mehr als die Hälfte der Bevölkerung das liberale Skript, im Globalen Süden liege die Zustimmung lediglich bei rund einem Drittel. Als einzige signifikante Erklärung hierfür erweise sich die Erfahrung einer funktionierenden staatlichen Daseinsvorsorge – nur sie stärke die Zustimmung zur liberalen Demokratie messbar. Warum darüber hinaus Unterschiede zwischen Ländern und Regionen bestehen, lasse sich ausschließlich mit Faktoren auf der individuellen Ebene erklären. So bedingten beispielsweise höhere Bildung oder ein höheres Alter eine tendenzielle Unterstützung der Grundsätze liberaler Demokratien.
Soziologie kann aber auch hinterfragen und neu denken. Anna Schwenck (Siegen) forderte in ihrem Vortrag „Flexibler Autoritarismus. Die transnationale Bedeutung von Ambition und Loyalität“ dazu auf, die Wechselwirkungen zwischen ökonomischer Innovation einerseits und Autokratien wie auch liberalen Demokratien andererseits neu zu betrachten. Gestützt auf Feldforschungen in russischen Youth Leadership Summercamps kam sie zu dem Schluss: Antidemokratische Regime nutzen neoliberale Strukturen gezielt, um ihre eigene Stabilität zu sichern. Grundlage ihres Arguments ist ihr Konzept des flexiblen Autoritarismus – eine Herrschaftsstrategie, die ausgewählten Eliten ökonomische Möglichkeiten zur individuellen Selbstverwirklichung eröffnet, um im Gegenzug ihre Loyalität einzufordern. Entgegen bislang verbreiteter Annahmen seien Globalisierungsgewinner somit nicht zwangsläufig Verfechter liberaler Demokratien. Vielmehr seien es ausgerechnet zeitgenössische politische Leitbilder von Innovation – mit ihrem neoliberalen, flexiblen Verständnis –, die zur Erosion liberaler Demokratien beitragen. Die Logik schnellstmöglicher, kreativ-destruktiver und nonkonformistischer Innovationsprozesse untergrabe demokratische Verfahren, die geprägt seien von Routinen, kollektiven Entscheidungen, Interessenausgleich und Rechenschaftspflicht. Schwencks Ausweg: Die Attraktivität flexibler Innovationsverständnisse müsse „dechiffriert“ werden, was, so meine Vermutung, bedeutet, sie offen zu problematisieren. Dabei gehe es jedoch nicht darum, das menschliche Streben nach Selbstverwirklichung pauschal als neoliberale Ideologie zu diffamieren. Vielmehr solle es in einem demokratischen statt in einem autoritär-flexiblen Rahmen gefördert werden.
Terminologisch daran anknüpfend, jedoch mit Fokus auf Rassismen in Deutschland war Karin Scherschels (Eichstätt) Soziologieverständnis von einem kritisch-reflexiven Anliegen geleitet. Zu Beginn ihres Vortrags „Flexible Rassismen in (anti-)demokratischen Verhältnissen“ stellte sie die Veränderung des öffentlichen Gebrauchs der Begriffe „Rasse“ und race dar. Angesichts einer gestiegenen Sensibilität für möglicherweise rassifizierende Begrifflichkeiten – nicht zuletzt im Zuge rassistischer Gewalttaten – seien diese Begriffe in der politischen Öffentlichkeit zunehmend durch „Kultur“, „Ethnie“ oder „Migration“ ersetzt worden, obwohl man „Rasse“/race in den Sozialwissenschaften analytisch nicht naturalisierend gebraucht habe. Scherschel warnte davor, diesen begrifflichen Austausch auch in den Sozialwissenschaften zu übernehmen: Es bestehe die Gefahr, rassistische Strukturen sprachlich auszumerzen, während sie faktisch weiterhin wirksam blieben. Rassismen, so ihre These, seien flexibel – sie übertragen sich auf neue Begrifflichkeiten und andere Identitätskategorien. In demokratisch verfassten Gesellschaften äußere sich dies besonders in der Staatsbürgerschaft: Sie reproduziere institutionell eine Abgrenzung zwischen „Wir“ und „den Anderen“ und widerspreche damit dem universalistischen Rechtsversprechen liberaler Demokratien. Am Ende ihres Vortrags plädierte Scherschel dafür, sich in der Rassismusforschung künftig auf die Schnittstellen von race, Citizenship und weiteren Migrationskategorien zu konzentrieren – nur so lasse sich die Flexibilität von Rassismen in modernen Demokratien vollständig erfassen.
Doch was geschieht, wenn autoritäre Entwicklungen so weit fortgeschritten sind, dass liberal-demokratische Einstellungen zum Stigma werden? Welche Möglichkeiten haben zivilgesellschaftliche Initiativen dann noch, sich vor Ort für demokratische Prinzipien einzusetzen? Und kann die Soziologie angesichts antidemokratischer Transitionen im gewohnten Modus weiterarbeiten? Mit diesen Fragen setzten sich Alexander Leistner (Leipzig) und Thomas Hoebel (Bielefeld) in ihrem Vortrag „Against Transition. Demokratiearbeit in feindlichem Umfeld“ auseinander. Sie verstanden Soziologie als offenen Forschungsprozess: Forschende müssten ins Feld gehen und soziale Veränderungen gemeinsam für die und mit denjenigen Menschen deuten, deren Lebenswelt sie verstehen wollen. Es zieht Leistner und Hoebel in mittelgroße und Kleinstädte sowie ländliche Regionen Deutschlands – an jene Orte also, an denen Demokratiearbeit auf besonders schwierige Bedingungen stoße und die Demokratie, so die Wahrnehmung der beiden Forscher, bereits zu erodieren beginne. Dort treffen sie seit 2015 die verbliebenen Aktivist:innen, beobachten Demonstrationen, halten Podiumsvorträge, führen Diskussionen und packen bei der demokratischen Basisarbeit mit an. Sei es der Polizist in Greiz, der den „Omas gegen Rechts“ bei Bedrohung ihres Protests riet, nach Hause zu gehen, oder die Panikknöpfe unter den Tischen einer Immigrant:innenorganisation in Wurzen – durch die Schilderung solcher Erfahrungen gelang es Leistner und Hoebel, die dramatische Lage vor Ort und die wachsende Beunruhigung der lokalen zivilgesellschaftlichen Akteure eindringlich zu vermitteln.
Zwar vermochte das Panel es nicht, die theoretische Leerstelle der Demokratie in der Soziologie mit einem einheitlichen Ansatz zu schließen, doch das war auch nicht sein Anspruch. Vielmehr eröffneten die vier Vorträge die Möglichkeit, (anti-)demokratische Veränderungen multiperspektivisch zu betrachten: von vergleichenden Datensätzen über begriffliche Reflexionen bis hin zur Feldforschung auf lokaler Ebene. So bietet die Soziologie verschiedene Ansätze, um demokratische Gesellschaften in ihrer Komplexität zu erforschen. Welche politisch-aktivistische Rolle die Forschenden dabei einnehmen können und sollten, bleibt jedoch im Zuge autoritärer Transitionen dringender zu diskutieren denn je.
(Noah Serve)
Unterwegs
Als ich die Ad-hoc-Gruppe mit dem Titel Temporärer Ortswechsel als Transition? – Tourismussoziologische Perspektiven auf das Reisen als sozialem Prozess im Programm des diesjährigen DGS-Kongresses sah, fiel mir sofort die polemische Kritik ein, die Hans Magnus Enzensberger Ende der 1950er-Jahre zur wachsenden Tourismusindustrie formuliert hat (Eine Theorie des Tourismus, in: ders., Einzelheiten, S. 147–168, hier S. 167 f.). Für ihn ist touristisches Reisen Ausdruck eines Eskapismus, der auf die gesellschaftlichen Entfremdungserfahrungen von Menschen und auf ihre Sehnsüchte verweist, gesellschaftlichen Zwängen zu entkommen:
„Die Flut des Tourismus ist eine einzige Fluchtbewegung aus der Wirklichkeit, mit der unsere Gesellschaftsverfassung uns umstellt. Jede Flucht aber, wie töricht, wie ohnmächtig sie sein mag, kritisiert das, wovon sie sich abwendet. […] Das Verlangen, aus dem sich der Tourismus speist, ist das nach dem Glück der Freiheit.“
Enzensberger lässt in seinem Text keinen Zweifel daran, dass es sich um eine illusorische Freiheit handelt und analysiert die Mechanismen des Tourismus mit entsprechender Schärfe als Ausdruck kapitalistischer Verhältnisse und gesellschaftlicher Machtverhältnisse. Dabei grenzt er sich schon damals scharf von der aus seiner Sicht elitären Distinktion zwischen Reisen und Tourismus ab, die sich in populären Diskursen über das ‚echte‘ Reisen bis heute hält, und identifiziert diese Abgrenzung als Ausdruck von weltweiten Ungleichheitsdynamiken, die mit Tourismus verbunden sind. Gleichwohl Enzensbergers Zuspitzungen vielfach als zu einseitig hinterfragt wurden, sind seine grundsätzlichen Überlegungen zur gesellschaftlichen Funktion von Tourismus bis heute soziologisch relevant. Dass touristisches Reisen auch transitorische Qualitäten haben könnte, hätte er vermutlich als trügerische Illusion verneint.
Genau an diesem Punkt setzte die Perspektive der Ad-hoc-Gruppe an: Schon der Titel der Session am Donnerstagnachmittag verdeutlichte, dass hier keine Generalkritik oder gesellschaftswissenschaftliche Abrechnung mit dem Tourismus zu erwarten war. Die Initiative der beiden Organisatorinnen Uta Karstein und Kornelia Sammet (beide Leipzig) zielte vielmehr darauf, ein soziologisches Forschungsfeld in den Blick zu rücken, das – so formulierten sie es in ihrer Einführung – bislang ein „kümmerliches Dasein“ in der Soziologie friste. Alle der vier sehr unterschiedlichen Vorträge waren empirisch fundiert und vermittelten – auf Basis einer Analyse von Dokumenten, Artefakten und qualitativ erhobenen Daten – konkrete Zugänge zu „Tourismus als sozialem Prozess“.
In ihrem eigenen Beitrag mit dem Titel „Temporärer Ortswechsel als Transition? Erkenntnispotentiale und Limitationen des Transitionskonzepts für die Tourismussoziologie“ formulierten Karstein und Sammet verschiedene Dimensionen der transitorischen Aspekte von Tourismus: 1.) als räumlich-zeitlicher Übergang (von einem Ort zum anderen und von der Alltagszeit zur Freizeit), 2.) als eine individuelle Transition (mit Bezug zu affektiven Dynamiken oder normativen Orientierungen, die mithilfe von Artefakten oder Narrationen zum Ausdruck gebracht werden), 3.) als bleibender oder temporärer Bildungsprozess und 4.) als interaktive Aushandlung von Angebots- und Erwartungsstrukturen im Kontext einer organisationalen Infrastruktur (Anbieter/Reisende).
Im Fokus des ersten Beitrags von Mirjam Gräbner (Dresden) stand „Der ‚Tourist‘ als transitorische Figur“. Dass der Tourist auch heute noch im generischen Maskulinum daherkommt, ist bemerkenswert, soll an dieser Stelle aber nicht weiter verfolgt werden. Gräbner untersuchte diese transitorische Figur in ihrer Promotion, indem sie einerseits auf soziologische Zeitdiagnosen zurückgriff, wie etwa jene von Zygmunt Bauman (2007), der unter Bezugnahme auf „Flaneure, Spieler und Touristen“ in seinem gleichnamigen Buch einen Wandel und eine Krise der zwischenmenschlichen Beziehungen ausmachte. Andererseits untersuchte Gräbner die (westdeutsche) Globetrotter-Bewegung der 1970er-Jahre bis in die Gegenwart auf Basis von Dokumentenanalysen und teilnehmenden Beobachtungen. Die Abgrenzung der hippen Globetrotter vom ‚spießigen‘Massentourismus ordnete Gräbner in den Kontext des linksalternativen Milieus ein und rekonstruierte sowohl Selbstverständnis als auch Ausdifferenzierung der Szene. Die Selbstkonstruktion der Globetrotter als unabhängige Individualist:innen interpretierte die Kultursoziologin einerseits als Distinktion gegenüber auf der Suche nach Bindungen gescheiterten Tourist:innen, andererseits als Suche nach Bindungen in der Transition des Globetrottens. Gräbners Vortrag regte zu Fragen nach dem Verhältnis von Zeitdiagnosen und empirischer Rekonstruktion sowie nach der Spannung zwischen dem Ideal der Unabhängigkeit und der Suche nach Bindungen im transitorischen Raum an.
Anschließend lenkte die Kulturwissenschaftlerin Gerlinde Irmscher (Berlin) unter dem Titel „Rahmungen und Inszenierungen von Transition im Tourismus der Vielen“ die Aufmerksamkeit auf eine von ihr als Wanda Frisch pseudonymisierte Touristin. Anhand von Dokumenten aus deren Nachlass zeichnete Irmscher die regelmäßigen Reisen Frischs im Kontext ihres Lebenslaufs nach. Sie stellte ihre Einschätzung zur Diskussion, dass diese alleinstehende, als Chefsekretärin tätige Frau (1923–2019) ihre Urlaubsreisen als temporären sozialen Aufstieg zur ‚Dame von Welt‘ inszenierte – als eine Art Upgrade ihrer milieuspezifischen Position im westdeutschen Kleinbürgertum. Dabei pendelte die Perspektive des Vortrags zwischen den konkreten „Inszenierungen“ Frischs mit eigens für das Reisen geschneidertem Kostüm und Kamera und generalisierenden Einordnungen zur Geschichte und zum Wandel des „Tourismus der Vielen“, wie Irmscher die Entwicklungen des Massentourismus nannte. In der Diskussion wurde der Zusammenhang zwischen Reisen und Geschlecht ebenso thematisiert wie die Transition von der Touristin Wanda Frisch zur urbanen Flaneurin.
Unter dem Titel „Heilung oder Highlight?“ stellte Daniel Ellwanger (Leipzig) Ergebnisse seiner Dissertation vor, in der er die Verschränkungen und Grenzziehungen zwischen Pilgerreisen und Tourismus am Beispiel des französischen Wallfahrtsortes Lourdes untersuchte. Anhand verschiedener Materialien und aus unterschiedlichen Perspektiven zeichnete er das facettenreiche Bild eines dynamischen Aushandlungsprozesses zwischen den sakralen und profanen Aspekten eines Ortes, der sowohl als Heiligtum wie auch als Infrastruktur für die Versorgung und Lenkung großer Menschenmengen funktionieren müsse. Diese Überlagerungen und Durchkreuzungen zeigte Ellwanger anhand der geschickten Deutungsangebote des Tourismusbüros, anhand von Auszügen aus Interviews mit Geistlichen und Pilgernden und anhand seiner eigenen Pilgererfahrungen als Ethnograf. Dabei veranschaulichte er, wie auch die Deutungsmuster der Pilgernden zwischen religiösen Anliegen und Urlaubsintentionen oszillieren. In der anschließenden Diskussion kam die Frage auf, inwieweit Akteure vor Ort eine Einordnung Lourdes als touristischen Ort verhindern. Darüber hinaus wurde angeregt, vergleichbare Räume und Regionen zu (unter-)suchen, bei denen sich religiöse wie ökonomische Dimensionen des Tourismus auf komplexe Weise überlagern.
Michael Ernst-Heidenreich (Koblenz-Landau) rückte in seinem Beitrag, dem letzten dieser Session, eine Form des Reisens in den Fokus, die mit dem Begriff „Tourismus“ üblicherweise nicht assoziiert werde. Er nahm sich organisierte Jugendgruppenreisen vor und untersuchte „Möglichkeitsräume und Fremdheitserfahrungen in jugendtouristischer Nichtalltäglichkeit“. Ausgangspunkt seiner Überlegungen war ein kritischer Blick auf Enzensberger, dessen negativer Einordnung von Jugendgruppenfahrten Ernst-Heidenreich etwas entgegensetzen wollte. Vor diesem Hintergrund hatte er pädagogisch begleitete Klassenfahrten ethnografisch untersucht. Dabei zeichnete Ernst-Heidenreich nach, wie das Verlassen der alltäglichen Strukturen von Schule und des üblichen Schüler:innen/Lehrkräfte-Verhältnisses die Selbst- und Fremderfahrungen aller Beteiligten veränderte. Dabei ging er beispielsweise von einer Symmetrisierung in der Fremdheit über ansonsten gültige Hierarchien hinweg aus, arbeitete aber zugleich auch heraus, dass die in Bewegung geratenen wechselseitigen Typisierungen ambivalente Konstellationen hervorbringen könnten (zum Beispiel wechselseitige Wertschätzung, aber auch Veränderungen). In der Diskussion wurde angemerkt, dass die Kritik an Enzensberger nicht ganz zuträfe, habe dessen Polemik doch auf andere Dimensionen des Tourismus abgezielt. Zudem wurde ergänzend auf die Bedeutung der Adoleszenz für die untersuchten, spezifischen Interaktionsdynamiken hingewiesen. Darüber hinaus wurde hinterfragt, ob es tatsächlich plausibel sei, von einer symmetrischen Interaktion zwischen Schüler:innen und Lehrkräften in der gemeinsamen Fremdheitserfahrung auszugehen, weil Letztere das hierarchische Verhältnis nicht gänzlich aushebele.
Im Vergleich zu manch anderen Sessions auf dem Kongress mit großem Zulauf handelte es sich hier um eine Veranstaltung mit einer sehr überschaubaren Zahl an Teilnehmer:innen. Die anregenden, empirisch fundierten Beiträge sowie die konkreten Nachfragen und Gespräche im Anschluss an jeden Vortrag erlaubten eine vertiefte und konzentrierte Auseinandersetzung mit dem facettenreichen Gegenstand. Ohne das Verhältnis von Tourismus und Reisen konzeptionell zu klären, wurde doch deutlich, dass das komplexe Phänomen Tourismus, wenn es empirisch fundiert untersucht wird, die konkrete Bearbeitung soziologischer Grundfragen anregt.
(Mechthild Bereswill)

Alles nach Plan?
Sobald man über Transit spricht, denkt man automatisch auch an Räume. Doch was ist eigentlich mit der Zeitlichkeit, fragte Hannes Krämer (Duisburg-Essen) zu Beginn der von ihm und Larissa Schindler (Bayreuth) organisierten Ad-hoc-Gruppe zum Thema Transit-Zeiten. Schließlich sei die zeitliche Ebene doch der Sozialforschung inhärent, laufe stets automatisch mit. Dennoch friste sie eher ein Schattendasein, was Krämer und Schindler dazu veranlasst hatte, das Panel am Donnerstagnachmittag zu veranstalten. Der Vortrag „Transit-Zeit-Räume gestalten: Materialitäten und Subjektivierungen des Wartens und Bewegens“ von Tim Seitz und Christoph Schimkowsky musste leider entfallen.
Zunächst ließ Ajit Singh (Duisburg-Essen) die Zuhörenden nonchalant wissen, er werde das Thema der Session wohl nur streifen („Ich sage das gleich vorab, damit niemand enttäuscht ist“). Statt sich mit durch den Veranstaltungstitel aufgerufenen Fragen von Zeitlichkeit auseinanderzusetzen, präsentierte er „Planungs- und wissenssoziologische Überlegungen zur digitalen Mediatisierung der Planung“ – und das in beeindruckendem Tempo. Mit seinem Vortrag knüpfe er an sein Habilitationsprojekt an, in dem er eine Soziologie der Planung entwerfe. In seiner rasanten wie interessanten Vorstellung informierte er über die planerischen Abläufe von Bauvorhaben und insbesondere über die in Projekten von Stadtplanung & Co. zunehmend eingesetzte Bauwerksinformationsmodellierung (Building Information Modelling). Hierbei handelt es sich um 3D-Modelle, die den gesamten Projektzyklus vom Entwurf über die Planung und Ausführung bis hin zum Betrieb eines Bauwerks darstellen; sie werden daher auch „digitaler Zwilling“ genannt. Singh beendete seinen Vortrag so treffend wie sympathisch mit den Worten: „Ich entschuldige mich für den Ritt.“
In anderer Hinsicht beeindruckend war der Beitrag von Kamil Bembnista (Luxembourg), der unter dem Titel „Transiträumen ausgesetzt sein: Zur Soziomaterialität und Zeitlichkeit von Geflüchtetenunterkünften“ Einblicke in Letztere gab. Im Rahmen seiner Forschung hatte er zusammen mit Kollegen den später preisgekrönten Dokumentarfilm „13 Square Meters“ gedreht. Der Film sei das Ergebnis eines Projekts im Bereich Participatory Filmmaking, einer Forschungsmethode, bei der die Gefilmten mitwirken und so Einfluss auf den Inhalt des Films nehmen können. Durch die damit einhergehende Perspektivverschiebung gewähre die Methode Erkenntnisse über eine reine Beobachtung hinaus und mache Praktiken jenseits der sprachlichen Ebene sichtbar. „13 Square Meters“ zeigt die Bewohner:innen einer Geflüchtetenunterkunft in ihrem Alltag und illustriert so verschiedene von Bembnista angeführte Aspekte: Er verdeutliche etwa das in den Unterkünften zum Ausdruck kommende Machtverhältnis, das auch in zeitlicher Hinsicht offenbar werde (Wer wartet? Wer lässt warten?). Darüber hinaus zeige der Film auch die Erfahrung einer Entzeitlichkeit, also eines Verlusts des Zeitgefühls der Geflüchteten, weil ihr Leben auf Pause sei, sie nicht wüssten, wie und wohin es für sie weitergehe, wie lange sie noch warten müssen, wie sie die Wartezeit verbringen sollen usw. Sie befänden sich, so Bembnistas Fazit, in einem Zustand des Übergangs zwischen zwei Ordnungen.
Das folgende Thema tangierte wiederum Personen, die – im Vergleich zu Geflüchteten – doch eher ökonomisch besser gestellt sind. Larissa Schindler präsentierte ihre Überlegungen zum „Schlafen in Flugzeugen“, genauer: bei transatlantischen Nachtflügen, die sie ethnografisch anhand von Reisetagebüchern untersucht hat. An dieser spezifischen Art von Flügen ließen sich die Paradoxien der Koordination, der (technischen) Beschleunigung und ihrer komplexen Koordinationsprozesse, die sowohl Zeitdruck als auch Wartezeiten produzieren, ideal beobachten. Abgesehen von der richtigen Schlafzeit und -dauer sowie den Vorbereitungen für die Nachtruhe bei solchen Langstreckenflügen (Nackenkissen, Ohropax, Schlafmaske und Ähnliches) interessierte sich Schindler für auch für die Unterschiede zwischen subjektiver Zeit, also unserer ‚inneren Uhr‘, und standardisierter Zeit. Darüber hinaus beschäftigte sie sich mit dem Gegensatz zwischen der Annahme, bei der Reisezeit handele es sich um „tote Zeit“, und einem gewissen Leistungsmoment, der generell eine effiziente Nutzung von Zeit, eben auch der Reisezeit, fordere. Insbesondere faszinierte Schindler der Umstand, dass es zwar eine Uhrzeitangabe für den Start des Flugzeugs sowie für dessen Ankunft gebe, dazwischen jedoch keine Ortszeit existiere.
Anschließend ging es vom Flugzeug in die Eisenbahn: In seinem unterhaltsamen wie interessanten Vortrag untersuchte Hannes Krämer „Kommunikative Verzeitlichungsstrategien der Deutschen Bahn“, konkret nahm er sich praxeologische Aspekte von Durchsagen des Bordpersonals während der Fahrt vor. Obschon er als verspätungsgeplagter Vielfahrer öffentlicher Verkehrsmittel, insbesondere auf Fernstrecken, die Arbeit aus psychotherapeutischen und psychohygienischen Gründen aufgenommen hatte, wolle er bewusst kein „Bahn-Bashing“ betreiben. Auch mit anekdotischen Erzählungen halte er sich zurück, denn wenn es darum gehe, könne wohl jede:r von diversen Begebenheiten berichten und „wir sitzen morgen noch hier“. Grundlage seiner Forschung bildeten rund achtzig Stunden Audiomaterial von Zugdurchsagen im Fernverkehr sowie ethnografische Daten. Die Bahndurchsagen fasste Krämer als institutionalisierte Kommunikation, bei der Raumzeitlichkeit eine große Rolle spiele. Die informativen Ansagen zu Haltestellen seien stets an die Ankunftszeit gekoppelt. Das sei gerade bei Verspätungen wichtig. Krämer stellte in diesem Zusammenhang die These auf, dass sich die dialektische Färbung der Durchsagen mit zunehmender Verspätung verstärken würde. Er interpretierte dies als Zeichen von Empathie und Sozialisierung des Personals mit den leidtragenden Fahrgästen. Ein interessanter Aspekt sei auch die Nicht-Sanktionierbarkeit und Flüchtigkeit der Durchsagen, die zwar Mindeststandards, jedoch zunehmend auch Freiheitsgrade aufwiesen.
In der nachfolgenden Diskussion ließ sich Stefan Hirschauer (Mainz) eine soziologische Variante des Bahn-Bashing nicht nehmen. Schließlich rechtfertige die Bahn mit den Zugdurchsagen ihre eigenen Probleme. Er machte dabei drei Punkte stark: Erstens handele es sich– zumindest aus seiner Sicht – um eine ungebetene Kommunikation. Zweitens adressiere die Bahn häufig nur einen Teil der Fahrgäste, nämlich die neu zugestiegenen. Die mit Elias gesprochenen „Etablierten“ hingegen seien nicht angesprochen und würden obendrein auch noch gestört („meine Reaktion wären Ohropax“). Drittens seien die Durchsagen in technischer Hinsicht derart schlecht, dass man sie teils ohnehin kaum verstünde, so sehr man es auch versuche. Insbesondere die rege Diskussion bestärkte Krämer darin, dass eigentlich eine Ethnografie der Bahnreise dringend vonnöten sei. Dann, so sagte er mit verständlicherweise gequältem Gesichtsausdruck, müsse man aber noch mehr Zeit in der Deutschen Bahn verbringen – „und ob man das unbedingt will, weiß ich nicht…“.
(Stephanie Kappacher)
Wenn es bebt
Der programmatische Titel des interdisziplinär zusammen gesetzten Panels Zum Verhältnis von Soziologie und Kulturwissenschaften lockte auch am Donnerstagabend um 18 Uhr noch viele Interessierte in einen ungemütlichen Hörsaal, in dem offensichtlich die Klimaanlage versagte. Zu erleben war ein zweistündiges intensives Gespräch zwischen den Podiumsgästen und dem Publikum. Diesem differenzierten Dialog über Unterschiede und Gemeinsamkeiten, Konzepte und Ermöglichungsbedingungen für das konkrete Zusammenspiel soziologischer und kulturwissenschaftlicher Perspektiven zu folgen, war – trotz steigender Raumtemperatur und fortgeschrittener Zeit – ein intellektuelles Vergnügen. Dazu trugen die Soziologin und Literaturwissenschaftlerin Carolin Amlinger (Basel), der Historiker, empirische Kultur- und Filmwissenschaftler Thomas Etzemüller (Oldenburg), die Anglistin Julika Griem (Duisburg-Essen) und die Soziologin Christine Hentschel (Hamburg) bei. Die Moderation übernahm der Kommunikations- und Sozialwissenschaftler Hannes Krämer (Duisburg-Essen). Nach einer kurzen Einführung startete er das Podiumsgespräch mit der Frage: „Was ist das, Kulturwissenschaft, und wo zeigen sich soziologische Bezüge?“
Alle vier Gäste beantworteten diese und auch die folgenden Fragen und Impulse des Moderators mit Bezug zu ihren eigenen Forschungsaktivitäten, ihren konkreten Erfahrungen bei Kooperationen in Forschung und Lehre sowie mit grundlegenden Einschätzungen zu den strukturellen Bedingungen, besser gesagt: Hemmnissen, hinsichtlich eines Austauschs zwischen soziologischen und kulturwissenschaftlichen Perspektiven und Methoden. Dabei wurde schon in der Eingangsrunde nachvollziehbar, wie bedeutsam die Auseinandersetzung mit Texten und Schreiben – als Ausdrucks- und Produktionsformen von Sozialem – für alle vier Eingeladenen ist. Nicht nur aus diesem Grund hatten sie alle keine Zweifel daran, dass wechselseitige Einflussnahmen zwischen Soziologie und Kulturwissenschaften notwendig und produktiv sind, um gesellschaftliche Probleme im interdisziplinären Diskurs zu untersuchen und zu verstehen.
Julika Griem, aktuell Direktorin des Kulturwissenschaftlichen Instituts (KWI) in Essen, schilderte eingangs, wie der „Sound“ soziologischer Perspektiven sie „angefixt“ habe und welche soziologischen Felder für sie aktuell von besonderem Interesse seien. Darüber hinaus machte sie insbesondere die Praxeologie als gemeinsamen Zugang für Soziologie und Kulturwissenschaften aus. Carolin Amlinger bezeichnete sich selbst als ein „Bumerang-Kind“, das von einem Ansatz zum anderen und wieder zurück zum einen fliege. Letztlich könne sie soziologische und kulturwissenschaftliche Perspektiven nur schwer trennen. Sie untersuche literarische Artefakte als sozial strukturierte und soziale Phänomene als ästhetisch gestaltete.
Auch Thomas Etzemüller sprach über seinen Zugang zum Sozialen als Text und skizzierte die Aufgaben von Geschichtswissenschaft, Soziologie und Kulturwissenschaften als analytische Deskription und sinnverstehende Rekonstruktion der Funktionsweisen von Gesellschaft. Dabei interessierten ihn sowohl Fragen danach, wie soziale Ordnung hergestellt und erhalten wird, aber auch wie etwas erzählt wird. Auch für Christine Hentschel, die sich in ihren Forschungen unter anderem mit Fragen von Un/Sicherheit, mit Affekten und Logiken autoritären Denkens sowie mit apokalyptischem Denken in der Klimakrise befasst, sind Narrationen, auch Fiktionen, von großer Bedeutung für das Verständnis gesellschaftlicher Prozesse. Sie erläuterte ihre Sympathie für die Cultural Studies und begründete dies mit den dort bestehenden Möglichkeiten, mithilfe eines offenen, tendenziell sogar vagen Konzepts – wie beispielsweise Affekten – Erkenntnisse über den gesellschaftlichen Umgang mit Zerstörungsprozessen oder zu Imaginationen von Zukunft zu gewinnen.
Ich habe während der gesamten zwei Stunden so viel mitgeschrieben, dass ich den Verlauf der Veranstaltung über viele Seiten nacherzählen und damit meine eigene soziologische Narration konstruieren könnte. Die lebendigen, durch große Ernsthaftigkeit wie auch Humor und gelungene Zuspitzungen charakterisierten Redebeiträge auf dem Podium wurden durch ebenfalls sehr engagierte und erfahrungsgesättigte Beiträge von Kolleg:innen und Studierenden aus dem Publikum ergänzt. Dabei kamen sowohl grundlegende konzeptionelle wie auch wissenschaftspolitische Fragen zur Sprache. Im Folgenden greife ich einige aus meiner Sicht wichtigen Argumentationslinien und Gesprächsverläufe auf, die die Diskussion prägten.
Alle waren sich einig darin, dass die wechselseitige Öffnung eine sorgsame und in die Tiefe gehende Arbeit an Konzepten erfordert. Wiederkehrend rückten die Podiumsteilnehmer:innen dabei die Bedeutung, aber auch die Bedeutungsverschiebung des Narrativen oder des Narrativs – als Beispiel für ein gemeinsames und zugleich vieldeutiges Konzept – in den Blick. Kritisch ging es um das Kapern von Konzepten, ohne diese in ihrer ursprünglichen Bedeutung durchdrungen zu haben. Wobei eine solche Bemächtigung und veränderte Akzentuierung von Konzepten nicht als grundsätzlich verboten, sondern als unter Umständen legitim gesehen wurde. Es gebe einen Unterschied zwischen Kapern und respektvoll Verwenden, so Julika Griem. Als eine besondere gemeinsame Lern- und Erkenntniserfahrung beschrieb sie Momente, in denen „ein Beben“ spürbar würde – nämlich wenn Begriffe im gemeinsamen Diskurs erschüttert würden und dort, wo es „kracht“, neue Einsichten entstehen könnten.
Thomas Etzemüller reflektierte anhand seines eigenen Schreibprozesses den Unterschied zwischen historischen, aus den vorhandenen Quellen rekonstruierten Fakten und einer fiktiven Narration, die die Lücken der Quellen zu schließen sucht. Zudem betonte er, wie wichtig längere interdisziplinäre Arbeitsprozesse sind, die es erlauben, die jeweils andere Sprache zu verstehen und akzeptieren zu lernen. Dass er als Beispiel hierfür das Format des Graduiertenkollegs anführte, war wenig erstaunlich – sind es in diesem Zusammenhang doch vor allem die Promovierenden, die die Gratwanderung zwischen disziplinärer Verortung und interdisziplinärer Öffnung schaffen müssen.
Solche Lernprozesse einer doppelten, vielleicht sogar multiperspektivischen Positionierung beginnen im besten Falle nicht erst mit der Promotion; dies verdeutlichte das gesamte Gespräch. Entsprechend dachten die Diskutant:innen an verschiedenen Punkten über die Vermittlung und Aneignung von Methoden und Haltungen in der Lehre nach. So würden Amlinger zufolge in literaturwissenschaftlichen Methodenseminaren Theorien gelesen, die für die Interpretation eines literarischen Textes herangezogen würden. Die Interpretation selbst sei das Einüben von „Könnerschaft“ und daher mit der rein schematischen Vermittlung von Methodenwissen nicht zu leisten. Christine Hentschel differenzierte nicht nur zwischen Konzepten, sondern auch zwischen Haltungen im Umgang mit diesen und kontrastierte die mitunter „sperrige“ und „strenge“ Begriffs- und Methodenarbeit der Soziologie mit den offeneren, vageren Cultural Studies. Sie hielt zu „glattes“ Methodenwissen für wenig hilfreich und plädierte stattdessen dafür, kreative und gegenstandsbezogene methodische Konzepte zu „bauen“, das heißt vorhandene Methoden zu kombinieren und anzupassen. Thomas Etzemüller schloss sich an und unterstrich zugleich, dass es Mut erfordere, sich von der Erwartung einer „sortenreinen“ Anwendung von Methoden abzugrenzen und eigene Wege zu gehen. Das notwendige Wechselspiel zwischen Material und Theorie, das enge theoretische und methodische Grenzen überschreite, gerate angesichts der strengen Begutachtung von Forschungsanträgen allerdings an seine Grenzen – auch diese Einschätzung Etzemüllers wurde geteilt.
Julia Griem griff solche strukturellen Grenzen in ihren Redebeiträgen immer wieder auf und stellte grundsätzliche Überlegungen zu passenden Formaten für das wechselseitige Lernen an. Zudem setzte sie wichtige Impulse für Fragen, die viele von uns in Forschung und Lehre gegenwärtig umtreiben dürften, etwa: Sind die dominanten Erwartungen, große Forschungsverbünde zu generieren, nicht eher kontraproduktiv, was Zeit, Raum und die notwendige Tiefe gemeinsamer Lern- und Forschungsprozesse betrifft? Die wichtigen Hinweise auf eine notwendige Realitätsprüfung im Kontext von Ressourcen und Hierarchien im immer noch disziplinär eingehegten Fächergefüge der Sozial- und Geisteswissenschaften bremsten aber nicht den kreativen Diskurs des Abends. Die Podiumsteilnehmer:innen sprachen über bereits gemachte Erfahrungen und ausbaufähige Möglichkeitsräume eines gemeinsamen Arbeitens an Konzepten, immer mit dem Ziel, Gesellschaft, Soziales und zeitgenössische wie historische Entwicklungen umfassend zu untersuchen und zu verstehen. Dabei sei auch weiterhin zu reflektieren, was in der Debatte angerissen wurde: Verhältnisbestimmungen zwischen ‚großen‘ und ‚kleinen‘Untersuchungsgegenständen, zwischen Besonderem und Allgemeinem sowie zwischen methodischer Offenheit und Trennschärfe. Auch die Frage nach dem Verhältnis zum quantitativen Forschungsparadigma der Soziologie, die später aus dem Publikum gestellt wurde, gilt es, weiter zu vertiefen, um nicht in pauschalen Abgrenzungen stecken zu bleiben.
Fragen und Kommentare aus dem Publikum ergänzten viele der skizzierten Aspekte. Die Wortmeldungen verdeutlichten, dass die Sonderveranstaltung einen Raum öffnete für das gemeinsame Nachdenken über wechselseitige Anschlüsse, auf die wir bereits zurückgreifen können. Ebenso wurde spürbar, was eine Stimme aus dem Publikum auf den Punkt brachte: Hier trafen sich „interessierte Grenzgänger:innen“, um über ihre Erfahrungen, Ideen und offenen Fragen zu diskutieren. An solchen Debatten, so die Wortmeldung, würden Vertreter:innen einer Mainstream-Soziologie kein Interesse zeigen. Ob damit die Heterogenität der Soziologie und die vielfachen Erfahrungen mit Grenzgängen nicht unterschätzt werden, sei dahingestellt. Auf jeden Fall entfalten die vier Gäste, die ihre Perspektiven mit dem Publikum teilten, in ihrer Arbeit Denk- und Suchbewegungen, die in exemplarischer und vorbildlicher Weise vermitteln, wie produktiv ein aktiv gestaltetes Verhältnis zwischen Soziologie und Kulturwissenschaften ist. In Aussicht stehen dabei originelle und überraschende Einsichten zu grundlegenden gesellschaftlichen Fragen und die gemeinsame Generierung neuer Konzepte angesichts von Forschung und Theoriebildung als einem fortlaufend offenen Erkenntnisprozess.
(Mechthild Bereswill)

In der Katastrophe denken
Die ökologische Katastrophe ist nicht mehr das Kommende, sondern das Gegebene. So lässt sich die schonungslose Diagnose zusammenfassen, die am Anfang des Panels der Hamburger Organisator*innen Frank Adloff, Stefan Aykut und Christine Hentschel stand. Allerdings sei die Soziologie, so Frank Adloff in seinen einführenden Bemerkungen, für die Situation ökologischer Verwerfungen begrifflich nicht ausreichend gerüstet. Vielmehr bleibe sie, hier paraphrasierte Adloff den Soziologen Hans Joas, „gefährlichen Prozessbegriffen“ verhaftet. Konzepte wie Modernisierung und Fortschritt beruhten immer noch auf der (impliziten) Annahme von Linearität und planbarer Zukunft; Annahmen, die vor dem Hintergrund beobachtbarer Konsequenzen der ökologischen Katastrophe mehr als fragwürdig zu sein scheinen. Aber auch etablierte umweltsoziologische Konzepte wie das der Nachhaltigkeit stoßen angesichts der mehr oder weniger neuen Lage an ihre analytischen Grenzen. Mit dieser Diagnose war dann auch die Aufgabe für die vier Panelist*innen gestellt: die Nicht-Linearität und Disruptivität der ökologischen Katastrophe auf den Begriff zu bringen.
Im Anschluss durfte das zahlreich erschienene Publikum vier ausgezeichneten Vorträgen lauschen, die auf jeweils unterschiedliche Weise versuchten, in und mit den Verwerfungen der Gegenwart zu denken. Den Anfang machte Henning Laux (Hannover), der in seinem Beitrag Einblicke in seine Forschung zur Genese von kultiviertem, also aus lebendigen Zellen im Labor hergestelltem Fleisch bot. Laux griff Adloffs einführende Bemerkungen auf und verwies auf das Feld disruptiver Technologien, die eine empirische Herausforderung für den Struktur- und Kontinuitätsbias der Soziologie darstellten. Auf diese Herausforderung antwortete Laux mit dem Konzept der „Hybridisierungsspirale“. Die Figur der Spirale erweise sich als ein hilfreiches Instrument, um gerade die Unruhe und Verwirbelung sozialer Phänomene, die Gleichzeitigkeit von Kontinuität und Diskontinuität, zu denken. In heiterer Ernsthaftigkeit beschrieb Laux anschließend das soziomaterielle Kräftefeld, das eine derartige Hybridisierungsspirale entstehen lässt und immer weitertreibt. In diesem Sinne ist das kultivierte Fleisch die nächste Windung einer Gesellschaft, die enorme technische Innovationen hervorbringt, um die gleiche bleiben zu können.
Im anschließenden Beitrag von Anita Engels (Hamburg) ging es weniger um die Einführung eines neuen Konzepts als um das Verhältnis von Soziologie und Öffentlichkeit. Die Soziologie, so Engels Ausgangsbeobachtung, operiere im Hinblick auf ökologische Fragen mit drei Gewissheiten. Erstens: Eine große Transformation der Gesellschaft ist unmöglich. Zweitens: Die Soziologie ist gut beraten, zu sozialtechnologischen Erwägungen Abstand zu halten. Drittens: Die ökologische Krise ist das Ergebnis einer Makroverfasstheit der Gesellschaft, die den Handlungen einzelner entzogen ist. Dies erzeuge aber ein Problem in der Kommunikation mit der Öffentlichkeit, die ein durchaus legitimes Bedürfnis nach Handlungsmöglichkeiten habe. Gerade in Anbetracht der ökologischen Verwerfungen erhalte die Frage nach Handlungsspielräumen besondere Relevanz. Die Soziologie müsse sich darüber Gedanken machen, wie sie Anschlussfähigkeit außerhalb der Wissenschaft herstellen könne. Engels schlug dafür die Praxis des Organisierens vor. Damit sind weniger Praktiken von Organisationen gemeint als eine transformative Praxis, die den Akteuren dabei hilft, selbst Organisationsfähigkeit auszubilden. Die Soziologie sei nicht nur in der Lage, hemmende und fördernde Bedingungen für transformative Schlüsselprozesse zu identifizieren, sie könne den Akteuren auch dabei helfen, Ideen zu entwickeln, um Schritte zum gesellschaftlichen Wandel erfolgreich zu organisieren.
Wie weitreichend die Herausforderungen sind, vor die sich die Gesellschaft angesichts der ökologischen Katastrophe gestellt sieht, machte Andreas Folkers (New York/Frankfurt am Main) in einem theoretisch gesättigten und mitreißenden Vortrag deutlich. Ulrich Becks in seiner berühmten Studie zur Risikogesellschaft artikulierte Hoffnung, die Gesellschaft würde angesichts des GAUs in Tschernobyl in eine zweite, reflexive Moderne eintreten, hat sich Folkers zufolge nicht erfüllt. Stattdessen befänden wir uns inzwischen in einer dritten Moderne, in der es nicht mehr allein um die Verhinderung zukünftiger Risiken gehe (Prävention), sondern immer mehr um die Bearbeitung bereits eingetretener Schäden. Die Risikogesellschaft sei zu einer Schadensgesellschaft geworden. Erkennen lasse sich dies unter anderem anhand einer Vielzahl von Sicherheitstechnologien, wie etwa das Carbon Capturing, mit deren Hilfe die materiellen Altlasten der Moderne rückgebaut werden sollen. Die dritte Moderne lässt sich aber auch am Umgang mit Katastrophenschwellen nachvollziehen, die im Zentrum von Folkers’ Vortrag standen. Auf bedrückende Weise zeigte er, wie die Moderne auf das regelmäßige Überschreiten ökologischer Katastrophenschwellen mit einer „biopolitischen Anspruchsdeflation“ reagiert und damit menschliches Überleben insgesamt aufs Spiel setzt.
Im letzten Vortrag widmete sich Nils Richterich (Frankfurt am Main) der Inklusion nicht menschlicher Entitäten in das Rechtssystem. Aufbauend auf eigene ethnographische Forschung stellte Richterich das spanische Mar Menor ins Zentrum seiner Überlegungen, dem als erstes Gewässer überhaupt subjektive Rechte zuerkannt wurden, die nun von unterschiedlichen zivilgesellschaftlichen Akteuren geltend gemacht werden können. Klassische Inklusionskonzepte stünden hier vor einer Herausforderung, weil sie weder auf die Inklusion nicht menschlicher Aktanten zugeschnitten seien noch die kontinuierliche Wandlung von Rechtsentitäten in Rechnung stellen könnten. Genau diese historischen Wandlungsprozesse seien im Fall von Mar Menor aber zu beobachten. Entsprechend schlug Richterich unter Rückgriff auf Karen Barad das Konzept der „Intraklusion“ vor. Damit sei es möglich, die aus immer wieder neuen Relationierungen entstehende Wandlung von Entitäten zu denken.
Alle Vorträge, so bemerkten Christine Hentschel und Stefan Aykut in ihrem abschließenden Kommentar treffend, waren von einer fast greifbaren Dringlichkeit geprägt, die auch im Raum zu spüren war. Entsprechend lebendig war die anschließende Diskussion und zahlreich waren die Nachfragen, etwa ob das Konzept der Hybridisierungsspiralen die Semantik des Fortschritts reproduziere oder ob Sicherheitstechnologien der Prävention in der dritten Moderne mit Technologien der Reparatur verschmelzen. Auch stand die Frage im Raum, ob die Soziologie die Komplexität ihrer facheigenen Sprache an die Bedürfnisse der Öffentlichkeit stärker anpassen sollte, was von Anita Engels allerdings überzeugend problematisiert wurde. Schließlich wurde diskutiert, ob das Konzept der Sorge eine Antwort auf die von Folkers beschriebene Anspruchsdeflation sein könnte, da die Sorge (etwa in der Palliativmedizin) trotz ihres empirischen Scheiterns ihre Berechtigung behält. Alle diese Fragen konnten natürlich nicht geklärt werden. Aber unglücklicherweise wird es dazu ja noch ausreichend Gelegenheit geben.
(Leon Wolff)
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Stephanie Kappacher, Henriette Liebhart.
Kategorien: SPLITTER
Teil von Dossier
Duisburger Splitter
Vorheriger Artikel aus Dossier:
Duisburger Splitter III: Mittwoch
Nächster Artikel aus Dossier:
Duisburger Splitter V: Freitag
Empfehlungen
Igor Biberman, Stephanie Kappacher
Osnabrücker Splitter I: Montag
Bericht von der Eröffnungsveranstaltung der Sektionenkonferenz der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Osnabrück
Bielefelder Splitter I: Montag
Bericht von der Eröffnungsveranstaltung des 41. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Bielefeld
Jenaer Splitter I: Montag
Bericht von der Eröffnungsveranstaltung der Abschlusskonferenz der DFG-Kollegforscher*innengruppe "Postwachstumsgesellschaften" und der 2. Regionalkonferenz der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Jena