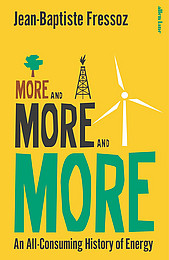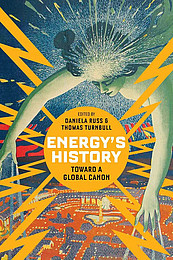Matthias Groß | Rezension | 08.07.2025
Energiewenden zwischen Mythos und Möglichkeit
Doppelrezension zu „More and More and More. An All-Consuming History of Energy“ von Jean-Baptiste Fressoz und „Energy's History. Toward a Global Canon“ von Daniela Russ and Thomas Turnbull (Hg.)
In Debatten um sozial-ökologische Transformationen, wie die sogenannte Energiewende, wird nur selten die Annahme hinterfragt, dass die Ablösung fossiler Energieträger durch alternative Quellen grundsätzlich möglich ist – schließlich hat es in der Vergangenheit vergleichbare Transformationen gegeben, wurden ähnliche Entwicklungsstufen erklommen, etwa wenn auf Muskel- und Tierkraft gegründete Gesellschaften in der industriellen Epoche durch auf Braun- und Steinkohle fußende Gesellschaften abgelöst wurden. Grundsätzlich wird die Entwicklung der Welt gern in Stadien, Epochen oder Stufen eingeteilt, und diese werden oft mit bestimmten technischen Innovationen (Elektrizität, Kernkraft) und Rohmaterialien (Öl, Kohle) in Verbindung gebracht. Warum also sollte mit etwas gutem Willen und politischem Verstand der Wechsel zu erneuerbaren Energien, das Erreichen einer neuen Stufe, nicht auch klappen?
Im Anschluss an David Edgertons Arbeiten zum Erhalt des „Alten“,[1] in denen Neuerfindungen sowie technische Innovationen seit Ende des 19. Jahrhunderts eher als Additive zum Bestehenden denn als dessen Ablösung gesehen werden, argumentiert Jean-Baptiste Fressoz in seinem neuen Buch More and More and More. An All-Consuming History of Energy, dass es „Energiewenden“ oder stufenweise Transformationsprozesse, wie sie aktuell diskutiert und politisch angestrebt werden, in der Vergangenheit nie gegeben habe. Fressoz schlussfolgert daraus, dass es solche „Wenden“, bei denen einst bedeutende Energieträger von neuen oder gar erneuerbaren Trägern abgelöst werden, auch in Zukunft nicht geben wird.
Mit der These, dass erneuerbare Energien eher als Additive zu bestehenden Energiequellen zu betrachten sind, stehen Edgerton und Fressoz nicht allein, wie bereits ein Blick auf die neuere Umweltsoziologie zeigt, wo sich in den letzten Jahren viele kritische Studien mit dem Thema befasst haben.[2] Aber durch die historische Langzeitperspektive und die kausale Verknüpfung der verschiedenen Energiequellen gelingt es Fressoz, ein dichteres Bild dieser permanenten Geschichte der Nicht-Transformationen zu zeichnen. Er beschäftigt sich dabei vor allem mit der Nutzung von Holz, Kohle und Erdöl und fragt, inwiefern diese für die Etablierung aller als erneuerbar ausgeflaggten Energieträger bis heute grundlegend wichtig geblieben sind – und teilweise sogar noch wichtiger werden. Einzig Schafwolle sei durch synthetische Materialien ersetzt worden, es könne also eine Ablösung von einem Rohmaterial konstatiert werden, wenngleich sie wiederum deutliche negative ökologische Nebenfolgen gezeitigt habe (S. 16). Solche Thesen wirken vor dem Hintergrund aktueller Bestrebungen, Lösungen für den Klimawandel zu finden, sicherlich wenig erbaulich.
Das Buch ist in zwölf Kapitel gegliedert. In den Kapiteln 1 bis 8 möchte Fressoz nicht weniger als ein völlig neues Verständnis der Entwicklungsgeschichte der Energienutzung vorstellen (S. 1). Ihm geht es darum, das hoffnungsvolle Narrativ von verschiedenen Energiewenden oder -transformationen zu widerlegen: In der Geschichte der Menschheit hätten Primärenergien immer schon dazu tendiert, sich gegenseitig zu ergänzen und zu unterstützen. Mehr noch, verschiedene neue Energieformen seien abhängig von bestehenden. Das werde allein am Beispiel der Windenergie deutlich, die auf Kohle (für die Stahlproduktion der Windräder), aber auch auf Holz angewiesen sei (S. 114–116). Was darüber hinaus oft vergessen werde: Eine moderne 6-MW-Windkraftanlage besteht aus 30 bis 50 Tonnen Kupfer und 200 bis 300 Kilogramm Seltenen Erden.[3] Fressoz‘ Gegenstand ist also die Verstrickung und symbiotische Expansion aller Energien (S. 9) und ihre Verbindung mit anderen, in der Erdkruste vorkommenden Rohstoffen. Leider diskutiert Fressoz nicht, inwieweit die Mengen an benötigten Mineralien für Wind- und Sonnenenergieanlagen tatsächlich verglichen werden können mit den fossilen Ressourcen, die zur herkömmlichen Energieproduktion bis dato benötigt werden. Er äußert sich in diesem Zusammenhang lediglich skeptisch zum Recycling von Verbundstoffen komplexer Energietechnologien (S. 218).
In den ersten beiden Kapiteln räumt Fressoz mit Innovationstheorien und deren Transformationsbegriffen auf. Von Patrick Geddes, Werner Sombart oder Lewis Mumford bis zu aktuellen „multi-level governance“-Ansätzen der Transformation – für Fressoz sind sie alle falsche Interpretationen und fehlgeleitete Ideen, die die Verwobenheit und gegenseitige Abhängigkeit von „alten“ und neuen Energieträgern außer Acht lassen. Egal ob inkrementell, „grün“ oder disruptiv, die Vorstellungen von Innovation und Transformation seien aufgrund der vorherrschenden „Mono-Energetik“ (S. 6) schlichtweg „smoke and mirrors“ (S. 28). In Kapitel 3 und 4 arbeitet Fressoz dann detailliert die enge Verknüpfung von Holz und Kohle in den letzten 300 Jahren heraus. Zwar herrsche die Vorstellung vor, dass Holz mit der Industrialisierung – die von vielen Historiker*innen als Zeit einer Energietransformation beschrieben wurde –, also seit etwa 1800, durch Kohle abgelöst worden sei. Diese Sichtweise sei aber grundlegend falsch. Im Gegenteil, so Fressoz, hätte man in Europa ohne steigenden Holzverbrauch keine Kohle abbauen können. Und ohne Kohle hätte es auch keine Stahlproduktion und schlussendlich kein Eisenbahnnetz gegeben. Aber auch das Zeitalter der fossilen Brennstoffe, wohl am eindrücklichsten symbolisiert durch den individuellen Autobesitz, sei von der Symbiose aus Kohle und Holz geprägt. Diese gehe auch mit engen Verknüpfungen zwischen Öl und Kohle sowie mit einer, wie Fressoz es nennt, „Petrolisierung des Holzes“ (S. 117) einher. Beispielhaft verweist er etwa auf die große Bedeutung, die Holz, Kohle und Erdöl für die Teerproduktion haben, die wiederum für den Straßenbau nötig sei (Kapitel 8). Das bedinge wiederum eine enge Kopplung zwischen Forstwirtschaft und kohlenstoffintensiver Landwirtschaft, die ihrerseits auf neu entwickelten Pestiziden und meist dieselbetriebenen Landmaschinen fuße. Ohne sich an dieser Stelle explizit auf Vaclav Smil[4] zu beziehen, argumentiert Fressoz hier doch sehr ähnlich, indem er an die fossilen Grundlagen moderner Gesellschaften erinnert und herausstellt, wie abhängig auch erneuerbare Energien von diesen Grundlagen sind und wahrscheinlich weiterhin bleiben werden.
In den letzten vier Kapiteln stellt sich Fressoz die Frage, wie sich der Begriff der Energietransformation und die dazugehörigen Ideen seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Politik und Öffentlichkeit auch ohne historische Vorbilder durchsetzen konnten. Für ihn ist das Aufkommen der Ideen eng mit der Wiederentdeckung der logistischen Kurve (oder S-Kurve) durch Raymond Pearl[5] in der Zwischenkriegszeit verbunden. Sie bildet den Zusammenhang zwischen Zeit und Wachstum bis hin zu Sättigungszuständen ab. Die darauf aufbauenden Arbeiten, die vornehmlich aus der Populationsökologie stammen, begründeten unter anderem die Peak-Oil-These der 1960er-Jahre: Als Alternative zu den versiegenden Ölquellen wurde hier der Übergang zu „schnellen Brütern“ durch „Atomic Malthusians“ (S. 142) vorgeschlagen. Fressoz konstatiert also, dass heutige Advokaten der Energiewende im Grunde Träumereien der Nuklearindustrie der frühen 1970er-Jahre auf den Leim gingen (Kapitel 10). Die Hoffnung war damals, mit neuen Reaktoren auf günstige, effiziente und saubere Weise Elektrizität produzieren und somit „traditionelle“ Formen der Stromerzeugung vollständig ablösen zu können. Diese Transformation hat zwar nie stattgefunden (bis heute wird weltweit doppelt so viel Energie durch Holz wie durch Kernkraft gewonnen, vgl. S. 159), aber der Idee wurde insbesondere in Deutschland mit der Hoffnung auf die Energiewende neues Leben eingehaucht. Dank der „Ideologie“ der sozial-ökologischen Transformationen, so Fressoz, konzentriere man sich lieber auf Zukunftsszenarien (am liebsten für das Jahr 2100), auf elektrische Automobilität oder auf die Möglichkeit mit Wasserstoffkraft betriebener Flugzeuge anstatt sich mit dem damit verbundenen Materialverbrauch und der Verteilung von dessen Folgen zu befassen (S. 220).
Die von Fressoz zusammengetragenen Daten zur Unterfütterung seiner These sind beeindruckend, aber er liefert keine Lösungen, noch nicht einmal vage oder abstrakte Hoffnungen. Die auf der Hand liegende Erklärung – und eben dort ansetzende Lösungen –, dass die Zunahme des Energieverbrauchs mit dem globalen Bevölkerungswachstum einhergeht, wird nicht explizit formuliert, auch wenn sie im Grunde im gesamten Buch zwischen den Zeilen klebt. Interessanterweise bemüht Fressoz auch nicht die üblichen Verdächtigen Neoliberalismus oder Kapitalismus, die erst ausgemerzt werden müssten, bevor etwas besser werden kann. Im Gegenteil: Für ihn ist das Problem der gegenseitigen Abhängigkeit aller neuer Energieformen ein grundsätzliches, das überpolitisch ist und sich in allen Formen von Gesellschaft findet. Was er aufzeigen möchte, ist eine neue Sichtweise auf die Geschichte des Energieverbrauchs der letzten 300 Jahre – und damit den größten Teil der bestehenden (historischen) Arbeiten zum Thema für obsolet erklären. Oder anders ausgedrückt: Fressoz möchte eine Transformation der Energiegeschichtsschreibung einläuten, die alles Vorangegangene hinter sich lässt.
Der von Daniela Russ und Thomas Turnbull herausgegebene Band Energy’s History. Toward a Global Canon könnte auf den ersten Blick nicht unterschiedlicher sein. Die Ausgangsposition, die die Herausgebenden in ihrer Einleitung herausstellen, ähnelt zunächst jedoch der von Fressoz: Die Energiewende werde gemeinhin als ein Mechanismus gesehen, mit dem man dem menschengemachten Klimawandel entgegenzutreten vermöge und durch den die Ziele des Pariser Klimaabkommens erreicht werden könnten, indem fossile Brennstoffe wie Kohle, Öl und Gas durch erneuerbare Energien ersetzt würden. Damit enden die Gemeinsamkeiten der beiden Bücher dann aber auch. Die Autor*innen des Bandes gehen explizit (vgl. S. 2) oder implizit davon aus, dass die Welt sich aktuell bereits in einer solchen Energietransformation befindet. Probleme werden eher im langsamen Tempo, in der politischen Verzagtheit und in der mangelnden Eingriffstiefe der initiierten Transformationsprozesse gesehen. Auch möchten Russ und Turnbull keine neue oder radikale Sicht auf die Geschichte der Energiewenden eröffnen, sondern die Diversität der Perspektiven etablierter historischer Arbeiten zusammentragen, um zu einem – wie es im Untertitel des Buches heißt – globalen Kanon der Energiegeschichte beizutragen.
Die Beiträge des Bandes sind in der Tat divers. Das Besondere ist, dass sie jeweils Primärquellen (meist kurze wissenschaftliche Texte, Editorials, aber auch graue Literatur, interne Schreiben etc.) von bedeutenden oder als bedeutend erachteten Persönlichkeiten heranziehen und deren Sichtweisen auf „Energie“ aufzeigen. Die zugrunde liegende Annahme ist, dass die Perspektiven und Deutungen auch in heutigen Diskursen (wenn auch oft implizit) zu Energietransformationen eine Rolle spielen. Die meist hochinteressanten Beiträge beschäftigen sich mit einer breiten Themenvielfalt, die von der brasilianischen Ethanolindustrie in den 1930er- bis 1980er-Jahren und der erhofften Integration dieser alternativen Energieform in bestehende Wirtschaftszusammenhänge (Kapitel 1) über unterschiedliche Bewertungen von Kohle als Energieträger der Zukunft in Japan und China (Kapitel 2 und 3) und Versuchen, das Verhältnis zwischen Ökonomie, Energetik und Ökologie neu oder integrativ zu entwerfen (Kapitel 4), bis hin zur vermeintlichen Rückständigkeit verschiedener Länder bei Fragen der Energienutzung (Kapitel 5 und 6) und damit verbundenen antikolonialen Bestrebungen (Kapitel 7 und 8) reicht. Es folgen Kapitel zu lokalen Vorstellungen von „Energiekräften“ und deren Nutzung in Französisch-Westafrika in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts (Kapitel 9), philosophische Überlegungen zur Bedeutung von Energie im Alltag, einschließlich „mentaler Energie“, in der Nachfolge von William James (Kapitel 10), ein Beitrag zu Revitalisierungsversuchen eines Energiedeterminismus von Laura Nader (Kapitel 11) und zum Schluss eine Zusammenfassung der bekannten Debatte und damit einhergehenden Wette zwischen Paul Ehrlich und Julian Simon,[6] die leider wenig über die Reproduktion von Klischees zu Neoliberalismus und Ressourcenknappheit hinausgeht (Kapitel 12).
Was macht man nun mit einem solchen Potpourri an Beiträgen und Ansätzen, die sich vor allem auf den Zeitraum zwischen dem späten 19. Jahrhundert und den 1980er-Jahren des 20. Jahrhunderts beziehen? Ich wusste es zuerst nicht so recht. Die Abbildung eines globalen Kanons konnte ich nicht erkennen, nicht einmal erahnen. Ich konnte mir aber nach etwas Überlegung durchaus vorstellen, auf Basis des Bandes einen historisch informierten Masterkurs zu „gesellschaftlichen Energieverhältnissen“ oder zu heutigen Vorstellungen von Energiewende zu entwerfen, da der Wiederabdruck von Originalliteratur im Anhang eines jeden Kapitels Studierende dazu einladen könnte, die Auslegungen selbst zu interpretieren. Konkret würde das bedeuten, die Einleitungen und Kommentare der jeweiligen Autor*innen, die zum Teil doch sehr „biased“ erscheinen (siehe etwa die Kapitel zu Nader oder Ehrlich/Simon), einer kritischen Prüfung zu unterziehen. So gesehen empfehle ich das Buch allen, die einen sozialwissenschaftlich ausgerichteten Universitätskurs zu „Energie“ planen.
Die Frage, ob es so etwas wie Energietransformationen – oder das, was in Deutschland meist als politisch gesteuerte Energiewende verstanden wird – überhaupt geben kann, wird, zumindest auf Grundlage der beiden besprochenen Bücher, eher mit einem Nein beantwortet werden müssen. Bei Fressoz war die Antwort von Anfang an klar. Russ und Turnbull wollen – wie sie es in ihrer Einleitung vorsichtig formulieren (S. 18) – mit ihrem Band diejenigen informieren, die die gegenwärtige Energietransformation und die dazugehörenden politischen Entwicklungen vorantreiben wollen. Sie glauben, dass die Kenntnis historischer Zusammenhänge und das Aufzeigen der vielfältigen Möglichkeiten helfen könnten, einen Handlungsraum für alternative Zukünfte zu eröffnen, schreiben sie in ihrem Schlusskapitel (S. 228). Aber die ausgewählten Fallstudien und Neuinterpretationen klassischer Schriften (oder auch vergessener Klassiker) rufen doch eher nach der Schlussfolgerung, dass die historische Erfahrung vor allem eines zeigt: Transformative Energielösungen, zumal nachhaltiger oder langfristiger Art, sind so bald nicht zu erwarten. In diesem Sinne sind sich die beiden Bücher, so unterschiedlich sie auch im Einzelnen sein mögen, im Ergebnis dann doch einig.
Fußnoten
- David Edgerton, The Shock of the Old: Technology and Global History Since 1900, Oxford 2007.
- Siehe allein Andrew K. Jorgenson, Analysing Fossil-Fuel Displacement, in: Nature Climate Change 2(2012), S. 399; Patrick Trent Greiner, Richard York, Julius Alexander McGee, When are Fossil Fuels Displaced? An Exploratory Inquiry into the Role of Nuclear Electricity Production in the Displacement of Fossil Fuels, in: Heliyon 8(2022), S. 1–9; Richard York, Do Alternative Energy Sources Displace Fossil Fuels?, in: Nature Climate Change 2(2012), S. 441–443.
- Diese und weitere Daten finden sich z.B. im Windkraft Journal unter https://www.windkraft-journal.de (01.07.2025).
- Vaclav Smil, Wie die Welt wirklich funktioniert. Die fossilen Grundlagen unserer Zivilisation und die Zukunft der Menschheit. München, 2023.
- Raymond Pearl, The Biology of Population Growth, New York, 1925. Mit Pearls Populationsökologie und deren Übertragung auf menschliche Gesellschaften setzte sich die Soziologie auch in den 1920er-Jahre bereits kritisch auseinander: Siehe z.B. Howard B. Woolston, Raymond Pearl, The Biology of Population Growth, American Journal of Sociology 35/3(1929), S. 403–410.
- Ehrlich verlor 1990 eine 1980 abgeschlossene Wette, in der er behauptet hatte, dass die Realkosten von Rohstoffen deutlich höher sein würden als 1980. Simon hielt erfolgreich dagegen, dass stattdessen Kosten sinken und die Überbevölkerung ausbleiben würde.
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Hannah Schmidt-Ott.
Kategorien: Geschichte Globalisierung / Weltgesellschaft Kapitalismus / Postkapitalismus Ökologie / Nachhaltigkeit Technik
Zur PDF-Datei dieses Artikels im Social Science Open Access Repository (SSOAR) der GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gelangen Sie hier.
Empfehlungen
Die diffuse Angst, zu kurz zu kommen
Sechs Fragen an Eva von Redecker
Verbote: Unterkomplexe Diskurse über Freiheit und Politikinstrumente
Sechs Fragen an Felix Ekardt