Franziska Martinsen | Rezension | 20.02.2025
Für die Verfassung, gegen das Gesetz
Rezension zu „Recht brechen. Eine Theorie des zivilen Ungehorsams“ von Samira Akbarian
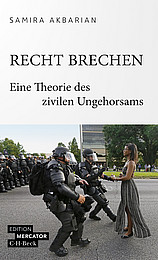
Es gibt sie nicht häufig in der Welt akademischer Veröffentlichungen – eine so wohlabgewogene, fein austarierte Darstellung, auf das Wesentliche fokussiert, in klarer Sprache geschrieben, fesselnd von der ersten bis zur letzten Zeile. Der 172 Seiten umfassende Band „Recht brechen. Eine Theorie des zivilen Ungehorsams“ von Samira Akbarian ist eines dieser seltenen Ereignisse im Bereich der rechtsphilosophischen Fachpublikationen und richtet sich so durchaus auch an ein über den akademischen Radius hinausreichendes Publikum. Daher sei der Spoileralert vorausgeschickt, dass es an den Ausführungen Akbarians kaum etwas zu beanstanden gibt. Frei von jedem belehrenden Tonfall spürt die Autorin der Frage nach, inwieweit ziviler Ungehorsam mit Demokratie und Rechtsstaat vereinbar ist. Wir erinnern uns, diese hier etwas akademisch anmutende Frage erlangte vor wenigen Jahren breite mediale Aufmerksamkeit, als Aktivist*innen Kunstgemälde mit Suppe bewarfen und sich auf Straßenkreuzungen festklebten, um auf Missstände in der Klimapolitik und die zunehmende Gefährdung des Planeten aufmerksam zu machen. Akbarian greift immer wieder auf derlei Beispiele zurück, wodurch die rechtstheoretische Abhandlung erfreulich anschaulich gerät. In Abgrenzung zu gesellschaftlichen Debatten geht es ihr nicht um eine Bewertung der Inhalte von Aktionen oder der politischen Intentionen der Aktivist*innen. Stattdessen begreift sie die Handlungen als Akte zivilen Ungehorsams und prüft, inwiefern sich ihre Grundthese einer Vereinbarkeit von Rechtsstaat und Demokratie mit zivilem Ungehorsam, ja sogar ihrer Angewiesenheit auf ihn, erhärten lässt.
Zunächst nimmt Akbarian eine möglichst breit gefasste Bestimmung von zivilem Ungehorsam vor: Darunter sei Protesthandeln zu verstehen, das von einer Richtigkeitsüberzeugung getragen sei und daher zivilen Charakter trage. Um Ungehorsam handle es sich, weil sich das Handeln gegen die Gesetze, Institutionen, Unternehmen oder staatliche Maßnahmen richte und deshalb illegal sei (S. 8). Für ihre Untersuchung geht die Autorin zudem davon aus, dass sich demokratische Rechtsstaaten als Ordnungen, in denen Recht auf Gerechtigkeit beruht, darauf verpflichten, allen einen gleichen Anteil an der Gestaltung der politischen und rechtlichen Ordnung zu ermöglichen. Akten zivilen Ungehorsams komme daher nicht nur die diagnostische Funktion zu, jene Fälle zu erkennen, in denen das rechtsstaatliche Versprechen auf Gerechtigkeit nicht eingelöst wird, sondern sie thematisierten häufig spezifische Defizite der repräsentativen Mehrheitsdemokratie, die eine der häufigsten Verfassungsvarianten demokratischer Rechtsstaaten darstellt (S. 9 f.). Wohlgemerkt: Es geht Akbarian nicht um Widerstand in autoritären Systemen, sondern um Protest in Demokratien, die Dissens grundsätzlich zulassen, zugleich aber aufgrund der Tatsachse, dass es sich um rechtsstaatliche Demokratien handelt, Legitimität für ihre Gesetze und Regeln beanspruchen. Genau diese Legitimität stellt ziviler Ungehorsam wiederum in Frage, was ihn selbst zu einem ambivalenten Untersuchungsgegenstand macht.
Im Anschluss an das erste Kapitel, in dem Akbarian den Akt des Rechtbrechens seit der Antike ausführlich und aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet, prüft sie drei Möglichkeiten, das Verhältnis zwischen zivilem Ungehorsam und demokratischem Rechtsstaat sinnvoll zu begreifen. Zunächst diskutiert sie, inwiefern ziviler Ungehorsam als Form der Verfassungsinterpretation zu verstehen sei (S. 48 ff.). Hier lautet die These, dass ziviler Ungehorsam eine bestimmte Rechtsdeutung darstellt, die von besonderer Loyalität zur Verfassung inspiriert beziehungsweise von dem Wunsch getragen ist, die Lücke zwischen einer beinahe gerechten und einer gerechten Ordnung zu schließen. Dem zivilen Ungehorsam kommt hier also eine regelrecht rechtsstaatliche Funktion zu, die Akbarian anhand des liberalen Ansatzes von John Rawls und des deliberativen Ansatzes von Jürgen Habermas herausarbeitet. Sie kritisiert jedoch, dass beide Zugänge eine Tendenz zur Vereinnahmung von zivilem Ungehorsam zur Legitimierung des Rechtsstaats aufweisen. So gibt sie zu bedenken, dass seine Integration in das rechtliche Setting – bei Rawls als Korrektiv der rechtsstaatlichen Gerechtigkeit, bei Habermas als Ausdruck eines Verfassungspatriotismus – Gefahr läuft, ihm seine kritische Sprengkraft zu nehmen (vgl. S. 80).
Im dritten Kapitel setzt sich Akbarian mit der demokratisierenden Dimension des Handelns gegen Gesetze auseinander. Sie hebt hervor, dass ziviler Ungehorsam als ein Hinterfragen der Prämissen zu verstehen ist, die den Gerechtigkeitsvorstellungen der Gesellschaft vorangehen (S. 83 ff.). Im Rekurs auf agonale und radikaldemokratische Ansätze zeigt sie, wie ziviler Ungehorsam Missstände und Konflikte aufdecken kann, die von bestehenden demokratischen Institutionen nicht adäquat aufgefangen werden. Ziviler Ungehorsam lade dazu ein, für selbstverständlich gehaltene, häufig festgefahrene Ansichten über institutionelle Strukturen und Verfahren infrage zu stellen. Im vierten Kapitel wird die ethische Funktion des Rechtbrechens aufgeschlüsselt (S. 121 ff.). Ziviler Ungehorsam erscheint in dieser Perspektive als Handeln, das auf die Sicherung der Integrität der eigenen Person – die durch bestehende Gesetze bedroht oder gar verletzt wird – zielt. Apropos Verletzbarkeit: Sie ist für die Autorin das Kriterium schlechthin für die Unterscheidung zwischen illegalen Handlungen als zivilem Ungehorsam und anderweitigem Regelbruch. Erst der Einsatz der eigenen Verletzlichkeit sorgt für die Zivilität einer gesetzeswidrigen Handlung. Sie ist somit der entscheidende Gradmesser, ob eine jeweilige Handlung als Gewalt gegen Regeln eingestuft wird. Akbarian orientiert sich hier an Judith Butlers Konzept einer Macht der Gewaltlosigkeit, nach der wir gerade in unserer Verletzbarkeit radikal gleich sind (vgl. S. 45). Andersherum formuliert setzen zivil Ungehorsame ihre eigene Vulnerabilität ein, um auf die Verletzbarkeit von Freiheit und Gleichheit im demokratischen Rechtsstaat zu verweisen. Demgegenüber werden in der deutschen Rechtsprechung, auf die sich Akbarian in ihrer Studie immer wieder mit erhellenden Praxisbeispielen bezieht, Akte des zivilen Ungehorsams recht unterschiedlich bewertet. Das Bundesverfassungsgericht etwa urteilte über zivilen Ungehorsam in Form von Sitzblockaden, dass sie dann als gewaltfrei zu werten seien, wenn ihr Zweck mittelbar sei und lediglich in einer symbolischen Wirkung bestehe. In diesem Fall seien sie im Sinne der Versammlungsfreiheit (Art 8 GG) verfassungskonform. Der Verwaltungsgerichtshof hingegen urteilte, dass zum Beispiel die Blockade unter dem Motto „Danni bleibt“ eine unmittelbare Zweckdurchsetzung, nämlich die Verhinderung der Abholzung von Wald zum Weiterbau einer Autobahn, zum Ziel gehabt habe und damit eine Verhinderungsblockade darstellte. Dieser Aktion wurde somit Gewaltsamkeit attestiert und die Legitimität abgesprochen (vgl. S. 49 ff.). Dagegen vermag die Autorin schlüssig aufzuzeigen, dass der Verwaltungsgerichtshof die originäre Funktion des zivilen Ungehorsams, auf Demokratie- beziehungsweise Gerechtigkeitsdefizite der rechtlichen Grundordnung zu verweisen und damit eine Verfassungsinterpretation vorzunehmen, verkennt: Die Akte des zivilen Ungehorsams sind ihrer Ansicht nach als öffentliche, gewaltlose, gewissensbestimmte, aber gesetzeswidrige Handlungen zu verstehen, die eine Änderung der Gesetze oder der Regierungspolitik herbeiführen sollen (S. 56). Die juristische Gewaltunterstellung sei hingegen ein Fehlurteil. Akbarian argumentiert im Anschluss an Butler, dass Gewaltlosigkeit nicht mit dem vollständigen Fehlen von Aggression verwechselt werden dürfe. Stattdessen sensibilisiert sie den Blick dafür, dass es sich bei einer scheinbar gewaltförmigen Aktion – der Behinderung des Verkehrs – vielmehr um eine Exposition der eigenen Verletzbarkeit handelt: zum einen durch das physische Festkleben auf dem Asphalt, zum anderen durch die explizite Bereitschaft, eine entsprechende Strafe in Kauf zu nehmen.
Überzeugend gelingt es der Autorin somit, das rechts- und demokratiestärkende Potenzial zivilen Ungehorsams durch den Einsatz der eigenen Vulnerabilität zu verdeutlichen und von Rechtsbrüchen abzugrenzen, die explizit auf Gewaltmittel setzen. Im Unterschied zum Festkleben des eigenen fragilen Körpers sei etwa die Traktorblockade mit schweren Fahrzeugen, die „noch mächtiger, noch größer und noch schwerer, noch raumeinnehmender“ (S. 47) seien als die Gefährte, die sie blockierten, lediglich Ungehorsam, aber aufgrund der Instrumentalisierung von Protestmitteln zu Angriffszwecken eindeutig „nicht mehr zivil“ (S. 47). Wichtig ist für Akbarian, dass ausschließlich Aktionen, die sich um die Herstellung radikaler Gleichheit aller bemühen, als gewaltlos und damit als zivil gelten können. Diese Form der Gleichheit, die in radikaldemokratischen Ansätzen zentral ist, bildet somit eine weitere unabdingbare Bedingung für die Legitimität von ungehorsamem Handeln. Freiheit und Gleichheit, das stellt die Autorin heraus, sind zwar durch die Verfassung geschützt, sie sind jedoch nicht einfach gegeben, sondern müssen immer aufs Neue durch wiederkehrende Praktiken der wechselseitigen Anerkennung der radikalen Gleichheit gesichert werden. Aus diesem Grund sind Akte zivilen Ungehorsams überall dort und immer dann nötig, wo und wann Defizite der demokratischen Grundordnung zutage treten. Akbarian widmet sich der Vollständigkeit halber auch der ethischen Perspektive auf zivilen Ungehorsam, vermag in diesem vierten Kapitel aber argumentativ nicht das hohe Niveau und die Überzeugungskraft zu halten, das die beiden Kapitel zur rechtsdeutenden und demokratisierenden Funktion des zivilen Ungehorsams auszeichnet. Davon ganz unbenommen bietet das Buch eine erhellende Unterscheidungshilfe, um emanzipative von reaktionären Formen des Rechtsbruchs abzugrenzen. Gerade angesichts sich zuspitzender Dynamiken, in denen Angriffe auf die rechtsstaatliche Grundordnung auch aus der sogenannten bürgerlichen Mitte erfolgen, kommt die Abhandlung von Samira Akbarian zur rechten Zeit. Möglicherweise wird in Zukunft ziviler Ungehorsam nicht nur im Sinne eines Korrektivs des demokratischen Rechtsstaats wichtiger werden, sondern auch als Praxistest für seine Wehrhaftigkeit gegen Angriffe von rechts.
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Hannah Schmidt-Ott.
Kategorien: Demokratie Gesellschaft Philosophie Politik Recht Zivilgesellschaft / Soziale Bewegungen
Zur PDF-Datei dieses Artikels im Social Science Open Access Repository (SSOAR) der GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gelangen Sie hier.
Empfehlungen
Habermas’ ursprüngliche Einsicht
Rezension zu „,Es musste etwas besser werden …‘. Gespräche mit Stefan Müller-Doohm und Roman Yos“ von Jürgen Habermas
Politische Theorie im Leerlauf
Rezension zu „Demokratie im Präsens. Eine Theorie der politischen Gegenwart“ von Isabell Lorey
