Uwe Schimank | Rezension | 17.07.2025
„If Differentiation Is Everything, Maybe It‘s Nothing”
Rezension zu „Differenzierung und Integration. Zur Ausdifferenzierung der Differenzierungstheorie“ von Marc Mölders, Joachim Renn und Jasmin Siri (Hg.)
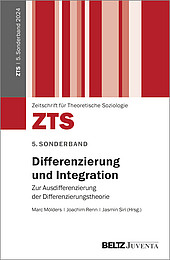
Marc Mölders, Joachim Renn und Jasmin Siri legen mit diesem Sonderband der Zeitschrift für Theoretische Soziologie ein gewichtiges Sammelwerk zur soziologischen Differenzierungstheorie vor, das neben einer Einleitung zwölf Beiträge von einschlägig ausgewiesenen Autor:innen enthält.[1] Die Beiträge sind zwei Begriffen zugeordnet: (1) „Differenzierung“ (Stefan Hirschauer, Renn, Gesa Lindemann, Joachim Fischer und Daniel Witte) und (2) „Relationierung“ (Mölders, Hannah Vermaßen, Thomas Kron, Ramy Youssef, Boris Holzer, Siri und Christine Weinbach). Ich kann hier nicht en détail auf jeden der Beiträge eingehen, sondern will einige Diskussionslinien herausstellen, die sich bei der Lektüre des Bandes zeigen.
Man fragt sich natürlich sogleich, wieso die Überschrift der zweiten Gruppe von Beiträgen im Inhaltsverzeichnis nicht entsprechend dem Titel des Sonderbandes „Integration“ heißt. Dazu sagen die Herausgeber:innen in der Einleitung, „dass sich das leitende Begriffspaar von ‚Differenzierung und Integration‘ zu ‚Differenzierung und Relationierung‘ verschoben hat“ (S. 11). Eine solche Verschiebung innerhalb der Debatte ist mir neu, doch rechne ich dieses Unwissen zunächst einmal meinem eigenen Versäumnis zu. Aber warum trägt dann der Sammelband den überholten Titel? Weil die differenzierungstheoretisch interessierten Kolleg:innen – wie ich auch – an ihn gewöhnt sind und deshalb womöglich auch der Verlag nicht von „Integration“ lassen wollte? Die Verwirrung steigert sich, wenn es an gleicher Stelle – zwei Sätze weiter – heißt: „Im ersten Teil (‚Differenzierungen‘) …“. Auch dieser Abschnitt des Buches sollte also wohl anders heißen; im Inhaltsverzeichnis steht dann allerdings, wie im Buchtitel auch, der Singular „Differenzierung“. Die Herausgeber:innen hätten, so schließe ich, den Band wohl gerne „Differenzierungen und Relationierungen“ genannt. Aber warum haben sie es nicht getan?
Um nach diesen kleinen begrifflichen Irritationen in die inhaltliche Betrachtung einzusteigen: Für die erste Gruppe von Beiträgen leuchtet der Plural „Differenzierungen“ durchaus ein. Denn drei der fünf Beiträge (Hirschauer S. 18 ff., Renn S. 47 ff. und Fischer, S. 128 ff.) legen konzeptionelle Alternativen zu einer nicht auf funktionale Differenzierung beschränkten Charakterisierung moderner Gesellschaften vor, die auf je verschiedene Plädoyers für eine „multiple Differenzierung“ der Moderne hinauslaufen. Auch die anderen beiden Texte (Lindemann, S. 80 ff., Witte, S. 146 ff.) arbeiten sich am Mainstream-Verständnis von „Differenzierung“ als primär funktionaler Differenzierung ab. Dieses ist weder in der systemtheoretischen noch in einer handlungstheoretischen Variante durch einen eigenen Beitrag vertreten – es taucht nur hier und da als Strohpuppe auf.
Renn war derjenige, der vor inzwischen fast zwanzig Jahren die „multiple Differenzierung“ in die Debatte einbrachte.[2] Gegen die Parsons-Luhmann-Linie, dass die Moderne vor allen anderen Charakteristika durch einen Primat funktionaler Differenzierung gekennzeichnet sei, führte er andere gesellschaftliche Differenzierungslinien an – insbesondere die stratifikatorische Differenzierung in besser- und schlechtergestellte Individuen, aber auch weitere, die hier in verschiedenen Beiträgen angesprochen werden: unter anderem Milieu-, Geschlechter-, Generationen-, Orientierungs- und „Humandifferenzierung“. Darüber hinaus finden sich in der Literatur – wie in der Einleitung und anderswo erwähnt – auch noch „fraktale“, „symbolische“ und „strukturelle“ Differenzierung. Und diese Liste ist keineswegs vollständig.
Die klarsten Plädoyers für eine Perspektive „multipler Differenzierung“ auf die moderne Gesellschaft – oder auf Gesellschaft überhaupt – finden sich in den Beiträgen von Hirschauer und Fischer. Bei beiden lässt sich deshalb am besten sehen, warum das vielleicht doch keine so gute, sondern eine überflüssige und fehlgeleitete Idee ist.
Hirschauer begreift Differenzierung als „Dissimilarisierung“ im Sinne von „praktizierter Abstandsvergrößerung“ (S. 18/19, Hervorh. weggelassen). Das kann man im Wortsinn so tun – aber trägt es auch zur soziologischen Klarheit bei? Die Traditionslinie des Begriffs seit Herbert Spencer stellt schnell auf die funktionale Differenzierung von Rollen und gesellschaftlichen Sphären in der Moderne scharf – und auf nichts anderes. Wozu den Begriff verunklaren? Es gibt den Kontrastbegriff der segmentären Differenzierung, wie etwa im Durkheim‘schen Denkmodell. Und das reicht aus. Schon der von Niklas Luhmann eingeführte Begriff der stratifikatorischen Differenzierung stellt eine durch Begriffsinflationierung erkaufte imperialistische Übernahme von Ungleichheits- durch Differenzierungstheorie dar – inklusive einer Einordnung der Ungleichheitstheorie als Museumsstück, weil sie ja für ein Verständnis der gesellschaftlichen Moderne weitgehend entbehrlich geworden sei. Man hat den Eindruck, dass Hirschauers Bestreben, einen solchen Begriffsimperialismus zu vermeiden, auf eine Begriffsinflationierung hinausläuft. Um nicht falsch verstanden zu werden: Alles, was er an analytischen Dimensionen zur Charakterisierung bestimmter Merkmale der modernen Gesellschaft im Einzelnen anspricht, ist gesellschaftstheoretisch interessant und wichtig, doch ließe sich das auch treffender ausflaggen als mit „Differenzierung“, wie die Soziologiegeschichte gezeigt hat.
Fischers Angebot an gesellschaftlichen Differenzierungen ist zwar weniger reichhaltig als Hirschauers Repertoire, aber immer noch viel zu weit. Er benennt kurzerhand vor allem das Spektrum wichtiger Ungleichheitsdimensionen von Klasse bis „disability“ als „Differenzierungen“, um dann „schließlich“ auch „die sachbezogenen Eigenlogiken der funktional ausdifferenzierten Teilsysteme“ (S. 134) nicht zu vergessen. Funktionale Differenzierung so unter ‚Ferner liefen‘ laufen zu lassen ist eine starke Verkennung der Realität, wie jede Reflexion der je eigenen Lebensführung ebenso wie eine Betrachtung gesellschaftlichen Geschehens schnell erkennen lässt. Vielleicht könnte eine Denkfigur wie „Haupt- und „Nebendifferenzierungen“, analog zur altmarxistischen Unterscheidung von „Haupt-“ und „Nebenwidersprüchen“, Fischers ansonsten durchaus plausible konflikttheoretische Betrachtung gesellschaftlicher Dynamiken schärfen.
Dass sich sowohl Hirschauer als auch Fischer, die beide bislang nicht als prononcierte Differenzierungstheoretiker hervorgetreten sind, an der Inflationierung des Differenzierungsvokabulars beteiligen, zeigt freilich, dass man sich mit „Differenzierung“ offenbar weiterhin schmücken kann und will – zumindest in der deutschen Soziologie; international, insbesondere in den USA, macht man sich mit dieser Begriffswahl – noch schlimmer: „functional differentiation“ – eher des längst völlig abgeschriebenen Parsonianismus verdächtig. Doch man muss aus der richtigen Erkenntnis, dass der Verweis auf funktionale Differenzierung nicht genügt, um alles Wichtige über die Gesellschaften der westlichen Moderne zu sagen, nicht den Schluss ziehen, alles, was man für wichtig hält, „Differenzierung“ zu nennen. Denn Bedeutungsinflation läuft, wie beim Geld, letzten Endes auf die Wertlosigkeit des Begriffs hinaus.
Differenzierungstheoretisch deutlich vielversprechender ist es, immanente Schwächen und Lücken – und davon gibt es viele – dieser Perspektive zu identifizieren und hieran zu arbeiten. Das tut Lindemann mit ihrem berechtigten Verweis darauf, dass das Thema Gewalt als Ingredienz jeglicher gesellschaftlicher Ordnung differenzierungstheoretisch bislang sträflich vernachlässigt wird. Die Moderne pflegt ja das Selbstbild, zumindest innerstaatlich Gewalt angeblich weitgehend domestiziert zu haben, weil ihr ja auch keinerlei gesellschaftliche Funktionalität zukomme. Lindemanns Beitrag ist damit ein gutes Beispiel dafür, wie man an einem begrenzten Phänomen Theoriefortschritte und zugleich soziologische Aufklärung des gesellschaftlichen Selbstverständnisses erzielen kann.
Auch Witte stellt sehr konstruktive Überlegungen zur Weiterentwicklung der Differenzierungstheorie an. Er tut dies mit einer breit angelegten Auflistung und Einordnung differenzierungstheoretischer Baustellen. Ich würde diesen Beitrag auf die gleiche Stufe stellen wie Hartmann Tyrells vor bald fünfzig Jahren bescheiden als „Anfragen an die Theorie der gesellschaftlichen Differenzierung“ titulierten, nach wie vor lesenswerten Artikel.[3] Witte spannt, der systemtheoretischen Perspektive Luhmanns eine feldtheoretische Konzeptualisierung funktionaler Differenzierung gegenüberstellend, einen weiten Bogen vom fast schon wieder vergessenen US-amerikanischen Neofunktionalismus über „multiple modernities“ und „multiple secularities“ bis hin zu den „varieties of capitalism“ und den „three worlds of welfare capitalism“, um schließlich bei den „Inklusionsprofilen“ anzukommen. In jeder dieser empirisch fundierten Forschungsrichtungen macht er kenntnis- und ideenreich Sichtweisen, Konzepte und Erklärungsmuster aus, die das Arsenal einer „theoriegeleiteten Differenzierungskomparatistik“ (S. 153) bestücken können. Er zeigt auf, dass bereits funktionale Differenzierung für sich betrachtet noch viel Stoff zum Nachdenken bietet, dass aber die Figuration von funktionaler Differenzierung mit anderen Differenzierungsformen im engeren Sinne sowie mit dem, was nun noch alles als „multiple Differenzierung“ gehandelt wird, die noch viel größere Baustelle ist, wenn man ernsthaft an einer Theorie moderner westlicher Gesellschaften interessiert ist. Eine solche Theorie müsste sich schrittweise daran abarbeiten, alle grundlegenden Ordnungsmuster dieser Gesellschaftsformation je für sich und im Zusammenspiel zu erschließen. Neben funktionaler Differenzierung dürften das – so mein eigener Vorschlag – Kapitalismus, Fortschrittskultur und arbeitsmarktbedingte Ungleichheiten sein.[4]
Wenn ich nun zum zweiten Teil des Buches und den unter dem Begriff „Relationierung“ versammelten Beiträgen komme, wird schnell klar, warum hier nicht „Integration“ als Überschrift gewählt wurde. Was sich in den Texten dieses Abschnitts des Sammelbandes findet, ist ein bunter Strauß, in dem jede einzelne Blume für sich genommen ansehnlich, doch das Gesamtarrangement weit weniger gelungen ist als der erste Teil des Buches. Aufsätze, die genauer explizieren, warum „Integration“ durch „Relationierung“ ersetzt werden sollte, fehlen; der Begriff „Relationierung“ spielt sogar in keinem der Beiträge eine tragende Rolle, nicht einmal in den zwei von den Mitherausgeber:innen Mölders und Siri beigesteuerten Texten. Die zitierte Behauptung der Herausgeber:innen, dass nun von „Relationierung“ statt von „Integration“ die Rede sei, wird ausgerechnet unter dieser Überschrift Lügen gestraft. Es scheint sich um eine spät gefundene Verlegenheitsüberschrift zu handeln: Relationieren kann man dies und das – entsprechend lässt sich für jeden der Beiträge großzügig sagen: ‚Passt schon!‘
Mit „Integration“ als zentralem Thema befassen sich – bezogen auf Systemintegration – die Aufsätze von Mölders, Vermaßen und Weinbach, die „Sozialintegration“ der Weltgesellschaft greift Holzers Text auf. Verweise aufeinander, wie sie im ersten Themenkomplex explizit vorkommen, fehlen hier fast durchgängig. Dabei hätte es durchaus aufschlussreich sein können, beispielsweise Mölders – an Armin Nassehi[5] anschließende – „Übersetzungsagenturen“ mit Vermaßens „systemischer Resonanz“ und Weinbachs struktureller Kopplung von Erziehung, Politik und Familie zu vergleichen. Bemerkenswert ist, dass alle drei – wie seit Langem vor allem Helmut Willke mit seinem Konzept der „Kontextsteuerung“ – es nicht wie Luhmann beim „Geschlossenheitsfokus“ (Vermaßen, S. 223) der systemtheoretischen Differenzierungstheorie belassen wollen und deren „Refokussierung […] in Richtung Offenheit“ (Vermaßen, S. 231) in Auseinandersetzung mit spezifischen empirischen Integrationsphänomenen versuchen, also die andernorts beschworene „empirische Wende“ der Differenzierungstheorie ernst nehmen, um über vage Metaphern wie „Übersetzung“, „Resonanz“ und „Kopplung“ hinauszukommen. Wie unterschiedlich die Arbeit an empirisch feinfühligen theoretischen Konzepten ausfallen kann, verdeutlicht ein Nebeneinanderlegen dieser drei Beiträge.
Die Texte von Kron, Youssef und Siri – jeder für sich genommen kundig und anregend – streifen das Integrationsthema allenfalls, tragen jedoch nichts Neues zu einem differenzierungstheoretischen Integrationsverständnis bei. Bei Kron geht es um das Zusammenspiel der verschiedenen Systemebenen bei der Erklärung von sexuellem Missbrauch in der Katholischen Kirche, Youssef zeigt eine evolutionäre Abfolge von dominanten Modi des Vergleichs in segmentär, stratifikatorisch und funktional differenzierten Gesellschaften auf, während Siri die Öffentlichkeitsverständnisse von Jürgen Habermas und Luhmann einander gegenüberstellt und beiden attestiert, dass ihre Vorstellungen der heutigen digitalen Öffentlichkeit in wichtigen Hinsichten nicht gerecht werden.
Insgesamt bietet der Sammelband eine Fülle an Anregungen zur weiteren Ausarbeitung einer differenzierungstheoretischen Perspektive auf die Gesellschaften der westlichen Moderne. Vieles, was hier jenseits funktionaler Differenzierung als Phänomene „multipler Differenzierung“ in den Blick genommen wird, ist auch einem engeren Verständnis nach beachtenswert – nämlich als gesellschaftliche Ordnungsmuster, die im Wechselspiel mit funktionaler Differenzierung stehen. Monoperspektivische Herangehensweisen, die allein auf funktionale Differenzierung – oder eines der anderen Ordnungsmuster – abstellen, können, wie inzwischen klar geworden sein dürfte, die meisten konstitutiven Dynamiken moderner Gesellschaften seit ihren Anfängen nicht adäquat einfangen.
Fußnoten
- Der Titel dieser Besprechung ist adaptiert von Aaron Wildavskys Kritik der gesellschaftspolitischen Planungseuphorie der 1960er- und frühen 1970er-Jahre: „If Planning Is Everything, Maybe It’s Nothing“, in: Policy Sciences 4 (1973), S. 127–153.
- Joachim Renn, Übersetzungsverhältnisse – Perspektiven einer pragmatistischen Gesellschaftstheorie, Weilerswist 2006, hier S. 68–74.
- Hartmann Tyrell, Anfragen an die Theorie der gesellschaftlichen Differenzierung, in: Zeitschrift für Soziologie 7 (1978), S. 175–193.
- Siehe Uwe Schimank, Grundriss einer integrativen Theorie der modernen Gesellschaft, in: Zeitschrift für Theoretische Soziologie 4 (2015), S. 236–268. Dieser Diskussionsvorschlag ist, wie Witte (S. 177) zu Recht anmahnt, „bislang bedauerlicherweise ‚Grundriss‘ geblieben.“ Vielleicht komme ich im Ruhestand schneller voran.
- Armin Nassehi, Im Land des Eigensinns. Möglichkeiten und Grenzen gesellschaftlicher Immunsysteme, in: Kursbuch 57 (2006), S. 65–77.
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Stephanie Kappacher.
Kategorien: Geschichte der Sozialwissenschaften Gesellschaft Gesellschaftstheorie Moderne / Postmoderne Soziale Ungleichheit Sozialer Wandel Sozialstruktur
Zur PDF-Datei dieses Artikels im Social Science Open Access Repository (SSOAR) der GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gelangen Sie hier.
Empfehlungen
Wie geht die Spätmoderne mit Verlusten um?
Folge 27 des Mittelweg 36-Podcasts
Das große Bild der Gegenwart
Rezension zu „Spätmoderne in der Krise. Was leistet die Gesellschaftstheorie?“ von Andreas Reckwitz und Hartmut Rosa
