Veit Braun | Rezension | 18.03.2025
Im Kaninchenbau der Mathematik
Rezension zu „Discounting the Future. The Ascendancy of a Political Technology“ von Liliana Doganova
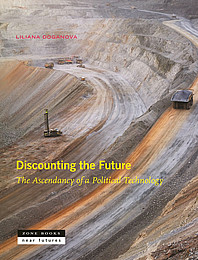
Die Zukunft ist zurück – Politiker*innen, Gerichte und das Wahlvolk müssen sich eine ganz grundlegende politökonomische Frage stellen: In welchem Verhältnis steht die Bewältigung anstehender Herausforderungen im Hier und Jetzt zu den zukünftig anfallenden Kosten und dem prospektiven Nutzen? Diesem Konflikt zwischen den berechtigten Interessen heutiger und denjenigen kommender Generationen widmet sich Liliana Doganova in ihrem Buch Discounting the Future. The Ascendancy of a Political Technology, in dem sie nachzuvollziehen versucht, wie die Idee der Diskontierung unsere Welt neugeordnet hat und immer noch ordnet.[1]
Im öffentlichen und privaten, wirtschaftlichen und politischen Leben wird heute diskontiert; sei es in der Forstwirtschaft, in der Arzneimittelforschung, zum Betrieb von Infrastruktur, zur Bewältigung des Klimawandels oder bei privaten Konsumentscheidungen. Was bedeutet Diskontieren? Man verrechnet die Kosten der Gegenwart mit den antizipierten Gewinnen der Zukunft: Wenn wir heute einen Euro investieren, welchen Ertrag können wir morgen davon erwarten? Welche alternative Investition hätte mehr oder eine schnellere Rendite zur Folge? Wie hoch ist die Unsicherheit unseres Investments?
Doganova, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Centre de Sociologie de l‘Innovation der Pariser École des Mines, erörtert diese Fragen im ersten Kapitel zunächst theoretisch aus der Perspektive der Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT) und der Science and Technology Studies (STS). Sie stützt sich dabei vor allem auf einen jüngeren Diskurs um die Wirkmächtigkeit ökonomischer Konzepte, Modelle und Formeln in der ‚echten Welt‘, den Michel Callon in den 1990er-Jahren losgetreten hatte und der seither in zahlreichen Arbeiten zur Performativität ökonomischen Wissens Niederschlag fand. Im Kern lässt sich Callons These wie folgt beschreiben: Ökonomisches Wissen schreibt sich in die gesellschaftspolitischen Strukturen ein, weil es das Handeln von Unternehmer*innen und ihren Berater*innen leitet und die Gesetzgebung ebenso wie die technische Infrastruktur prägt. Je mehr sich die Gesellschaft an den vereinfachten ökonomischen Beschreibungen ihrer selbst ausrichtet, desto ähnlicher werden ökonomische Theorie und Wirklichkeit. Diskontieren, so legt schon der Untertitel des Buches nahe, ist nicht einfach nur ein dröges Wertermittlungsverfahren, sondern eine politische Technologie.
Für ihr Buch wählt Doganova einen ungewöhnlichen empirischen Zugang – die mathematischen Formeln, mit denen Vermögenswerte errechnet werden. Diese veranschaulicht sie zunächst in ihrem Theoriekapitel (Kap. 1) am Beispiel des Ökonomen Irving Fisher, der Kapital Anfang des 20. Jahrhunderts als die Summe aller von einem Wertobjekt zu erwartenden Einkommensströme definierte. In den folgenden Kapiteln rekonstruiert sie schrittweise die Genese, Verallgemeinerung und politischen Implikationen der Diskontierungsmathematik in vier verschiedenen Anwendungsbereichen: Forstwirtschaft (Kap. 2), Managementlehre (Kap. 3), pharmazeutische Industrie (Kap. 4) und Bergbau (Kap. 5). Ganz im Sinne der STS erschließt sie sich (und uns) damit etwas, das wir in der Regel als undurchschaubare Black Box übergehen. Die mathematische Formelsprache in soziologische und politische Begrifflichkeiten aufzuschlüsseln, gelingt der Autorin dabei überaus anschaulich und verständlich.
Doganova verortet die Anfänge des Diskontierens im zweiten Kapitel an einem unerwarteten Ort: der Forstwirtschaft des 19. Jahrhunderts. Auf der Suche nach einer Lösung für ein praktisches Problem – die angemessene Vergütung für Erträge aus privatisiertem Forstland und die Preise beim staatlichen Ankauf von privatem Agrarland – entwickelten Forstwirte Verfahren zur Bestimmung des aktuellen Bodenwerts in Abhängigkeit von seinen zukünftigen Erträgen. Dies war vor allem in der Forstwirtschaft schwierig, da der Wert eines Waldes – anders als bei Weiden und Äckern – stark davon abhängt, wann genau die Bäume geschlagen und verkauft werden. Der hessische Beamte Martin Faustmann erarbeitete 1849 schließlich eine bis heute gebräuchliche Formel, die den aktuellen Wert eines Forsts unter Einbezug des reinen Grundstückswerts, des optimalen Alters eines gefällten Baumes,[2] der Zinsraten und der Verwaltungskosten errechnet. Daraus folgten radikale Umbrüche in der Forstwirtschaft: Fortan ging es den Förstern darum, die Wälder so zu bewirtschaften, dass sich ihr zukünftiger Wert maximierte.
Der Wert eines Vermögens entspricht also der Gesamtheit seiner Erträge in einer festgesetzten Zukunft, ausgedrückt in der Kaufkraft der Gegenwart.
Der hier entstandene Gedanken zog in der Folge immer weitere Kreise, wie Doganova im dritten Kapitel nachzeichnet. Der gegenwärtige Wert eines Besitzes errechnete sich nun nicht mehr nur aus der Summe vergangener Ausgaben (Wie viel hat mich mein Haus gekostet?), er bestand auch aus der Gesamtheit der zukünftigen Einkünfte (Wie viel Miete wird es über die nächsten dreißig Jahre abwerfen?). 1906 erhob Irving Fisher dieses Verhältnis zur Definition von Kapital. Letzteres, so schreibt er in seinem Werk The Nature of Capital and Income, ist schlicht die Summe aller zukünftig von einem Vermögen zu erwartenden Einkommensströme, die mit dem Kehrwert eines tatsächlichen oder fiktiven Zinssatzes multipliziert und so auf heutige Preise umgerechnet werden – sogenannte Discounted Cash Flows (DCF). Der Wert eines Vermögens entspricht also der Gesamtheit seiner Erträge in einer festgesetzten Zukunft, ausgedrückt in der Kaufkraft der Gegenwart.
Das Diskontieren wurde fortan in immer neuen, aber stets ähnlichen Formeln ausgedrückt, die sich auf alle möglichen Investitionen angewenden lassen. Die Theoreme bringen das Spannungsverhältnis zwischen Gegenwart und Zukunft knapp und dadurch verkürzt auf den Punkt. Wie viel Ertrag bringen mir heutige Ausgaben in der Zukunft? Ist die Ausgabe auch dann noch gerechtfertigt, wenn anderswo einträglichere Investments locken? Wann gelten bestimmte Investitionen als unrentabel, weil sie sich nicht innerhalb eines gegebenen Zeithorizonts oder im Vergleich mit konkurrierenden Geldanlagen rechnen? Ab Mitte des 20. Jahrhunderts wurde Diskontierung an nordamerikanischen Business Schools zu einem zentralen Inhalt in der Lehre. Kurz darauf mehrten sich auch die Versuche von staatlicher Seite, DCF für Unternehmen zur Vorschrift zu machen, um sie zu wirtschaftlichem, das heißt wachstumsorientiertem Handeln zu bewegen. Die Begrifflichkeiten wurden für die betriebswirtschaftliche Praxis mehrfach neu definiert, der Grundgedanke blieb jedoch bestehen: Firmen mussten ihr Handeln zunehmend an den zu erwartenden Einkommensströmen ausrichten, die über spezielle Formeln definiert werden (Kap. 3). Die Autorin erörtert die Folgen einer solchen mathematisierten Entscheidungsfindung am Beispiel von Pharmaunternehmen, die sie ausgiebig beforscht hat. Der Erfolg neuer Arzneimittel lässt sich naturgemäß nur mit großen Unsicherheiten abschätzen. Der Risikofaktor kann aber in die Zinsen und damit in die Diskontrate eingepreist werden. Im Ergebnis führt Unsicherheit zu steigenden Finanzierungskosten und damit zu höheren Mindesterwartungen an die jährlichen Einnahmen durch ein bestimmtes Medikament (Kap. 4).
Daran ist freilich wenig neu. Bereits vor der Diskontierung war Unternehmen und Investor*innen bewusst, dass es einen Zusammenhang zwischen der Unwägbarkeit der Zukunft, den Pfadabhängigkeiten heutiger Entscheidungen und der Höhe der zu erwartenden Rendite gibt. Was sich aber durch DCF verändert hat, ist der diskursive Raum: Alle Entscheidungen und Argumente müssen nunmehr in Zahlen übersetzt werden, damit sie gegeneinander aufgewogen werden können; ein Prozess, der teils mithilfe spezieller mathematischer Modelle vonstattengeht, bisweilen aber auch mit der willkürlichen Setzung einer bevorzugten Rendite abgekürzt wird. In der Erörterung pharmazeutischer Investmentstrategien zeigt sich die Crux an Doganovas Herangehensweise: Hat sie uns einmal in den Kaninchenbau der Mathematik geführt, so tun wir uns (und sie sich) schwer, wieder aus ihm herauszufinden. Denn als Leser*in hat man den Eindruck, die Formeln drücken einfach nur das präzise aus, was der gesunde Menschenverstand ohnehin mutmaßen würde – unsichere, illiquide Investitionen lohnen sich nur, wenn dem Risiko entsprechend hohe Gewinnchancen gegenüberstehen.
Einen zweiten Anlauf zur Politisierung der Technologie des Diskontierens unternimmt Doganova im folgenden, fünften Kapitel, in dem sie sich insbesondere mit der jüngeren Geschichte Chiles beschäftigt. Als die sozialistische Regierung unter Salvador Allende Anfang der 1970er-Jahre die Verstaatlichung der Kupferminen im Land beschloss, verrechnete sie die von den ausländischen Bergbauunternehmen getätigten Investitionen mit den von ihnen bis dato erwirtschaften Gewinnen und kam zu dem Ergebnis, dass die Unternehmen ihre Ausgaben bereits mehr als zurückerhalten hatten. Folglich weigerte sich die Regierung, die Unternehmen im Zuge der Enteignung finanziell zu entschädigen. Erwartungsgemäß waren die ausländischen Investor*innen und Regierungen davon nicht begeistert. Zwei Jahre später stürtzte Augusto Pinochet – mithilfe der CIA – die Regierung Allendes. Daraufhin oblag es José Piñera, einem der berüchtigten Chicago Boys, als Bergbauminister eine Definition dafür zu finden, was genau bei einer Konzession von Schürfrechten an das Unternehmen und bei einer Enteignung an den Staat übertragen wird. Piñera zerschlug diesen „gordischen Knoten“ (S. 220) in seinem Verfassungsgesetz, indem er zukünftige Erträge nicht nur mathematisch, sondern auch juristisch zu einem Teil des Bergwerks erklärte: Jede Erteilung einer Konzession, ebenso wie jede Enteignung, muss die zukünftigen Einkünfte mit einbeziehen, die den Eigentümer*innen einer Mine, einer Grube oder eines Steinbruchs zukommen werden. Anstatt der Regierung entschieden nun die Gerichte über Zuschlag oder Entzug einer Konzession, diese hatten ihre Entscheidungen fortan auf Grundlage der Wertdiskontierung zu treffen. Seither fanden ähnliche Bestimmungen ihren Weg in zahlreiche Handelsabkommen und Investitionsgesetze weltweit.
Doganova kontrastiert Piñeras Wertpolitik mit der Allendes, nach dessen Rechnung die Bergbauunternehmen Chile hätten entschädigen müssen (statt umgekehrt). Dass sich Erstere durchsetzte, liegt ihr zufolge an den USA, die aufgrund eigener politökonomischer Interessen den Sturz Allendes unterstützt hatten (S. 238). Sie erklärt den Siegeszug des Diskontierens immer wieder mit externen Faktoren – Putsch, Interventionen, Diktatur, ökonomische Sanktionen – und bricht so mit ihrer Herangehensweise in den vorigen Kapitel, in denen sie so eindrücklich den ideologischen und machtpolitischen Aspekt in den Formeln demonstriert.
Daraus ergibt sich denn auch die Schwierigkeit des Schlusskapitels, das ein Fazit aus dem Siegeszug der Diskontierung zu ziehen versucht. Ist die Zukunft wirklich das Maß aller Dinge? Sie sollte es zumindest nicht sein, macht Doganova geltend, denn: Armen sind mangels investierbaren Kapitals kürzere Zeithorizonte auferlegt als Reichen, Diskontraten werden mal zu hoch, mal zu niedrig angesetzt, eine vergangenheitsorientierte Wertberechnung kann in vielen Fällen zu niedrigeren Kosten für die Allgemeinheit führen als eine zukunftsbasierte. All dies ist richtig. Aber es ignoriert das, was die Autorin bis zu diesem Punkt so meisterhaft rekonstruiert und repliziert hat: die Macht der Diskontierungsformeln. In dem Moment, in dem wir sie mit Doganova verstanden haben, sind (auch) wir ihrer Suggestion verfallen. Wie Dan Davies bemerkt hat, kennt die Ökonomik keinen echten Zeitbegriff. Die Zukunft der ökonomischen Modelle ist stets eine Zukunft in den Werten und Begrifflichkeiten der Gegenwart.[3] Das Morgen ist stets nur das projizierte Heute, ebenso wie das Heute lediglich das unvollendete Morgen ist. Genau dies ist der Effekt des Gleichheitszeichens in den Formeln von Faustmann, Fisher und zahllosen anderen: die Unterstellung, dass zwischen Gegenwart und Zukunft kein Bruch, keine echte Unsicherheit, keine fundamentalen Wertunterschiede liegen, sondern lediglich ein variabler Diskontfaktor. Die postulierte Äquivalenz zwischen Heute und Morgen erleichtert politische und betriebswirtschaftliche Entscheidungen enorm, bleibt aber letztlich eine Annahme.
Diskontieren ist keine politische, sondern vielmehr eine apolitische Technologie, weil sie den Bereich des Politischen extrem schmälert.
So luzide Doganovas ideengeschichtliche Rekonstruktion des Diskontierens ausfällt, so schnell entgleiten ihr die Begrifflichkeiten, sobald sie versucht, den Diskontierungsgedanken zu kritisieren. Und auch man selbst ertappt sich immer wieder bei der Überlegung, ob es nicht einfach mit einer Anpassung des Diskontierungsfaktors getan wäre, um der Diskrepanz zwischen heutigen und morgigen Werten beizukommen. Genau darin liegt die Überzeugungskraft der Formeln: Sie verengen all das, was heute und morgen bewertet, verhandelt und gegeneinander aufgerechnet werden könnte, auf eine einzige Variable, die nur einen einzigen Wert annehmen kann. Diskontieren, so könnte man daher sagen, ist keine politische, sondern vielmehr eine apolitische Technologie, weil sie den Bereich des Politischen extrem schmälert. Im Schlusskapitel des Buches scheint dann auch Doganova vor der Suggestionsmacht der eingepreisten Zukunft zu kapitulieren: Wenn Ölkonzerne ihren Wert nach den Gewinnen der Zukunft bemessen, schreibt sie, sollten auch die Privatpersonen, die den Konzernen ihr Land für Bohrungen zur Verfügung stellen, die zukünftigen Gewinnerwartungen einrechnen, statt ihr Eigentum unter Wert zu verkaufen (S. 266).
Dessen ungeachtet ist Doganovas Studie ein lehrreiches und wichtiges Buch, das den Sozialwissenschaften und der politischen Ökonomie einen großen Dienst erweist. Es erklärt einem breiten Publikum vermeintlich unzugängliche Sachverhalte schlüssig und illustriert sie mit Alltagsbeispielen ebenso wie mit technischen Fällen. Doganova verhilft sowohl den STS wie auch der Performativitätsforschung zu neuen Ausblicken auf fundamentale Fragen von Zeit und Wert. Sie erinnert uns daran, dass die Arbeit damit noch lange nicht getan ist: Die Herausforderung ist, die Ökonomik als im Kern von politischen Annahmen durchsetzt zu begreifen und zu beschreiben.
Fußnoten
- Diese Rezension entspringt der gemeinsamen Lektüre und Autorinnendiskussion in der Lesegruppe „Up to Date in STS“.
- Verschiedene Baumarten haben verschiedene Wachstumsraten und damit auch unterschiedliche Zeitpunkte, wann sie am besten geschlagen werden sollten. Faustmanns Formel lässt sich aber an alle erdenklichen Baumarten anpassen.
- Dan Davies, The Unaccountability Machine. Why Big Systems Make Terrible Decisions – and How the World Lost its Mind, London 2024, S. 155–159.
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Henriette Liebhart.
Kategorien: Geld / Finanzen Wirtschaft
Zur PDF-Datei dieses Artikels im Social Science Open Access Repository (SSOAR) der GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gelangen Sie hier.
Empfehlungen
Christoph Deutschmann, Hannah Schmidt-Ott
Wie geht es mit dem Wachstum bergab?
Folge 28 des Mittelweg 36-Podcasts
Carolin Müller, Luca Kokol, Aaron Sahr, Jens Bisky
Wie überwindet man Inflation?
Episode 20 des Mittelweg 36-Podcasts
Missverständnisse und Missverhältnisse monetärer Souveränität in Europa
Eine dreiteilige Reihe zu monetärer Souveränität
