Diego Compagna | Rezension | 19.06.2025
Im Schatten der Idee
Rezension zu „Emotional Drivers of Innovation. Exploring the Moral Economy of Prototypes“ von Franziska Sörgel
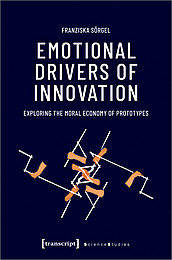
In ihrer Publikation Emotional Drivers of Innovation widmet sich Franziska Sörgel der Rolle von Emotionen in Innovationsprozessen, insbesondere im Kontext der Entwicklung medizinischer Technologien. Entstanden ist das Buch aus der Doktorarbeit der Kulturanthropologin. Sie vertritt darin die These, dass Emotionen einen wesentlichen Einfluss auf die Entstehung und Entwicklung von Ideen sowie auf Entscheidungsprozesse in der Technologieentwicklung haben, auch wenn dies oft nicht explizit thematisiert wird. Sörgel betrachtet Emotionen als integralen Bestandteil menschlicher Kommunikation und inkorporierten Wissens, der auch in vermeintlich rationalen Prozessen der Wissensproduktion und Technologieentwicklung wirksam ist. Eine enge Definition von Emotionen vermeidet sie bewusst, um den Blick für die vielfältigen emotionalen Aspekte in der Technologieentwicklung nicht einzuschränken. Ihr besonderes Interesse gilt den impliziten, oft unbewussten emotionalen Einflüssen, die sich in Nebensätzen oder beiläufigen Situationen manifestieren und erst dann in (Meta-)Emotionen wie Wut, Verzweiflung oder Angst zum Ausdruck kommen. Dabei fokussiert die Autorin die Rolle von Emotionen als treibende Kraft und Einflussfaktor bei der Entwicklung von Innovationen.
Mit der vorliegenden Studie stellt Sörgel die Rationalisierungslogiken der Wissensproduktion in der Innovations- und Wissenschaftsforschung in Frage (vgl. 23) und identifiziert damit ein Forschungsdesiderat innerhalb des interdisziplinären Feldes der Science and Technology Studies. Ihre ethnografischen Untersuchungen führte die Autorin in verschiedenen Innovationsumgebungen durch: in Inkubatoren, in sogenannten Makerspaces, in etablierten Unternehmen. Dort begleitete die Forscherin verschiedene Teams und sogenannte Innovator:innen[1] über Monate, teilweise über Jahre hinweg.
Als Ethnografin bedient sich die Autorin für ihre Forschung unterschiedlicher qualitativer Methoden wie etwa der teilnehmenden Beobachtung, Interviews und Dokumentenanalysen (vgl. S. 39). Methodisch stützt sich Sörgel auf die Grounded Theory sowie auf John Laws Konzept der „Method Assemblages“. Zweiterer Ansatz dient dem Versuch, das Untersuchungsfeld durch die Verwendung mehrerer unterschiedlicher Methoden so vielfältig abzubilden, wie es tatsächlich ist. Diese Verfahrensweise soll Verzerrungseffekte, die bei der Verwendung lediglich einer Methode entstehen können, minimieren und der Vielschichtigkeit des Forschungsgegenstandes Rechnung tragen. Hier wird exemplarisch deutlich, mit welch methodischer Sorgfalt die Autorin das dynamische und fragile Feld der Emotionen erschließt.
Emotional Drivers of Innovation ist in einen theoretischen und einen empirischen Hauptteil untergliedert, wobei Sörgel beide Teile immer wieder gelungen aufeinander bezieht. Die theoretischen Kapitel beleuchten die Zusammenhänge zwischen Imagination, Erfahrung und Emotion sowie den Strukturen und Orten, in und an denen Innovation entsteht. In den empirischen Kapiteln analysiert die Autorin konkrete Beispiele aus der Feldforschung und verfolgt dabei den gesamten Prozess, von der Entstehung einer Idee bis hin zu den Herausforderungen, die die Kommerzialisierung des Produkts am Ende mit sich bringt. Diese reichen von der sensorischen Einlegesohle über ein Pulswellen-Messstirnband sowie Hydrocephalus-Ventile bis hin zu einer digitalen Plattform zur Vermittlung von Patient:innen. Die Empirie stützt eine zentrale Erkenntnis der Technikgeneseforschung, nämlich dass der Innovationsprozess nicht linear verläuft, sondern von Brüchen und Iterationen geprägt ist.
Eine solide theoretische Basis erhält die Arbeit durch Bezüge auf prominente Denker wie Franz Brentano, William James und John Dewey, wobei besonders Sörgels Ausführungen zu Brentanos Konzept der Intentionalität neue und originelle Erkenntnisse in Bezug auf den kreativen Akt und die Ideenfindung im Rahmen von Innovationsprozessen liefern. Im Kern steht die Überlegung, dass das menschliche Bewusstsein stets auf etwas gerichtet ist – jeder Gedanke, jeder Wunsch, jedes Gefühl bezieht sich auf einen Gegenstand (damit sind nicht nur Objekte, sondern auch Personen und jegliche andere belebte Entitäten gemeint). Diese emotionale, zielgerichtete Denkweise führt dazu, dass persönliche Intentionen und Vorstellungen die eigene Wahrnehmung der Welt maßgeblich mitbestimmen:
„Desires and intentions may not necessarily align with reality but reveal how we aspire to construct it (and thus how we arrive at our judgements). Consequently, they can serve as motivation to effect changes in the world. This motivation, rooted in emotions, acts as a driving force, prompting societal engagement, political involvement, and participation in various ways.” (S. 53)
An dieser Stelle wird besonders deutlich, worum es der Autorin geht: Anstatt isolierte Gefühlsäußerungen von Entwickler:innen zu betrachten, ergründet Sörgel die emotionalen Ursprünge einer Idee, und deren Materialisierung im weiteren Verlauf des Entwicklungsprozesses. Die emotionale Aufladung von Ideen als Produkt der Vorstellungskraft von Individuen wird dabei als Akt des Denkens und Auseinandersetzens mit der Umwelt verstanden – und steht im Wechselspiel mit dem Pragmatismus des späteren Produktionsverlaufs. Ganz im Sinne pragmatistischer Tradition sind Denken, Handeln und Fühlen somit als interdependente Prozesse zu verstehen. Diese Perspektive betont, dass kreative Handlungen Ausdruck einer tiefen Verknüpfung von Erfahrung und sozialem Kontext sind und somit erlernten (individuellen und kollektiven) Bewertungsprozessen unterliegen. Dabei den Emotionen nachzuspüren und damit kreativ zu arbeiten erfordert Radikalität – hier liefert Sörgel eine Neuinterpretation dessen, was bisher aus anderen Studien zur Kreativität bekannt ist:
„The pragmatistic triad manifests as thinking, acting, and feeling. Thinking corresponds to what we previously described as conscious perception. In this context, acting transforms into a creative act based on my experiences and ideas. Finally, feeling integrates with the other two principles. I cannot think or act without feeling. Experience morphs into a reality from which my attitude and actions are derived. I root for the problem; I become – in the best sense – radical.“ (S. 126)
Die Erläuterungen zum Pragmatismus eröffnen dabei weniger neue Überlegungen; vielmehr deutet sich durch die geschickte Verflechtung von Phänomenologie und Pragmatismus deren theoretische Verwandtschaft an (vgl. S. 57).
Um eine Brücke zwischen individuellen und kollektiven Aushandlungsprozessen sowie den Orten, an denen sie stattfinden, zu schlagen, bedient sich Sörgel eines weiteren theoretischen Konzeptes in Anlehnung an die Wissenschaftshistorikerin Lorraine Daston, nämlich der „moralischen Ökonomie“, im hiesigen Fall jener von Prototypen, wie der Titel des Buches zu verstehen gibt. Die Autorin beschreibt dies als eine „Arena“, in der Werte, Erwartungen und Emotionen rund um technologische Innovationen verhandelt werden. Dieses Modell bietet eine fruchtbare Perspektive auf die Dynamik zwischen kreativen Idealen und den Zwängen der Marktrealität. Es zeigt, wie ursprüngliche Ideen durch kollektive Prozesse transformiert werden, um sie den Anforderungen der Kommerzialisierung anzupassen:
„By examining the moral economy of an artefact, questions about the thought patterns of stakeholders and actors can be answered, including: How are relevant actors emotionally shaped? What do they see as relevant? When do they judge something to be relevant to research, or how and when do they promote an idea?” (S. 74)
Der empirische Teil von Sörgels Arbeit zeigt sodann, wie die ursprüngliche Idealisierung einer Idee im Laufe der Entwicklung zugunsten ihrer Marktfähigkeit ‚reduziert‘ wird. Der Entwicklungsprozess beginnt mit der Idealisierung einer Idee, in der ihre Möglichkeiten betrachtet werden, im späteren Verlauf kommt es zu Brüchen im Prozess: Zunächst akkumuliert die Idee noch weitere Erwartungen und Wünsche anderer Akteur:innen wie Teammitglieder, Inkubatorleitung oder potenzieller Käufer:innen, was zu einer angereicherten Idealisierung führt. Schließlich aber erfolgt mit Blick auf die Marktfähigkeit eine gezielte Reduktion, die einer De-Idealisierung oder sogar Sterilisierung (in Anlehnung an Illouz‘ Begriff der ‚sterile fantasy‘, vgl. S. 193) gleichkommt, um die ursprüngliche Idee an die realen Marktanforderungen anzupassen. Hier treten außerdem noch andere Schwierigkeiten auf, die einen linearen Innovationsprozess verhindern, etwa wenn eine Teamauflösung die weitere Arbeit an einer Idee oder einem Prototyp in Frage stellt; oder wenn Innovator:innen dazu aufgefordert werden, ihr Produkt mit einem „selling promise“ auszustatten, das sie womöglich nicht abbilden können (S. 160 ff.). Sörgels Interviews belegen, wie anstrengend solche Entwicklungsprozesse sind und wie sehr derartige Praktiken den Innovator:innen widerstreben. Zugleich wird deutlich, dass bewusstes „Schwindeln“ („tissues of lies“, S. 161) oder absichtliches Verheimlichen Teil des üblichen Vorgehens, vor allem aber ein Handwerkszeug in dieser Branche ist. Sörgels Gesprächspartner:innen geben – bewusst oder unbewusst – immer wieder Auskunft über Irritationen und Ambivalenzen (S. 164). Womöglich wäre „die Lüge als Kulturpraxis“ in diesem Zusammenhang auch ein Kapitel wert gewesen, zumindest aber einen Verweis im Unterkapitel 6.4. Fake it till you make it (S. 160 ff.).
Die Autorin beobachtet, dass Emotionen in der Präsentation und Vermarktung von Innovationen strategisch eingesetzt werden. Ein Beispiel hierfür sind Demo Days, an denen Entwickler:innen ihre Prototypen vorstellen. In diesem Kontext kommen Emotionen gezielt zum Einsatz, um Ideen überzeugend zu präsentieren und potenzielle Investor:innen oder Kund:innen anzusprechen. Das Verdienst von Sörgels Forschungsarbeit liegt jedoch eher darin, die Relevanz von Emotionen und den ambivalenten Umgang mit ihnen multiperspektivisch zu erforschen, denn darin, den eigentlichen Geneseprozess im Feld der Technik zu rekonstruieren. In diesem Kontext verschränken sich subtile, subjektiv-autobiografische Elemente im Feld mit in Aushandlungen intersubjektiv „neu“ hergestellten emotionalen Zuweisungen an die Artefakte. Diese komplexe Dynamik zu erfassen und zu rekonstruieren stellt eine bedeutende Stärke und eine erhebliche Bereicherung für die Forschung im Bereich der Technikgenese und artefaktgebundenen Innovationen dar. Sörgels Studie schließt damit eine Lücke in der sozialkonstruktivistischen Erforschung von Technik, insbesondere in ihren „frühen“ Entstehungszusammenhängen.
Das Buch leistet einen Beitrag zur Innovations- und Wissenschaftsforschung, indem es die emotionalen und sozialen Mechanismen hinter technologischen Entwicklungen beleuchtet. Es hinterfragt kritisch die vorherrschende Rationalisierung von Innovationsprozessen und plädiert dafür, emotionale Faktoren in der Innovationsforschung und -praxis sowie darüber hinaus auch im Prozess der Wissensgenerierung stärker zu berücksichtigen. Die Studie eröffnet neue Perspektiven auf die oftmals verborgenen emotionalen Dimensionen von Innovationsprozessen und verdeutlicht deren Komplexität und Vielschichtigkeit.
Franziska Sörgel verfolgt in ihrer Publikation Emotional Drivers of Innovation einen breiten Ansatz zum Verständnis von Emotionen in Innovationsprozessen. Ihr Ansatz zielt darauf ab, die oft verborgenen emotionalen Dimensionen von Innovationsprozessen sichtbar zu machen und ihr Potenzial für ein tieferes Verständnis gesellschaftlicher Bewertungsmuster und Entscheidungsprozesse zu erschließen. Ihre Studie richtet sich an und ist von besonderem Interesse für die Communities in den Bereichen der Science and Technology Studies (STS), der (Technik-)Soziologie, Innovationsforschung, Technology Assessment (TA) sowie der Constructive Technology Assessment (CTA) – und zwar weil sie nachvollziehbar macht, wie Gesellschaften abhängig von ihrer Erfahrung und Sozialisierung auf unterschiedliche Weisen „innovativ“ sind, Wissen implizit ausdrücken, performieren und bewerten, um Problemlösungen zu finden.
Fußnoten
- Damit sind all jene Akteur:innen gemeint, die unmittelbar an Entwicklungsprozessen beteiligt sind.
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Igor Biberman, Stephanie Kappacher.
Kategorien: Affekte / Emotionen Arbeit / Industrie Technik Wirtschaft
Zur PDF-Datei dieses Artikels im Social Science Open Access Repository (SSOAR) der GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gelangen Sie hier.
Empfehlungen
Verbote: Unterkomplexe Diskurse über Freiheit und Politikinstrumente
Sechs Fragen an Felix Ekardt
„Kulturpoetik“ oder Phänomenologie?
Rezension zu „Augenmaß. Zur Ästhetik politischer Entscheidung“ von Christian Metz
