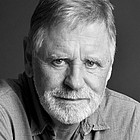Rainer Paris | Rezension | 25.06.2025
„Kulturpoetik“ oder Phänomenologie?
Rezension zu „Augenmaß. Zur Ästhetik politischer Entscheidung“ von Christian Metz
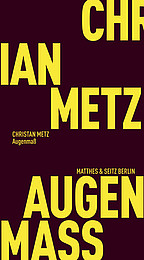
Eine zähe Lektüre – und ein insgesamt zwiespältiger Eindruck. Schon der Untertitel irritiert: Kann eine Entscheidung „ästhetisch“ sein? Gewiss können die mediale Inszenierung des Zustandekommens und der Verkündigung einer Entscheidung oder die rhetorischen Figuren der Legitimierung ästhetische Qualitäten aufweisen, aber die Entscheidung selbst?
Auf die erste Irritation folgen weitere. Sie resultieren aus einer eigentümlichen, man könnte auch sagen: nonchalanten Verschleifung oder Kombination unterschiedlicher Begriffe, die den gesamten Essay des an der RWTH Aachen lehrenden Literatur- und Medienwissenschaftlers Christian Metz durchzieht. So spricht er etwa von „Angela Merkels Ästhetik des Augenmaßes“ (S. 15), einer „Kulturpoetik des politisch Plausiblen“ (S. 25) oder auch von „Entscheidungsschönheit“ (S. 20). Ästhetisch-kunsttheoretische Argumentationen, Begrifflichkeiten der Anthropologie und Kulturanthropologie sowie politische Deutungen werden oftmals in einer Weise miteinander verschlungen, dass sich daraus zwar manche überraschenden Einsichten, aber auch (zumindest für den Rezensenten) eine Vielzahl von Ungereimtheiten und Verständnisproblemen ergeben.
Als Einstieg und Grundmaterial seiner Untersuchung dient dem Autor eine Passage aus Angela Merkels Fernsehansprache vom 18. März 2020 zu Beginn der Corona-Pandemie.[1] Detailliert schildert Metz die Grundelemente der Situation: Ausschnitt und Hintergrund, Haltung, Sprechweise, begleitende Gestik et cetera. Und natürlich analysiert er die im Wortlaut wiedergegebene Rechtfertigung der Entscheidungsfindung, also die Rhetorik der Abwägung, der Beratung mit Experten und dergleichen mehr. Im Kern lautet sein Befund: Wer Augenmaß verspricht oder unterstellt, buhlt um Vertrauen. „Im Kontrast zu den extremen Peaks der Erregungsgesellschaft implementiert die Politik mit Augenmaß eine Kultur der Besonnenheit, Affektkontrolle, Balance und der gemäßigten Gefühle.“ (S. 23) Merkel erweise sich hier als „Meisterin dieser inszenierten Mäßigung“. „Ihre Beschwörungsformel lautet: Was mit Augenmaß beschlossen und umgesetzt wird, ist gut.“ (Ebd.)
So weit, so richtig. Trotzdem ist fraglich, ob diese Beobachtungen für die Begründung einer politischen „Ästhetik des Augenmaßes“ bereits ausreichen. Im nächsten Abschnitt verlässt der Autor das Terrain der Politik und dehnt den Fokus seiner Untersuchung erheblich aus. Dabei unterscheidet er drei verschiedene sachliche Funktionen und damit verbundene Redeweisen von Augenmaß: das Augenmaß als „Metapher“, als „Körpertechnik“ und als „epistemische Praxis“ (S. 25 ff.). Während er die Metaphorik nur streift, bilden die beiden anderen Theorieperspektiven den Hauptgegenstand seiner „Genealogie des Augenmaßes“, ja sie stehen geradezu im Zentrum des gesamten Essays.
Die folgenden Kapitel widmen sich dem Augenmaß in so unterschiedlichen Kontexten wie dem Sticken der Bettina von Arnim, den Anleitungen des perspektivischen Zeichnens und Malens in den Kunstschulen der frühen Neuzeit oder den Aspekten der räumlichen Orientierung in den pädagogischen Anschauungen von Jean-Jacques Rousseau und Immanuel Kant. Ein weiteres Kapitel behandelt die Funktionalität des Augenmaßes im Rahmen militärischen Entscheidungshandelns bei Carl von Clausewitz („Feldherrenblick“, Bedeutung des coup d’œil in Situationen höchsten Risikos). Den Abschluss dieses Materialteils bildet eine subtile Verortung des Augenmaßes innerhalb von Max Webers Politik als Beruf (S. 75–89), in dem die Trias „Leidenschaft – Verantwortungsgefühl – Augenmaß“ eine wichtige Rolle spielt. In diesen Kapiteln bewegt sich der Autor auf seinem ureigenen Terrain und wartet mit einer Vielzahl wissenswerter Details und Informationen auf.
Dennoch bleiben sachlich-konzeptionelle Vorbehalte und gravierende Mängel der Darstellung. Ein Grundeinwand bezieht sich auf die Deutung des Augenmaßes als Körpertechnik. Hierzu sei, auch als exemplarischer Beleg für die gesamte Argumentationsweise, eine längere Passage zitiert:
„Da man das Vermögen, mit den bloßen Augen zu messen, zu einer Fertigkeit optimieren kann, handelt es sich beim Augenmaß um eine Körpertechnik. […] Durch sie kann jeder erfahren, was es heißt, eine Entscheidung nach Augenmaß zu treffen. Nicht einmal eine Tasse Kaffee ließe sich in der eigenen Lebenswelt ausbalancieren, keine befahrene Straße überqueren oder auch nur ein zerknülltes Papier in einen Mülleimer werfen, ohne auf das eigene Augenmaß zu vertrauen. Körpertechniken des Augenmaßes generieren unsere alltägliche Körperlichkeit. Wenn Politik sich auf sie beruft, schafft dies Vertrauen, erzeugt Plausibilität, Verständnis. Die Entscheidung mit Augenmaß begründet auf diese Weise eine Rede-, Körper- und Gefühlsgemeinschaft. Dieser Rückbezug zur Lebenswelt bildet die Wirbelsäule der Ästhetik des politischen Augenmaßes.“ (S. 26 f.)
Was für ein Begriffssalat! Dass die gattungstypische Koordinierung von Auge und Hand in Handwerk und Sport (Basketball!) perfektioniert werden kann, macht sie noch nicht zu einer Körpertechnik. Gleiches gilt für die Fähigkeit zur raumzeitlichen Abschätzung herannahender Fahrzeuge im Straßenverkehr. Inwiefern trifft jemand, der eine Tasse zum Mund führt, eine „Entscheidung nach Augenmaß“? Und seit wann sind „Alltag“ und „Lebenswelt“ dasselbe? Bei Marcel Mauss sind Körpertechniken kulturspezifisch tradierte und sozialisatorisch erworbene, durch Übung ausdifferenzierte Bewegungsarten (Laufen und Marschieren,[2] Schwimmen, Werfen usw.) und nicht einfach Fähigkeiten, die zu ihrem Erlernen notwendig sind. Folgte man einem solchen Verständnis, würde jedes materielle oder soziale Handeln, das einer raumzeitlichen Orientierung bedarf, zu einer Körpertechnik – und der Begriff konturlos.
Wie stellt Metz nun den Rückbezug zu den medialen Auftritten und zur Legitimationsrhetorik heutiger Politiker her? Die wiederholt vorgetragene Argumentationsfigur lautet: Die Inszenierungen des politischen Augenmaßes durch Merkel, Stoiber und andere schöpften aus einem geschichtlich überlieferten, kulturell geprägten und größtenteils impliziten „Wissenspool“ (S. 30), den sie mit ihren Adressaten teilten und der damit ihrem Handeln Wirkkraft und Resonanz verleihe.
Im Schlusskapitel über den Ortsbesuch kommt Metz auf die Ausgangsfrage der ästhetischen Prinzipien der Medienpräsenz von Politikern zurück und zeigt an ausgewähltem Bildmaterial, wie durch Blickrichtung, Accessoires und situatives Arrangement Herausgehobenheit, Überblick und Kompetenz inszeniert werden. Das ist interessant und durchaus instruktiv, aber auch hier schlagen am Ende die bereits angesprochenen Kapriolen der Darstellung wieder durch. Hierzu noch einmal eine Kostprobe:
„Diese Typologie des Augenmaßes, bei der sich der Politiker nach dem Vorbild von Clausewitz an der Abbruchkante des Situativen inszeniert, hat mit Robert Habecks Selbstdarstellungen auf Instagram noch einmal einen neuen Grad der Direktheit, aber auch der Prozessualität und Vorläufigkeit erfahren.“ (S. 96)
Der soziologische oder politikwissenschaftliche Ertrag des Essays ist eher gering. Nur im ersten und letzten Kapitel erfolgt, wie im Werbe- und Klappentext des Verlags angekündigt, eine materiale Untersuchung des Arsenals der politischen Inszenierung von Mäßigung, Abwägung und unterstelltem Weitblick als Methoden der Herstellung von Loyalität – man könnte auch sagen: des Einlullens und der Züchtung politischer Apathie –, also jener Phänomene, auf die der kritische Anstrich des Bändchens abstellt. Sicherlich spielen bei der Ausweitung des Themas auch unterschiedliche Fachrelevanzen und Theoriediskurse eine Rolle – es wäre unfair, einem Literaturwissenschaftler vorzuwerfen, dass er kein Soziologe ist. Wenn aber selbst in zentralen Aspekten der Fragestellung wichtige Differenzierungen, etwa des zugrunde gelegten Entscheidungsbegriffs,[3] unterbleiben, so ist dies keine Kleinigkeit. Und das verstimmt umso mehr, als in dieser Art Prosa die Grenze zwischen Formulieren und Fabulieren nach meinem Dafürhalten nicht selten überschritten wird.
Fußnoten
- Der Text der Ansprache ist auf den Seiten der Bundesregierung zu finden, ein Videomitschnitt steht auf YouTube zur Verfügung.
- Vgl. Marcel Mauss, Die Techniken des Körpers, in: ders.: Soziologie und Anthropologie, Bd. II, übers. von Henning Ritter, München 1975, S.199–222, hier S. 201.
- Man denke hier etwa an die bei Peter Bieri getroffene Unterscheidung von instrumentellen und substanziellen Entscheidungen (Das Handwerk der Freiheit, München 2001, S. 54 ff.) oder den einschlägigen Bestseller von Daniel Kahneman, Schnelles Denken, langsames Denken, übers. von Thorsten Schmidt, Berlin 2016, auf den Metz nur summarisch verweist (Anm. 177).
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Karsten Malowitz.
Kategorien: Affekte / Emotionen Gesellschaft Gesellschaftstheorie Interaktion Kommunikation Kultur Kunst / Ästhetik Macht Medien Öffentlichkeit Politik
Zur PDF-Datei dieses Artikels im Social Science Open Access Repository (SSOAR) der GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gelangen Sie hier.
Empfehlungen
Verlustangst, ästhetisch
Rezension zu „Wut und Wertung. Warum wir über Geschmack streiten“ von Johannes Franzen
Gesellschaft ohne Gesicht
Rezension zu „La fin de la conversation? La parole dans une société spectrale“ von David Le Breton
Finanz und Fake News
Rezension zu „Kapital und Ressentiment“ von Joseph Vogl