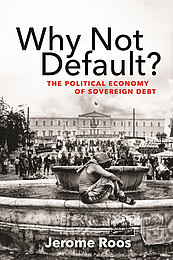Kai Koddenbrock | Rezension | 19.11.2019
Zum "Deal" zwischen Staat und Finanzsektor
Rezension zu „How Global Currencies Work. Past, Present, and Future“ von Barry Eichengreen, Arnaud Mehl und Livia Chitu und "Why Not Default? The Political Economy of Sovereign Debt“ von Jerome Roos
Ohne Kredite gäbe es den modernen Nationalstaat nicht. Aber ohne staatliche Regulierung und Garantien wiederum gäbe es auch keine Finanzmärkte. Diese simplen Feststellungen offenbaren, wie eng private Profitinteressen und Kapitalakkumulation, die Bereitstellung öffentlicher Güter und die Ausübung politischer Macht miteinander verbunden sind. Und wie in allen engen Beziehungen gehören Krisen auch hier dazu. Die zunehmende Frequenz von Finanzkrisen, die meist sowohl Banken- als auch Staatsschuldenkrisen nach sich ziehen und dann mit Steuermitteln bekämpft werden, unterstreicht diese Krisenhaftigkeit. Die beiden hier besprochenen Bücher liefern aufregende Erkenntnisse hinsichtlich dieser krisenanfälligen Symbiose.
Das erste Buch mit dem Titel How global currencies work ist das Ergebnis einer Kooperation zwischen dem Berkeley-Ökonomen Barry Eichengreen sowie den beiden EZB-Analyst*innen Arnaud Mehrl und Livia Chitu. Es widmet sich der Globalisierung von Währungen, also den verschiedenen Arten und Weisen, wie sich Währungen im Lauf der Geschichte weltweit verbreitet haben. Das Autor*innenteam argumentiert, es sei trotz gegenläufiger Tendenzen in den letzten Jahrzehnten historisch betrachtet die Norm, dass stets mehrere Währungen auf dem globalen Markt gleichzeitig miteinander konkurrierten und versuchten, sich Marktanteile zu sichern. Das sei beispielsweise vor dem ersten Weltkrieg zwischen Franc, Mark und Pfund so gewesen, genauso wie es heute etwa mit Dollar, Euro, Yen und Renminbi der Fall sei. Mit dieser Lesart wenden sich Eichengreen et al. gegen die sowohl unter Ökonom*innen als auch in den Medien weit verbreitete Auffassung, die USA beziehungsweise der US-Dollar dominierten den Währungsmarkt beinahe vollständig. Auf abstrakter Ebene – so die weitergehende theoretische Annahme, der sich Eichengreen et al. entgegenstellen – tendierten kapitalistische Währungssysteme stets zur totalen Dominanz nur einer Währung, einem „Welt-Geld“ wie schon Karl Marx argumentierte.[1] Die Autor*innen befassen sich in ihrer Analyse globaler Währungshierarchien[2] jedoch nicht, wie man zunächst meinen könnte, mit den Konsequenzen einer solchen Hierarchie, sondern mit der ganz konkreten Frage, wie stark die Dominanz der vermeintlichen Hegemonialwährung des US-Dollars tatsächlich ausfällt.
Zu diesem Zweck gehen die drei Autor*innen das Geld ganz traditionell mit der lehrbuchmäßigen Trias der drei Geldfunktionen als Wertmaßstab, Wertaufbewahrungsmittel und Tauschmittel an, bevor sie die quantitativen Dominanzverhältnisse historisch und anhand von Fallstudien zum Vereinigten Königreich, Japan, dem Euroraum und China untersuchen. Basierend auf fünf Indikatoren bewerten sie den Stellenwert einer Währung (S. 170): 1. entsprechend ihrer Rolle in der Währungsreservehaltung der Zentralbanken, 2. entsprechend ihres Anteils am globalen Devisenhandel (vor allem bei Fonds und Privatbanken), 3. als Vehikel zur Denominierung von Staats- oder Unternehmensanleihen, 4. als Rechnungseinheit im internationalen Warenhandel und 5. entsprechend ihres Stellenwerts als Anker für andere Währungen, die sich an sie binden, um die eigene Fluktuation möglichst gering zu halten. Als Ergebnis ihrer Analyse machen die Autor*innen unterschiedlich große Anteile an allen fünf Indikatoren für unterschiedliche Währungen aus, der Dollar dominiert jedoch in jedem der fünf Felder. So werden beispielsweise 80 bis 85 Prozent aller Devisenreserven in Dollar gehalten sowie 50 Prozent des Warenhandels in Dollar abgewickelt, dagegen nur 25 Prozent in Euro.
Abgesehen von derlei quantitativen Aussagen wartet das Buch insbesondere an jenen Stellen mit interessanten Ausführungen auf, wo es um die qualitativen Voraussetzungen für eine Internationalisierung der eigenen Währung sowie ihrer Marktchancen geht. Denn zum Gelingen eines solchen Vorhabens bedarf es den Autor*innen zufolge sowohl politischer Stabilität als auch „tiefer“ wie „liquider“ Finanzmärkte. Als „tief“ gelten Märkte dann, wenn sie zahlreiche unterschiedliche Finanzprodukte und einen in Relation zum Bruttoinlandsprodukt betrachtet voluminösen Finanzmarkt aufweisen. Als „liquide“ werden Märkte bezeichnet, deren Finanzwaren schnell und ungehindert gehandelt werden können. Sind diese beiden Bedingungen erfüllt, verringern sich die mit der Internationalisierung verbundenen Risiken wie etwa eine plötzliche Geldabwertung, schließlich steht keine überraschende Enteignung zu befürchten und finanzielle Eigentumstitel können im Zweifel leicht sowie ohne staatliche Kontrolle weiterverkauft oder verbrieft werden. Tiefe und liquide Finanzmärkte existieren jedoch nicht überall auf der Welt. Sie haben sich beispielsweise in Europa und den USA erst in den letzten Jahrhunderten und Jahrzehnten entwickelt.
Eichengreen et al. sind aber nicht als schlichte Apologet*innen eines tiefen und liquiden Finanzmarktes zu verstehen. Sie heben durchaus hervor, dass die notwendige Entwicklung dieser Märkte, um die eigene Währung zu internationalisieren und auf der Welt zirkulierbar zu machen, mit Risiken verbunden ist. So führen uns die Autor*innen unterschiedliche politische Strategien im Umgang mit dem Geldweltmarkt vor Augen: Japan etwa hatte seinen Außenhandel bis in die 1980er-Jahre stark reguliert und keinerlei Anstalten gemacht, den Yen „in die Welt zu schicken“. Auf diese Weise hatte das Land seinen ökonomischen Aufschwung organisiert. Als es jedoch Mitte der 1980er-Jahre – auch auf Druck von Seiten der USA hin – mit der Internationalisierung des Yen begann, geriet Japan in eine Wirtschaftskrise: Es verlor Marktanteile und hat seitdem seine Position als ernstzunehmender Konkurrent der USA eingebüßt. Sich dieses Beispiel als Warnung nehmend, geht China heute behutsamer vor, schließlich kann Wachstum auch durch Staatsdirigismus gefördert werden, wie etwa die Entwicklung Japans vor den 1980er-Jahren zeigte. Vor diesem Hintergrund ist also völlig unklar, warum Staaten überhaupt Kapitalkontrollen aufheben und ihre Währung der internationalen Spekulation und dem Währungshandel aussetzen sollten.[3] Dass etwa die IWF-Forschungsabteilung neuerdings Kapitalkontrollen in Einzelfällen und unter gewissen Bedingungen wieder als sinnvoll erachtet, verdeutlicht nur noch mehr, wie fragwürdig die angebliche Alternativlosigkeit dieses Vorgehens ist.
An diesem Punkt kommt Jerome Roos’ grandiose Studie Why not default? – das zweite hier zu besprechende Buch – ins Spiel, stehen doch im Zentrum der Roos’schen Überlegungen die Fragen, wer von internationalisierten Geld- und Kapitalströmen profitiert und wie sich das Verhältnis zwischen privaten Gläubigern und öffentlichen Schuldnern historisch entwickelt hat. Roos, der bisher als einer der Herausgeber des linken ROAR-Magazines bekannt sein dürfte, belebt mit diesem Buch die polit-ökonomische Analyse von Bankenmacht und Schulden neu. Der Band besticht einerseits durch historische Details und andererseits durch ein handliches, dennoch präzises Argument im Hinblick auf die strukturelle Macht von Finanzakteuren. Das Buch bietet eine derart eingängige Heuristik, dass ihr zukünftig viele Anwender*innen gewiss sein dürften. Als selbstbewusst historisch-diachrone Studie qualitativer Sozialforschung ist sie auch in methodischer Hinsicht höchst inspirierend.
Aber der Reihe nach: Roos fragt sich eingangs, warum staatliche Schulden bei ausländischen Privatbanken und öffentlichen Kreditgebern in den letzten Jahrzehnten immer weniger in Verzug geraten sind und deren Rückzahlung nicht verweigert wurde. In der bis ins 12. Jahrhundert der genuesischen und florentinischen Herrschaft verfolgten Schuldengeschichte sei ein solch unterwürfiges Staatshandeln ganz und gar nicht die Regel gewesen. Demgegenüber, so der Autor, habe sich bis heute ein vernetztes Finanzsystem mit spezifischen Durchsetzungsmechanismen entwickelt, das die Rückzahlung staatlicher Schulden an private Gläubiger faktisch garantiere. Aber – und das ist der brillante Fortschritt gegenüber der in der internationalen Politischen Ökonomie seit Susan Strange dominierenden klassischen strukturellen Machtthese – ob und wie sich die Macht von Banken und privaten Kreditgeber*innen durchsetzt, hängt von drei spezifischen historischen Mechanismen ab, die es en detail zu erforschen gilt. Von jeglichem Strukturdeterminismus befreit, wird die Untersuchung der strukturellen Macht des Finanzsektors zum aufregenden empirischen Forschungsvorhaben. In seiner Analyse rückt der Polit-Ökonom Roos drei Durchsetzungsmechanismen in den Mittelpunkt, die in den Fallstudien auf je unterschiedliche, ganz spezifische Weise zum Tragen kommen: 1. Disziplinierung durch Finanz- und Kapitalmärkte, 2. konditionale öffentliche Kreditvergabe durch den IWF und 3. die Brückenrolle heimischer Eliten in Schuldnerstaaten.
Anhand dreier historischer Fallstudien – Mexiko in den 1980er-Jahren; Argentinien um das Jahr 2000 und Griechenland von 2009 bis heute – argumentiert Roos, dass die Disziplinierung von Schuldnerregierungen durch den sogenannten Markt dann besonders erfolgreich gewesen sei, wenn die Kreditvergabe kartellförmig organisiert ist, also nur von sehr wenigen Banken ausgeführt werden kann. Dem Autor zufolge sei das insbesondere im Mexiko der 1980er-Jahre der Fall gewesen. Der dahinter stehende Mechanismus liegt auf der Hand: Sind Kredite nur an wenigen Stellen erhältlich und steht als Konsequenz eines Schuldenschnitts bereits bestehender fälliger Verbindlichkeiten zu befürchten, dass auch andere Stellen die Vergabe eines neuen Kredits verweigern, werden Schuldner alles tun, damit dieses Kartell ihnen wohlgesonnen bleibt. Die in den letzten Jahrzehnten massiv verschärfte Konzentration im Bankensektor hat die Position dieses Kartells immer weiter gestärkt. Andererseits stellt sich die sukzessive Abschaffung von Kapitalkontrollen als ein weiteres Mittel zur Disziplinierung durch den Markt dar, ein Mittel, das es für Regierungen überhaupt erst erforderlich macht, Kapital an der Flucht zu hindern oder durch massive Kapitalzuströme und -abflüsse hervorgerufene Boom and Bust-Zyklen auszugleichen. Im Rahmen der Lateinamerikanischen Schuldenkrise in den 1980er-Jahren wurden zwar sowohl der Verbriefung von Schulden als auch der Ausgabe von Anleihen verstärkt Aufmerksamkeit zuteil, an der Konzentration im Bankensektor und damit der Abhängigkeit von einer kleinen Anzahl an Banken änderte das jedoch nichts. Am Beispiel der Argentinienkrise zeigt Roos stellvertretend für eine Reihe von Staaten, dass die Anleihen zur damaligen Zeit zwar in Streubesitz und in die Portfolios vieler Investmentfonds aufgenommen worden waren, doch sowohl die Abwicklung der Ausgabe von Staatsanleihen wie deren Weiterverkauf seien weiter in der Hand weniger Banken geblieben, von denen Staaten seitdem abhängig seien.
Der zweite Mechanismus der konditionalen, also an die Erfüllung vorgegebener Bedingungen geknüpften Kreditvergabe durch öffentliche Geldgeber – ursprünglich seit Mitte der 1980er-Jahre von internationalen Finanzinstitutionen eingesetzt, um den eigenen Einfluss in den Empfängerländern zu erhöhen – bezieht sich in der Roos’schen Analyse schließlich auf die wachsende Rolle des IWF. Dieser hat sich beispielsweise seit Beginn der Mexikokrise zunehmend in das Schuldenmanagement des mexikanischen Staates eingemischt und umfangreiche Reformen etwa in den Bereichen Außenhandel und Devisenmarkt gefordert. Ohne den IWF als ‚Kopf des Kreditgeberkartells‘ wären die neuen Schuldenrunden im Globalen Süden oder in Griechenland undenkbar gewesen; seine Rezepte der Strukturanpassung und Austeritätspolitik sind wohlbekannt.
Die Brückenrolle der heimischen Eliten als dritter Durchsetzungsmechanismus erlaubt es Roos dann, seine bisherige Analyse mit dem weiten Feld der vergleichenden Politischen Ökonomie in Beziehung zu setzen. Denn was der Autor als die tragende Rolle der neoliberalen Technokratie und des heimischen Finanzsystems analysiert, ist stets das Resultat sozialer Auseinandersetzungen, die zwischen sozialen Bewegungen, Gewerkschaften, Parteien, Medien ebenso wie der Zentralbank stattfinden, was etwa Martin Höpner jüngst für das deutsche ‚Unterbewertungsregime‘ analysierte.[4] Ausländische Kredite verbessern strukturell die Position derjenigen Eliten, die von einer stärkeren Auslandsorientierung ebenso profitieren wie der Export- und Finanzsektor. Am griechischen Beispiel etwa lässt sich sehr gut ablesen, dass die wirtschaftliche Elite ein größeres Interesse daran hatte, die Forderungen des IWF und anderer Gläubiger zu erfüllen, als die breite Bevölkerung, die beispielsweise unter hoher Arbeitslosigkeit und den brutalen Kürzungen im Gesundheitssystem zu leiden hatte.
In der Zusammenschau unterstreichen beide Bücher einerseits die faszinierende Kreativität, die Finanzsektor und Staat stets an den Tag legen, um ihren sich gegenseitig Profit und Macht gewährleistenden „Deal“ historisch zu erneuern.[5] Ihr strategisches Ziel ist dabei stets, die eigene Zahlungsfähigkeit systematisch zu erhalten und gleichzeitig die eigenen finanziellen Ansprüche auszuweiten. Als die Abhängigkeit von Geldwaren wie etwa Gold im Laufe des 19. Jahrhunderts zu stark wurde und die Produktion neuer finanzieller Ansprüche an Grenzen stieß, rief man die Institution der Zentralbank ins Leben.[6] Als ‚lender of last resort‘ wurde sie mit der Fähigkeit ausgestattet, Geld einfach auf Knopfdruck drucken zu können,[7] solange sie nachweisen kann, davon keinen exzessiven Gebrauch zu machen. Als im 20. Jahrhundert der Großteil lateinamerikanischer und afrikanischer Staaten bankrottging, sprang für eine gewisse Zeit der IWF als globaler ‚lender of last resort‘ ein. Das war in gewissem Sinn unnötig ‚realwirtschaftlich‘, operierte der IWF doch mit einer tatsächlich hinterlegten Kreditmenge, nicht mit Fiatgeld. Heute überziehen die Zentralbanken den Globus mit einem financial safety net, das aus weitverzweigten sogenannten swap lines besteht, also sicher zugesagten Geldspritzen, die im Falle einer Krise schnell zum Einsatz gebracht werden können. Die Maschine, die finanzielle Ansprüche in Form von Geld und Währungen produziert, ist also so gut geölt wie nie zuvor.
Die historischen Fallstudien der beiden hier vorgestellten Werke offenbaren jedoch keine lineare Entwicklung hin zu einer immer stärker werdenden Macht der Banken oder, um eines der neueren Phänomene aufzugreifen, der Vermögensverwalter wie etwa Blackrock.[8] Stattdessen, so lernt man durch die Lektüre, muss die Beziehung zwischen Geld- und Kreditsystem, finanziellem Profit und politischer Macht ständig neu verhandelt und austariert werden. Der „Deal“ zwischen Staat und Finanzsektor wird im Kontext von Staatsschulden und der Internationalisierung der Währungen historisch sichtbar. In ständiger Auseinandersetzung mit staatlichen Regulierungen und räumlichen Handlungsspielräumen hat der private Finanzsektor ausgeklügelte Wege entwickelt, sich nicht nur sein eigenes Überleben, sondern gar Wachstum zu sichern, besteht seine größte Fähigkeit doch darin, immer neue, möglichst international sowie schnell zirkulierende finanzielle Ansprüche auf zukünftig zu schaffenden Wert zu generieren. Durch Gebühren oder Preisdifferenzen werden dabei Gewinne erzielt und Profite durch öffentliche Stellen abgesichert, schließlich würden Risikobereitschaft und Profiterwartung ohne öffentliche Garantien und die Möglichkeit sogenannter bail-outs deutlich geringer ausfallen. Wie schon vor der Finanzkrise praktiziert werden auch die Versuche wiederkehren, faule Kredite neu zu verpacken, weiterzuverkaufen und so neue Profite zu ermöglichen.
Dennoch, so zeigen Eichengreen et al., führt dieser Mechanismus aus globaler Sicht niemals zur totalen Dominanz einer Währung. Regionale Eigenheiten und gebietsspezifische Handelskreisläufe ermöglichen es auch anderen, etwa chinesischen, europäischen und japanischen Währungen, regional als Zahlungs- und Wertaufbewahrungsmittel zu fungieren. Der Währungsmarkt lässt eine gewisse Variation zu. Gleichzeitig kann die Dominanz von IWF und Bankenkartell in institutioneller Hinsicht immer auch als instabil betrachtet werden. Deren strukturelle Macht ist nie total, wie etwa der Niedergang der englischen Baringsbank Ende des 19. Jahrhunderts oder derjenige der Deutschen Bank Anfang des 21. Jahrhunderts zeigen.
Die von Eichengreen et al. eingenommene, makroökonomistische und regierungstechnologische Perspektive auf Währungen erlaubt es hingegen nicht, den „Deal“ zwischen Staat und Finanzsektor sowie konkrete politische wie soziale Auseinandersetzungen und deren Verteilungswirkungen in den Blick zu nehmen. Das wiederum ist die Stärke des Roos’schen Why not default? Der überraschende Handlungsspielraum etwa der argentinischen Regierung nach den massiven Protesten im Jahr 2002 – sie hatte einen Schuldenschnitt durchgesetzt und dennoch bald wieder Zugang zu ‚den Kapitalmärkten‘ erlangt – oder die reale Chance der griechischen Syriza-Regierung im Jahr 2015, durch den Aufbau einer Parallelwährung das Referendumsergebnis umzusetzen, unterstreichen die Möglichkeiten ‚des Politischen‘ gegenüber der Finanzindustrie. Auf der anderen Seite vermag Jerome Roos’ Studie mit ihrem Fokus auf den öffentlichen Schuldenschnitt und auf das Kalkül der Regierungen nicht zu erklären, warum und wie bestimmte dominante Finanzakteure plötzlich von der Bildfläche verschwinden, obwohl ihre Macht oft groß ist. Aus einer systemischen Sicht kann die Antwort darauf nur lauten, dass sogar private Profite durch Konzentrationsprozesse und Oligopole im Kapitalismus stets gefährdet sind. Ebenso vermag niemand die im Zusammenhang mit Geld und Schulden entstehenden Erwartungen wie Erwartungs-Erwartungen völlig zu kontrollieren. Vor diesem Hintergrund kann jede Geschäftsstrategie nur lauten: Mach Profit, so lange es nur geht! Aus politischer Perspektive ist diese alle Akteure betreffende Unsicherheit in gewisser Hinsicht animierend, bedeutet sie doch, dass der „Deal“ zwischen Politik und Finanzsektor bei entsprechender Mobilisierung immer auch anders geschlossen werden könnte.
Fußnoten
- Maria N. Ivanova, The Dollar as World Money, in: Science & Society 77 (2013), 1, S. 44–71.
- Bruno Bonizzi / Annina Kaltenbrunner / Jeffrey Powell, Subordinate Financialization in Emerging Capitalist Economies, in: Greenwich Papers in Political Economy 23044 (2019).
- Ilias Alami, Money Power of Capital and Production of ‘New State Spaces’: A View from the Global South, in: New Political Economy 23 (2018), 4, S. 512–529.
- Martin Höpner, The German Undervaluation Regime Under Bretton Woods. How Germany Became the Nightmare of the World Economy, MPIfG Discussion Paper 19 (2019), 1, 1–31.
- Kai Koddenbrock, Money and Moneyness: Thoughts on the Nature and Distributional Power of the ‘Backbone’ of Capitalist Political Economy, in: Journal of Cultural Economy 12 (2019), 2, S. 101–118.
- Benjamin Braun / Daniela Gabor, Central Banking, Shadow Banking, and Infrastructural Power, in: Philip Mader / Daniel Mertens / Natascha van der Zwan (Hg.), International Handbook of Financialization, London 2019.
- Aaron Sahr, Ungleichheit auf Knopfdruck, Hamburg 2017.
- Benjamin Braun, From Performativity to Political Economy. Index Investing, ETFs and Asset Manager Capitalism, in: New Political Economy 21 (2016), 3, S. 257–273; Jan Fichtner / Eelke Heemskerk / Javier Garcia-Bernardo, Hidden Power of the Big Three? Passive Index Funds, Re-Concentration of Corporate Ownership, and New Financial Risk, in: Business and Politics 19 (2017), 2, S. 298–326.
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Stephanie Kappacher.
Kategorien: Staat / Nation Politische Ökonomie Kapitalismus / Postkapitalismus Geld / Finanzen Internationale Politik
Zur PDF-Datei dieses Artikels im Social Science Open Access Repository (SSOAR) der GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gelangen Sie hier.
Empfehlungen
Enrichissez-vous!
Sandy Brian Hager über den Zusammenhang von Ungleichheit, Macht und öffentlicher Verschuldung
Die Häutungen des Leviathan
Rezension zu „The Project-State and Its Rivals. A New History of the Twentieth and Twenty-First Centuries“ von Charles S. Maier