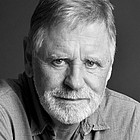Rainer Paris | Essay | 19.11.2025
Machtlaunen
Ein Versuch
Anders als andere mentale Tatbestände sind Launen kaum untersucht. Und das, obwohl jedermann weiß, wie bedeutsam und folgenreich sie in sozialen Beziehungen sein können. Wo Menschen von ihren Launen beherrscht sind und sie an anderen auslassen (oder auslassen können), verbreitet sich eine Atmosphäre der Ungewissheit und Unsicherheit, die alle zur Vorsicht gemahnt. Die Launen des einen sind die ängstliche Wachsamkeit und – unter Umständen! – das Schicksal der anderen.
Was sind Launen? Launen sind plötzlich auftretende persönliche Stimmungen, die häufig einem abrupten Wechsel unterliegen. Die Schwankungen erfolgen oft jäh und unmittelbar, wobei die Ursache der emotionalen Veränderung meist im Dunkeln liegt. Zwar ist mitunter ein Anlass erkennbar, der aber die Heftigkeit und das Andauern des Umschwungs nicht erklärt. Launen „überfallen“ uns. Sie können nicht gewollt und gezielt herbeigeführt werden, sondern stellen sich ein. Es sind seelische Ereignisse, Widerfahrnisse, also etwas, das uns zustößt und unserem bewussten Handeln weithin entzogen ist.
Stimmungen haben eine charakteristische phänomenale Struktur. Sie sind eigentümlich diffus und ubiquitär, ihnen liegt keine spezifische Intention zugrunde und sie sind nicht wie stärker konturierte Gefühle personal adressiert.[1] Sie haben eine gewisse Dauer und Intensität, die allerdings deutlich variieren kann. Dies gilt auch für unsere persönlichen Launen und Stimmungsschwankungen. Es sind Aufwallungen von Emotionen, die uns ergreifen und in gewisser Weise gefangen nehmen und zu denen wir uns erst dann, wenn sie sich langsam abschwächen, steuernd und reflektierend verhalten können. Die Ursache dafür liegt in der Leibgebundenheit der Gefühle, mit denen wir uns gleichsam „solidarisieren“, wenn wir von ihnen ergriffen werden.[2]
Inhaltlich sind Launen im Grunde wenig qualifiziert. Wir haben entweder „gute“ oder „schlechte“ Laune, wobei wir jedoch zumeist nur die schlechte Laune als solche registrieren. Es gibt keine „mittlere“ Laune. Tatsächlich nehmen wir im Normalfall nur die Ausschläge unserer Stimmungen wahr, als unerwartete Zäsur, die uns plötzlich überkommt und manchmal aus der Bahn wirft.
Launen und Launenhaftigkeit sind Eigenschaften von Individuen, nicht von Kollektiven. Hierin besteht der Unterschied von Launen und Stimmungen, der im Deutschen im Gegensatz zu anderen Sprachen freilich ein Stück weit eingeebnet ist.[3] Auch Gruppen, Organisationen oder ganze Gesellschaften haben Stimmungen oder Atmosphären, die ebenfalls gewissen Schwankungen und Veränderungen unterliegen. Dennoch sprechen wir hier eher von einem „Wandel“ und längerfristigen Umbrüchen; es fehlt also das Element des Zufällig-Plötzlichen und Kontingenten, das für den Begriff der Laune zentral ist.[4]
Sozial sind Launen und Launenhaftigkeit meist negativ konnotiert. Wer einfach nur seinen Launen nachgibt und folgt, schert sich, zumindest im Moment, nicht um Konventionen oder Regeln. Er stellt seine Befindlichkeit über alles. Die Unbesonnenheit des Affekts reißt ihn fort und verhindert jede reflektierende Abschätzung möglicher Handlungsfolgen. Launenhaftigkeit ist zunächst nichts anderes als Ausdruck einer rabiaten Egozentrik, der die Sichtweise und Gefühle anderer gleichgültig sind. Sie verabsolutiert den eigenen Gemütszustand und ist somit das Gegenteil von Takt und Empathie. Nicht zufällig diskutiert Helmuth Plessner die Bedeutung des Takts im Kontext der zivilisierenden Wirkung der Diplomatie: Er sei „die willige Geöffnetheit“ und Bereitschaft, „andere nach ihrem Maßstab und nicht dem eigenen zu messen“.[5]
Dem Launenhaften hingegen sind die eigenen Launen der Maßstab für alles. Er hat keinerlei Skrupel, andere damit zu behelligen und verlangt indirekt Anpassung und Unterwerfung. Er zwingt dem anderen seine Erwartungen auf, ohne auf dessen Erwartungen ihm gegenüber Rücksicht nehmen zu müssen.[6] Die Launen des einen erlebt der andere als Willkür und Zumutung. In dieser Konstellation funktioniert die Laune als eine eigenständige Machtquelle, die die Situation grundsätzlich neu definiert und den anderen vor die Wahl zwischen Willfährigkeit und Widerstand stellt.
Für sich genommen ist das in der Laune enthaltene Machtpotenzial allerdings nicht besonders groß. Seine Wirkung entfaltet sich erst im Zusammenhang mit anderen Merkmalen und Bedingungsfaktoren, insbesondere den strukturellen Vorgaben und Ressourcenasymmetrien der Machtposition. Es macht einen großen Unterschied, um wessen Launen es sich jeweils handelt, ob also das Aufzwingen der Befindlichkeit in der Machtrichtung von oben nach unten, von unten nach oben oder zwischen Gleichen erfolgt.
Gefürchtet sind vor allem die Launen der Machthaber. Die Shakespeare’schen Königsdramen sind voll davon. Weil er uneingeschränkt am längeren Hebel sitzt, kann sich der absolute Herrscher jede Gefühlsschwankung leisten und seine Launen rücksichtslos ausleben. Wo andere von seiner Gunst abhängig sind, vermag er sie mühelos gegeneinander auszuspielen.[7] Gerade die Unberechenbarkeit seiner Attitüden verschafft ihm einen zusätzlichen Machtvorsprung, indem sie die Relevanzen aller Beteiligten okkupiert und ihre Aufmerksamkeit bindet. Mehr noch: Da oftmals unklar ist, worin die Ursache seiner Launen liegt oder aus welchen Gründen ein Stimmungsumschwung erfolgt – handelt es sich um eine Frage des Charakters oder um ein strategisches Kalkül? –, in jedem Fall erzeugt sein Verhalten eine Verwirrung, was eine angemessene Antwort und eine rationale Risikoabschätzung nachhaltig erschwert.
Trotzdem hat die Machtquelle der Unberechenbarkeit auch ihre Grenzen. Mit wiederholtem Gebrauch schleift sie sich ab. Die anderen stellen sich darauf ein und lassen sich immer weniger überraschen. Auch der Unberechenbare wird irgendwann berechenbar. Zwar bleiben seine sonstigen Ressourcen und Machtmittel ebenso wie die Reichweite seiner Entscheidungen zunächst unangetastet; dennoch ist es den anderen jetzt in größerem Umfang möglich, bei der Wahrung ihrer Interessen besser und geschickter zu reagieren.
Kurzum: Wenn, wie im Falle launenhaft-erratischer Entscheidungen, sich der aktuelle Machtvorsprung vor allem der Kontrolle einer Ungewissheitszone[8] verdankt, so schmilzt dieser Vorteil mit jeder Wiederholung und dem erneuten Einsatz dieser Methode erheblich ab – was freilich am Folgenreichtum der bisherigen Entscheidungen und den bereits eingetretenen Wirkungen nichts ändert.
Auch Unterlegene und Machtschwächere können Launen haben. Trotzdem ist es für sie nicht opportun, den Mächtigen auf diese Weise zu reizen. Der Launenhaftigkeit von unten nach oben sind weithin die Hände gebunden. So ist es für Abhängige und Mindermächtige unbedingt nötig, ja oftmals geradezu überlebenswichtig, im unmittelbaren Kontakt mit dem Machthaber ihre Affekte unter Kontrolle zu halten. Niemand ist rachsüchtiger als der Herr, dem die Achtung verweigert wird. Allenfalls kann es unter Umständen sinnvoll sein, durch eine geeignete Mimik und Gestik dem anderen zu signalisieren, dass er, wenn er so weiter macht, demnächst mit innerer Reserve oder gar offenem Widerstand zu rechnen hat. Aber auch das birgt ein hohes Risiko, sodass es oftmals besser erscheint, auf indirekte oder schlitzohrige Methoden der Gegenwehr auszuweichen.[9]
Hinzu kommen die Effekte hierarchischer Machtstaffelung. Nicht selten geben gestresste Mittelmächtige, die unter den Launen der Machthaber leiden, diese einfach nach unten weiter und lassen sie an denjenigen aus, die von ihnen abhängig sind.
Doch nicht nur in einem Machtgefälle, auch unter positional Gleichen birgt die Egozentrik der Launen ein erhebliches Konfliktpotenzial. Sie verletzt die Grunderwartung der gegenseitigen Rücksichtnahme, die Basisnorm der Reziprozität.[10] Mit einem Schlag etabliert sie eine unübersehbare Asymmetrie der Beziehung und verwandelt aktuell Gleiche in Ungleiche. Wenn jemand in einer geselligen Runde seinen Affekten und Launen freien Lauf lässt, wird die Situation sofort angespannt und heikel. Die Launen des einen verderben allen anderen die Stimmung. Trotzdem ist der Normbruch oftmals schwer zu korrigieren: Da es bei einer Verletzung von Sittennormen häufig an einer autorisierten Sanktionsinstanz mangelt und niemand die Initiative ergreift, besteht die verbreitetste Reaktion in den meisten Fällen darin, den Normbruch „zu überspielen“, ihn also gewissermaßen in die Normalität einzugemeinden und die Dinge einfach weiterlaufen zu lassen. Man setzt auf Zeit und hofft darauf, dass der Störenfried seine Ausfälle nach und nach aufgibt und sie irgendwann beendet.
Launen und Übellaunigkeit ist nur schwer etwas entgegenzusetzen. Sie hängen oft mit dem Charakter einer Person zusammen und sind durch Appelle nur begrenzt zu beeinflussen. Grundsätzlich stehen dem Gegenüber drei Reaktionsalternativen offen: Er kann sich den Launen des anderen unterwerfen, sich dagegen zur Wehr setzen oder sie zunächst ignorieren und versuchen, einen neuen Pfad der Interaktion zu eröffnen.
Die erste und einfachste Möglichkeit sind Akzeptanz und Unterordnung. Um jeden Konflikt zu vermeiden, erträgt man die Launen des anderen und fügt sich seinem Willen. Man nimmt sie als gegeben hin und stellt die eigenen Interessen hintenan. Ob das Kalkül der Besänftigung aufgeht, steht allerdings auf einem anderen Blatt. So kann die Nichtreaktion und Willfährigkeit den anderen unter Umständen dazu ermuntern, sich in seiner Dreistigkeit bestätigt zu fühlen und in seinem Tun fortzufahren. Wenn die Unberechenbarkeit den gewünschten Erfolg hat und Früchte trägt – warum sollte man sie dann überdenken?
Die zweite Alternative ist der Versuch, den Launen Einhalt zu gebieten. Man empört sich gegen die Ungehörigkeit und zeigt offen seinen Unmut; die Relevanzen des Konflikts werden damit unübersehbar. Dies spielt den Ball zurück zum Urheber. Er ist nun mit der Situation konfrontiert, dass seine Launen Konsequenzen haben, die auch für ihn selbst möglicherweise mit empfindlichen Nachteilen verbunden sein können. Wenn er als Machthaber unangefochten ist, wird ihn dies vermutlich wenig beeindrucken; in einer unübersichtlichen und durch heterogene Interessen und Stärkeverhältnisse gekennzeichneten Figuration sieht das unter Umständen jedoch anders aus.
Trotzdem birgt dieses Vorgehen das Risiko, dass die Situation eskaliert. Die Launen des Unbeherrschten können jederzeit in unkontrollierte Wut umschlagen, wenn er auf Widerstand trifft. Der Affekt verdrängt jedes strategisch-rationale Kalkül, und der Streit mündet in einen erbitterten Machtkampf, in dem die Sache mehr und mehr verschwindet und es am Ende nur noch um die Frage geht, wer der Stärkere ist.
Bleiben als dritte Reaktionsmöglichkeit die gezielte, also vorgespiegelte Ignoranz und der Versuch einer Neuausrichtung der Interaktion. Hier geht es im Kern darum, die Verletzung der Sittennorm aus dem Fokus der Situation zu verbannen und die Launen als etwas anderes zu behandeln als das, was sie sind. Man trivialisiert sie als Fauxpas oder verzeihlichen Ausrutscher und gibt dem anderen damit Gelegenheit, sich zu besinnen und sein Verhalten stillschweigend zu korrigieren. Eine andere Methode ist, den anderen dadurch zu überraschen, dass man selber ein neues Thema einführt, das keinen Aufschub duldet und dessen Bearbeitung indirekt ein Neuaushandeln der Beziehung ermöglicht. Auch Launen können durchkreuzt werden. Wenn der Unberechenbare durch einen solchen Schachzug zur Seite plötzlich irritiert wird, kann es sein, dass er seine Launen gewissermaßen „vergisst“ und auf diese Weise selbst auf dem falschen Fuß erwischt wird.
All das steht freilich unter dem Vorbehalt, in welchem Maße es überhaupt möglich ist, die Situation zu remodulieren und das erratische Tun des anderen zu beeinflussen. Wo Launen und Launenhaftigkeit sich als dominanter Charakterzug darstellen, laufen alle Rationalitäts- und Verhandlungsappelle zunächst ins Leere. Andererseits gilt: Auch im Umgang mit Launen macht man Erfahrungen, aus denen man lernen kann. Sich seinen Launen zu überlassen und von ihnen beherrscht zu werden, ist das Gegenteil von reiflichem Überlegen und strategischem Entscheiden – mit dem Ergebnis, darüber zuweilen auch die eigenen Interessen aus dem Blick zu verlieren. Wenn der Launische wiederholt die Erfahrung macht, dass er durch das Ausleben seiner Launen über kurz oder lang ins Hintertreffen gerät und so seine Machtposition nachhaltig schwächt, ist die Aussicht auf Mäßigung vielleicht doch nicht ganz unbegründet.
Fußnoten
- Vgl. Thomas Fuchs, Zur Phänomenologie der Stimmungen, in: Friederike Reents / Burkhard Meyer-Sickendiek (Hg.), Stimmung und Methode, Tübingen 2013, S. 17–31, hier S. 23 ff. – Die schönste Analyse in diesem Themenfeld ist nach wie vor Otto Friedrich Bollnow, Das Wesen der Stimmungen [1941], 8. Aufl., Frankfurt am Main 1995; zur Abgrenzung von Launen und Stimmungen vgl. dort S. 57 f.
- Vgl. zu diesem Mechanismus Hermann Schmitz, Atmosphären, 3. Aufl., Freiburg/München 2020, S. 37.
- So unterscheiden zum Beispiel das Französische zwischen „humeur“ und „atmosphère“ und das Englische zwischen „mood“, „attunement“ und „atmosphere“; auch in anderen Sprachen gibt es diese semantische Differenzierung. Vgl. Heinz Bude, Das Gefühl der Welt. Über die Macht von Stimmungen, München 2016, S. 31 f.
- Das zeigt sich auch in der metaphorischen Verwendung des Begriffs, etwa wenn von „Launen“ oder gar von „Kapriolen“ des Wetters die Rede ist.
- Helmuth Plessner, Grenzen der Gemeinschaft. Eine Kritik des sozialen Radikalismus [1924], in: ders., Gesammelte Schriften, Bd. V: Macht und menschliche Natur, Frankfurt am Main 1981, S. 7–133, hier S. 107.
- Dies ist bekanntlich die klassische Definition der Machtrolle. Vgl. Dieter Claessens, Rolle und Macht, München 1968.
- Vgl. Norbert Elias, Die höfische Gesellschaft. Untersuchungen zur Soziologie des Königtums und der höfischen Aristokratie, Frankfurt am Main 1983, bes. S. 120 ff.
- Zur organisationssoziologischen Bestimmung von Macht als Kontrolle einer Ungewissheitszone, von der andere abhängig sind vgl. Erhard Friedberg, Ordnung und Macht. Dynamiken organisierten Handelns, übers. von Gisela Voß, Frankfurt am Main / New York 1995, S. 255 ff.
- Ein bekanntes Beispiel ist die literarische Figur des braven Soldaten Schwejk.
- Vgl. Alvin W. Gouldner, Die Norm der Reziprozität, in: ders., Reziprozität und Autonomie. Ausgewählte Aufsätze, übers. von Elmar Weingarten und Horst Ebbinghaus, Frankfurt am Main 1984, S. 79–117, hier S. 97 ff.
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Karsten Malowitz.
Kategorien: Affekte / Emotionen Anthropologie / Ethnologie Gesellschaft Interaktion Kommunikation Macht Normen / Regeln / Konventionen
Empfehlungen
Negativer Anarchismus
Rezension zu „Unherrschaft und Gegenherrschaft“ von Florian Mühlfried
Der Mensch erscheint am Ende der Vorschulzeit
Rezension zu „Mensch werden. Eine Theorie der Ontogenese“ von Michael Tomasello
Gesellschaft ohne Gesicht
Rezension zu „La fin de la conversation? La parole dans une société spectrale“ von David Le Breton