Sebastian J. Moser | Rezension | 10.12.2024
Gesellschaft ohne Gesicht
Rezension zu „La fin de la conversation? La parole dans une société spectrale“ von David Le Breton
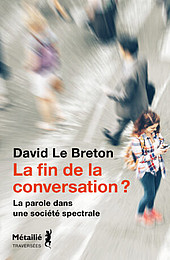
Welche sozialen Prozesse zeichnen dafür verantwortlich, dass Wissenschaftler:innen, die in ihren Heimatländern nicht nur erfolgreich sind, sondern fast schon den Status von Stars besitzen, in anderen Ländern weitgehend unbekannt bleiben? Wie genau lässt sich erklären, dass die Arbeiten deutscher Soziologen wie Ulrich Beck, Hartmut Rosa oder Andreas Reckwitz international breit rezipiert werden, während dies für die Schriften von Kolleg:innen wie Heinz Bude oder Jutta Allmendinger nicht zutrifft? Welche Rolle spielen die jeweiligen Forschungsfelder, die internationalen Vernetzungen, das Engagement der Verlage oder die Sprachkenntnisse der jeweiligen Autor:innen?
Der in Straßburg lehrende Soziologe David Le Breton, dessen Essay La fin de la conversation? La parole dans une société spectrale im Folgenden besprochen werden soll, wäre sicherlich ein interessanter Fall, um diesen Fragen nachzugehen. In Frankreich ist die Erwähnung seiner Arbeiten in körper- oder emotionssoziologischen Debatten ebenso unverzichtbar wie in Auseinandersetzungen mit dem Risikoverhalten junger Menschen. Le Breton bearbeitet diese Forschungsfelder mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen bereits seit den 1990er-Jahren. Er veröffentlichte Studien zu Tätowierungen und Piercings oder selbstverletztendem Verhalten als Ausdruck der Identität, verfasste Bücher zu Extremsport als Suche nach dem Kick oder zum Wandern als Suche nach Stille und schrieb Texte über die Stimme oder das Lächeln.[1] Theoretisch ist er unter anderem dem Symbolischen Interaktionismus verpflichtet[2] und einige seiner Arbeiten können durchaus als Exemplifizierungen von Simmels Konzept einer Soziologie der Sinne angesehen werden. In deutschsprachigen Handbüchern zur Körper- oder Emotionssoziologie sucht man seinen Namen hingegen vergebens.[3] Anders als der französische Familiensoziologe Jean-Claude Kaufmann, dessen Œuvre fast vollständig übersetzt wurde, liegen von Le Breton bislang lediglich drei seiner über 30 Bücher in deutscher Sprache vor. Wie unglaublich produktiv dieser Autor ist, zeigt sich nicht zuletzt daran, dass während der Abfassung des vorliegenden Textes bereits eine neue körpersoziologische Studie über Narben von ihm erschienen ist.[4]
Ein immer wiederkehrendes Bild im hier zu rezensierenden Buch über den Einfluss des Smartphones auf das soziale Miteinander ist der nach unten geneigte Kopf mit dem abgewandten Gesicht, das für die anderen unzugänglich wird, weil es dem Bildschirm zugewandt ist. Nun muss man kein ausgebildeter Soziologe sein, um dieses anschauliche Bild mit den eigenen Alltagserfahrungen abgleichen zu können. Ob im Restaurant oder in der Straßenbahn, im Hörsaal oder auf den Gehwegen der Städte: die Gesichter der Mitmenschen machen sich rar, weil sie von den (nicht einmal mehr flimmernden) Bildschirmen der Smartphones absorbiert werden. Jede noch so kurze Wartezeit – an der roten Ampel oder an der Supermarktkasse, auf dem Bahnsteig oder vor dem Kindergarten – wird unmittelbar vom Zücken der technischen Geräte und dem Hineingezogenwerden in die virtuelle Welt jenseits des Hier und Jetzt begleitet. Die Einzelnen werden blind für das, was in ihrer Umgebung geschieht, und im Alltag mehren sich Verhaltensweisen, die noch vor einigen Jahren als grob unhöflich gegolten hätten: die abrupte Abwendung vom Gesprächspartner, weil das Smartphone vibriert; das laute Besprechen von Intimitäten und Banalitäten in öffentlichen Verkehrsmitteln, Bibliotheken oder Wartezimmern. Gerade das Verschwinden der Gesichter markiert für Le Breton nicht weniger als einen „tiefgreifenden anthropologischen Umbruch, die Entstehung einer neuen Welt des Sprechens und der Beziehung zu anderen“ (S. 18; meine Übersetzung).
Um diesen Bruch begrifflich fassen zu können, stützt sich Le Breton auf die idealtypische Unterscheidung zwischen Konversation und Kommunikation.[5] Während letztere als ein nutzenorientierter, effizient-dringlicher Informationsaustausch unter der Bedingung körperlicher Abwesenheit bestimmt wird, findet die Konversation in körperlicher Anwesenheit und somit Auge in Auge mit dem jeweiligen Gegenüber statt. Gerade das Gesicht spielt bei dieser Unterscheidung eine zentrale Rolle: In der Konversation ist der Blick des Gesprächspartners auf uns gerichtet und verdeutlicht, dass sie oder er „bei der Sache“ ist. Die gegenseitige Beobachtung in der Konversation führt zur kontinuierlichen Ausrichtung und Anpassung unserer Äußerungen und Haltungen an diejenigen unseres Gegenübers, je nachdem, was uns dessen Mimik, Gesten oder Stimme wahrnehmen lassen. Das Gesicht ist kein Körperteil wie jedes andere – für Le Breton verkörpert es die Moral innerhalb der Interaktion. Zum einen bringt es die jeweilige Identität des Sprechenden und des Zuhörenden zum Ausdruck, für die sich beide Seiten Anerkennung erhoffen, zum anderen muss jede und jeder bereit sein, für die eigenen Gesichtszüge einzustehen und Verantwortung für das persönliche Mienenspiel und die damit vermittelten Botschaften zu übernehmen.
Zur Konversation gehört für Le Breton ebenfalls die Fähigkeit, Phasen der Stille auszuhalten und gemeinsam zu schweigen. Zum einen zeigen wir dem Gegenüber damit, dass wir ihm aufmerksam zuhören, zum anderen kann ein gemeinsames Innehalten-im-Sprachfluss, das Nachsinnen und Wirkenlassen des zuvor Gesagten, bedeutungsvoll und beziehungsstiftend sein. In der digitalisierten Sozialität, die sich am Idealtypus der Kommunikation ausrichtet, verliere die Stille diese Funktion. Länger andauerndes Schweigen oder eine ausbleibende Antwort würden lediglich als Ausdruck einer (technischen) Panne oder einer unterbrochenen Verbindung gedeutet (S. 40). Überhaupt gefährde die Allgegenwart der Smartphones nicht nur die Fähigkeit, in Stille vereint oder allein zu sein, sondern verstärke die ohnehin im öffentlichen Raum vorherrschende Kakophonie: das Telefonieren oder Musikhören mit angeschaltetem Lautsprecher, das Diktieren von Sprachnachrichten, die pfeifenden und gläsern klirrenden Signaltöne von Messengerdiensten, die aus dem schlecht justierten Kopfhörer heraussuppende Musik oder das nur scheinbare Selbstgespräch auf der Straße gehören mittlerweile zu unserem Alltag.[6]
Obgleich die idealtypische Unterscheidung von Kommunikation und Konversation den gesamten Text durchzieht, widmet sich David Le Breton in der zweiten Hälfte des Buches vorrangig allgemeineren Phänomenen der Digitalisierung, darunter auch den Auswirkungen auf die sogenannten Digital Natives.[7] Von einem Anstieg depressiver Syndrome und zunehmender Gleichgültigkeit gegenüber anderen ist die Rede (S. 44 f.); vom Zappen und Surfen als den essenziellen Beziehungsformen, die jedes dauerhafte Engagement verunmöglichen (S. 58); sowie von Eltern, die ihre Kinder nicht mehr anschauen, weil sie von den schimmernden Bildschirmen ihrer Telefone vereinnahmt werden (S. 60):
„Wenn der Vater oder die Mutter oft online sind, sendet dies das Signal, dass man sich nicht zu sehr auf andere verlassen sollte, auch nicht auf die engsten Vertrauten. Das Kind lernt dadurch, dass es legitim ist, seine Gesprächspartner zu vernachlässigen, weil das Wichtige woanders passiert“ (S. 62; meine Übersetzung).
Das Internet und die sozialen Netzwerke böten vor allem jungen Menschen die Chance, sich unterschiedliche Identitäten zuzulegen und mit diesen zu spielen. Gleichzeitig aber sei diese „Maskenwelt“ (S. 71) eine Möglichkeit, sich den Zwängen und der Verantwortung zu entziehen, die mit der Affirmation der eigenen Identität in der Konversation einhergingen; in der Kommunikation brauche man sich den Blicken der anderen nicht auszusetzten, man entziehe sich gewissermaßen ihrem Urteil. Für Le Breton ist es deshalb nicht verwunderlich, dass Mobbing, Bashing und emotional gefärbte Abrechnungen im virtuellen Raum viel stärker um sich greifen als im öffentlichen Raum, blieben doch die verschreckten Gesichter der Opfer, welche die Täter:innen andernfalls beschämen könnten, hier für alle unsichtbar. Der eigene Standpunkt, der zudem durch algorithmisch angebotenen, passgenauen Content bestärkt wird, werde ohne die Auseinandersetzung mit einem lebendigen Gegenüber zunehmend immun gegen Kritik. Der massive Gebrauch des Smartphones und die immer längere Verweildauer im Cyberspace ließen eine neue Form der Sesshaftigkeit, ja eine „sitzende Menschheit“ (S. 90) entstehen, die sich nicht nur durch körperliche, sondern auch geistige Unbeweglichkeit auszeichne: „Bewegungslosigkeit bringt die Ideen nicht in Gang, eignet sich kaum zur Selbsterneuerung und begünstigt Passivität“ (S. 91).
Das letzte Kapitel ist insofern aufschlussreich, als es die Leser:innen über den Status des Textes innerhalb von David Le Bretons umfangreichem Werk aufzuklären scheint. Während zahlreiche seiner Bücher mit einem „Ouverture“ (Eröffnung) überschriebenen Schlusskapitel enden, betitelt der Autor das Schlusskapitel von La fin de la conversation? mit „Ouverture critique“. Die Abweichung scheint mit Bedacht gewählt, denn das vorliegende Buch basiert weder auf der Auswertung von empirischem Material, wie etwa Lust am Risiko (1995) oder Signes d’identité (2002), noch stellt es eine umfangreiche Literaturstudie dar, wie Le Breton sie zu den Themen Emotionen und Schmerz vorgelegt hat. Stattdessen handelt es sich um eine Art kritische Zeitdiagnose, die „aus einem Gefühl der Dringlichkeit heraus geschrieben [wurde], weil ich mich immer mehr einer Welt entrissen fühle, die ich zwar verstehe, aber die ich nur schwerlich wiedererkenne“.[8] Sicherlich gehört La fin de la conversation? nicht zu den originellsten Texten von David Le Breton. Jedoch handelt es sich – nicht zuletzt aufgrund der Reichweite des Verfassers – um ein gelungenes Stück öffentlicher Soziologie, das nicht nur lernende Maschinen oder Künstliche Intelligenz als Gefahren der Digitalisierung ausmacht, sondern auch (und vor allem) die als legitim empfundene Abwendung von unseren Mitmenschen.
Fußnoten
- David Le Breton, Signes d’identité. Tatouages, piercings et autres marques corporelles, Paris 2002; ders., La peau et la trace: sur les blessures de soi, Paris 2003; Passions du risque, Paris 1991 [dt.: Lust am Risiko. Von Bungee-jumping, U-Bahn-surfen und anderen Arten, das Schicksal herauszufordern, übers. von Robert Detobel, Frankfurt am Main 1995]; ders., Éloge de la marche, Paris 2000 [dt.: Lob des Gehens, übers. von Milena Adam, Berlin 2015]; ders., Éclats de voix: une anthropologie de voix, Paris 2011; ders., Sourire: anthropologie de l'énigmatique, Paris 2022.
- David Le Breton, L’interactionnisme symbolique, Paris 2004.
- In den Schlüsselwerken der Emotionssoziologie werden beispielsweise mit Autoren wie Gustave Le Bon, Émile Durkheim, Marcel Mauss und Jean-Paul Sartre die üblichen Verdächtigen aufgeführt. So wird der Eindruck vermittelt, als hätte die französische Soziologie nach dem Zweiten Weltkrieg nichts Nennenswertes mehr zum Thema beigetragen. Neben Jean Baudrillards Von der Verführung oder Luc Boltanskis L’amour et la justice comme compétence könnten ebenso Arbeiten des Systemtheoretikers Michel Crozier („Sentiments, organisations et systèmes“) oder des Alltagssoziologen Pierre Sansot (Les formes sensibles de la vie sociale) genannt werden.
- David Le Breton, Cicatrices: l’existence dans la peau, Paris 2024.
- Le Breton verwendet die Begriffe Konversation, Dialog und Diskussion synonym.
- Die Berücksichtigung von Arbeiten aus dem Bereich der Sensory Ethnography hätte hier sicherlich wichtige Erkenntnisse beisteuern können.
- Diese inhaltliche Verschiebung dürfte wohl seiner Expertise auf dem Gebiet der Jugendsoziologie geschuldet sein. Auch sonst verweist Le Breton im Text immer wieder auf seine eigenen Studien, etwa zur Stille, zum Gesicht oder zur Stimme.
- David Le Breton in einem Interview für Radio France Culture vom 07.07.2024; online unter: https://www.youtube.com/watch?v=P7elQxKYjy0 (meine Übersetzung).
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Karsten Malowitz.
Kategorien: Affekte / Emotionen Anthropologie / Ethnologie Digitalisierung Gesellschaft Interaktion Kommunikation Kultur Lebensformen Medien
Empfehlungen
On the Ground and in the Feeds in Harlem
Rezension zu „The Digital Street“ von Jeffrey Lane
Mittendrin statt nur dabei
Zur raum-zeitlichen Ordnung von Fußballspielen
