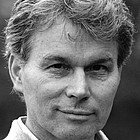Günter Burkart | Rezension | 02.02.2023
Man muss sich ja nicht binden
Rezension zu „Die neue Ordnung der Liebe. Liebesformen unter den Bedingungen von Kompetenzkultur und Konkurrenzgesellschaft“ von Thies Hansen

Wenn ein Autor sein Werk „Die neue Ordnung der Liebe“ betitelt, wecken er und sein Verlag hohe Erwartungen und machen neugierig, aber auch ein wenig skeptisch. Kann uns hier etwa jemand sagen, wie sich die großen gesellschaftlichen Transformationen der letzten Jahrzehnte (Individualisierung, Erosion der Geschlechter- und Familienverhältnisse, Neoliberalismus, Globalisierung, Digitalisierung, Mediatisierung) auf unsere Liebesverhältnisse ausgewirkt haben? Ist es noch immer romantische Liebe, die unser Liebesleben beherrscht – oder etwas Neues, das man benennen kann? Diese Fragen sind schwierig und, trotz vieler Anstrengungen der Soziologie um Klärung, weiterhin umstritten.
Der Untertitel des Buches macht einschränkend deutlich, dass es vor allem darum gehen soll, wie Liebende mit wachsender Kontingenz und Konkurrenz umgehen. Wird die Partnersuche anstrengender und nerviger, wenn es mehr Konkurrenz gibt? Werden Beziehungen immer unverbindlicher, wenn das Kontingenzbewusstsein weiter zunimmt, wenn also jede Partner-Person, die ich finde, glaubt, dass an ihrer Stelle genauso gut eine andere stehen könnte – und das auch über mich denkt? Der Kerngedanke des Kontingenzprinzips ist ja, dass die Welt, auch die Welt der Liebe, nicht zwingend so ist, wie sie ist. Alles könnte auch ganz anders sein, wir könnten andere Menschen lieben – und nebenbei schon wieder nach neuen Möglichkeiten Ausschau halten.
Damit ist in etwa der Problemhorizont des Buches umrissen. Die Arbeit, hervorgegangen aus einer Dissertation, ist theoretisch angelegt, allerdings finden wir keine systematische Diskussion anderer Theorien oder der Forschungen zu den verschiedenen Themenfeldern, der Autor versucht vielmehr, eine eigene Theorie der Liebesformen zu formulieren. Sie wird im dritten Kapitel skizziert, vorbereitet durch zwei Kapitel, in denen Begriffe und Thesen eingeführt werden. Das Leit- und Basistheorem der Untersuchung lautet, dass sich in der Gegenwartsgesellschaft eine neue Liebesordnung etabliert hat, mit neuen Formen des Liebens, die jeweils auf unterschiedliche Weise Kontingenz und Konkurrenz verarbeiten.
Das vierte Kapitel, das fast die Hälfte des Umfangs des Buches ausmacht, präsentiert in lockerer Folge ungefähr zwanzig Phänomene, die zum Teil als Alternativen zur klassischen monogamen Beziehung oder auch als Beziehungsgeneratoren (z.B. Tinder) gelten können. Thies Hansen präsentiert hier ein Potpourri, eine kunterbunte Sammlung von Artefakten (z.B. Liebesschlösser an Brücken) und Texten, in denen mehr oder weniger verbreitete Liebesformen oder Sexpraktiken oder deren Negation (z.B. Incels) dargestellt sind. Manche sind relativ neu, manche sind schon älter. Die empirische Grundlage für die entsprechenden Beschreibungen ist meist sehr dünn, manchmal ist es nur ein Popsongtext, manchmal nur der Erfahrungsbericht einer Person.
Diesem langen Material-Kapitel folgen noch zwei abschließende Theorie-Kapitel, in denen einige dieser Phänomene auf die Fragestellung rückbezogen werden. Das fünfte Kapitel versucht, die neue Ordnung der Liebe in einer Typologie von Liebesformen zu erfassen. Der erste Typus nutzt Kontingenz und fördert das Streben nach Liebesabenteuern (Affäre). Der zweite versucht, Kontingenz zu begrenzen, indem eine verbindliche, feste Beziehung (Ehe) angestrebt wird. Der dritte Typus setzt ganz auf Unbestimmtheit und Kommunikation und das Management von Kontingenz (offene Beziehung, Polyamorie). Im sechsten Kapitel werden grundlegende Begriffe wie Autonomie, Konkurrenz oder Kommunikation diskutiert, was für die Fragestellung des Buches aber nicht mehr viel hergibt. Ein Epilog befasst sich mit dem Begriff der Freiheit – und das Buch endet etwas überraschend mit einem moralphilosophischen Bekenntnis zur Treue: „Treue bedeutet keine Einschränkung der Freiheit, sondern Freiheit zu schenken“ (S. 278).
Das Buch von Thies Hansen bietet eine Fülle von interessanten Gedanken, der Autor kennt sich in dem Feld gut aus, er kennt philosophische und soziologische Literatur, er kann gut schreiben, unter Verwendung vieler Metaphern (die allerdings nicht immer treffen). Seine Materialsammlung im vierten Kapitel ist ein reichhaltiger Fundus für weitere Analysen, seine Ausführungen zur Kontingenz-These sind nachvollziehbar. Aber es gibt auch erhebliche Schwächen. Ein Problem sehe ich darin, dass es der Argumentation an vielen Stellen an Stringenz und Klarheit mangelt, weil oft Sätze aneinandergereiht werden, die fragwürdige Setzungen, Spekulationen und unbegründete Behauptungen enthalten. Vieles ist programmatisch, es gibt Widersprüche (was man auch nicht mit dem Hinweis auf „Dialektik“ negieren kann). Manche Thesen sind so abstrakt, dass sie fast inhaltsleer sind (nach dem Muster: Die Liebesform bringt die Erfahrung des Liebens in eine Form). Eine Fülle von nur abstrakt oder gar nicht definierten Begriffen (Form, Organisation, Institution, polyzentrisches System, gewachsene und gemachte Ordnung) erzeugt Unübersichtlichkeit und das Gefühl unbewältigender Komplexität – und, natürlich auch, ein gewisses Gefühl der Kontingenz: Was der Autor sagt und als theoretische Wahrheit verkündet, ist nicht immer zwingend, es könnte alles auch ganz anders sein.
Ein weiteres Problem ist die Reichweite der Thesen. Es geht vor allem um junge Erwachsene, deutsch oder nordamerikanisch, urban, heterosexuell, kinderlos (S. 13). Insbesondere die beiden letzten Punkte sind fragwürdig. Zumindest die Potenzialität von Kindern müsste thematisiert werden, wenn es um eine neue Liebesordnung geht. schließlich wurde mit der romantischen Liebe ja erstmals in der Menschheitsgeschichte die Eheschließung aus Liebe und die daraus hervorgehende Familiengründung propagiert und realisiert. Ist das jetzt over oder nicht? Und kann man ernsthaft von einer neuen Ordnung der Liebe sprechen, wenn man von vornherein schwule, lesbische und andere queere Formen ausschließt? Man ignoriert damit, wie radikal sich die Vorstellung von Normalität (darauf zielt ja der Ordnungsbegriff) durch die erstaunliche Aufwertung schwul-lesbischer Beziehungen in den letzten Jahrzehnten gewandelt hat, und wie dabei ein neuer Beziehungstypus entstanden ist (Giddens‘ pure relationship), bei dem die Dominanz der Geschlechterasymmetrie und der Heterosexualität aufgebrochen ist.
Was ist das „Neue“ an der neuen Ordnung und wo ist ihre Entstehung historisch einzuordnen? Der Autor nennt dazu zwei Eckpunkte: den Siegeszug der romantischen Liebe seit 1800 und die Umwälzungen der 1960er-Jahre (S. 28). Die neue Ordnung ist also gar nicht so neu, sie ist, wie ja auch die Kontingenz im Allgemeinen, eine Entwicklung zur beziehungsweise in der Moderne. Ich fand es sehr überraschend, dass hier weder die Digitalisierung noch die globale Mediatisierung, aber auch nicht der 1968-Komplex oder der Neoliberalismus als entscheidend für das Neue stehen, sondern der Aufstieg der romantischen Liebe, mit der die Menschen genötigt wurden, sich ihren Heiratspartner selbst zu suchen und sich der Tiefe und Echtheit ihrer Liebesgefühle zu vergewissern. „1968“ und die Digitalisierung wären dann nur weitere Stufen der Steigerung von Kontingenz. Der Neoliberalismus fehlt in Hansens Argumentation vollständig, dabei hat diese Strömung seit den 1990er-Jahren wesentlich zur Rehabilitierung von Markt- und Konkurrenzdenken bis weit ins linke politische Lager und den Feminismus beigetragen.
Das Basistheorem lautet also, dass Liebesformen sich danach unterscheiden, wie sie mit der Kontingenz umgehen – und mit Konkurrenz, die als sozialer Umsetzungsprozess von Kontingenz verstanden wird, genauer gesagt als Mechanismus der Kontingenznutzung. Bei anderen Logiken der sozialen Verarbeitung von Kontingenz geht es eher um Kontingenzbegrenzung. Das ist allerdings eine abstrakte Unterscheidung, in die das empirische Material häufig hineingezwängt wird, ohne dass sich eine anschauliche Vorstellung des Kontingenzmanagements entwickelt.
Zwei Formen von Konkurrenz werden unterschieden: Wettbewerb zwischen den Personen um Liebeschancen und Wettbewerb der Liebesformen, zum Beispiel zwischen Ehe und Polyamorie. Im ersten Fall kommt es für die Menschen darauf an, ihre Chancen zu verbessern, indem sie sich bemühen, ihre eigene Attraktivität zu optimieren. Aber geht es bei der Liebe überhaupt um Konkurrenz? Gut, wir konkurrieren manchmal mit attraktiven „Rivalen“ oder raffinierten Verführerinnen um die Gunst schöner Frauen oder attraktiver Männer; und wir müssen manchmal leider zur Kenntnis nehmen, dass unser Partner fremdgeht. Aber im Unterschied zum Wettbewerb um die besten Plätze im Bildungssystem und hochrangige Positionen in der Arbeitswelt geht es bei der Liebe nicht darum, für einen erotischen Spitzenplatz ausgewählt zu werden oder die attraktivste Person für sich zu gewinnen. Tinder suggeriert vielleicht, dass es hier um einen Wettbewerb ginge. Aber Hansen zeigt selbst, dass das eine Täuschung ist. Er kommt sogar zu dem Ergebnis, die Liebesbeziehung sei in gewisser Weise von der gesellschaftlichen Konkurrenz ausgenommen (S. 158 ff.). Damit widerspricht er allerdings vehement seiner Grundthese, in der doch die Konkurrenz für die neue Liebesordnung so wesentlich ist.
Mit ihrer simplen, aber dramatischen Wegwischtechnik – die Allmachtsphantasien beflügelt – hat die Online-Dating-App Tinder von Anfang an große Aufmerksamkeit und eine Reihe von mythologisch inspirierten Interpretationen auf sich gezogen. Auch Thies Hansen spart nicht mit Superlativen: Tinder stelle „gleichsam die Heisenbergsche Unschärferelation des Datings“ dar (weil man mit jemandem zusammen sein kann und gleichzeitig über Tinder mit einem anderen verbunden); sie sei die „größte Wunsch- und Begehrensmaschine“, die jemals auf dem Gebiet der Liebe geschaffen worden sei, sie schraube die Kontingenz in schwindelnde Höhen, sozusagen in die Unendlichkeit. Schließlich zitiert er eine Erfolgsmeldung des Unternehmens und fügt hinzu: „Die Anzahl der Matches ist ein Vielfaches der Weltbevölkerung“ (S. 73). Über den Sinn dieses Vergleichs habe ich lange gerätselt, vielleicht geht es um die Suggestion, dass mittels dieser App sozusagen die ganze Weltbevölkerung zu potenziellen Liebespartnern werden könnte. Tatsächlich evozieren solche Plattformen eine Fiktion der unbegrenzten Möglichkeiten und einer rationalen Optimierung der Partnersuche, während man früher gar nicht an Auswahl dachte, sondern nur abwartete, bis man eine Person traf, die einem gefiel. Oder die Frau hat sich schicksalhaft ergeben und denjenigen genommen, der als erster ein Liebesbekenntnis abgab und einen Heiratsantrag machte, so wie Stoner in dem gleichnamigen Roman von John Williams. Stoners Auserwählte, Edith, hatte bis dahin noch keinen Verehrer und wohl noch nie einen Mann geküsst. Demgegenüber ist es heute für Jugendliche normal, vorehelichen Sex zu haben, mit wechselnden Partnern und großer Kunstfertigkeit. Es ist normal, dass junge Frauen die Initiative ergreifen, um sexuellen Spaß zu haben. Und es ist (fast) normal, dass schwule und lesbische Menschen ihr Anderssein offen zeigen. Das sind wahrhaft revolutionäre Veränderungen. Im Vergleich dazu ist die Erfindung einer Illusionsmaschine, die einem weismachen will, man könne sich das beste Match aus allen möglichen aussuchen, zweitrangig und für die Frage der Ordnung der Liebe weitgehend irrelevant. Den Online-Partnerbörsen ist es allerdings gelungen, die Faszination und Ästhetik der digitalen Welt auf die früher etwas schmuddelige Welt der vermittelten Partnersuche zu übertragen und damit das dort vorhandene Schampotenzial weitgehend zu entschärfen. Hansen stellt kritisch fest, dass Tindern vor allem ein Spiel sei, das natürlich nicht über die Liebe entscheide. Tinder sei eher eine Illusionsmaschine – um dann doch wieder zu sagen, im krassen Widerspruch dazu: „Tinder selbst lässt sich als Liebesmaschine verstehen, die eine eigene Liebesform stiftet“ (S. 86). Ich würde jede Wette eingehen, dass es nicht viele Paare gibt, die sich und ihre Liebe ernsthaft darüber definieren, sich beim Tindern kennengelernt zu haben.
Thies Hansens Modell einer neuen Liebesordnung ist ganz auf den Mechanismus der Kontingenzverarbeitung durch Wettbewerb konzentriert. Als solches ist es ein interessanter Ansatz, der aber – abgesehen von einigen Widersprüchen – doch sehr eng gefasst ist. Es gibt eine Reihe von Problemfeldern, die für die Diagnose einer neuen Ordnung der Liebe eigentlich unverzichtbar sind (auch wenn eine gute Theorie nicht unbedingt alles erfassen muss). Dazu gehören insbesondere das Verhältnis der Geschlechter, die Frage der Heteronormativität und die Sexualität als Bestandteil der Liebe. Die Veränderungen auf diesen Feldern seit den 1950er-Jahren sind gravierend. Implizit geht Hansen auf einige Aspekte der Krise der Heteronormativität ein, aber eben nicht auf den Aufstieg homosexueller Liebe. Die Sexualität thematisiert er vor allem über spezielle Formen (Pornographie und BDSM), untersucht aber nicht systematisch die immer enger gewordene Verbindung von Sexualität mit Liebe.
In diesem Zusammenhang ist es auch ein Problem, dass der Autor die Dimension der Leiblichkeit (die er als eine von drei zentralen Dimensionen – neben Innenwelt und Mitwelt – seines Modells der Liebesformen hervorhebt) aus dem Kompetenzbereich der Soziologie ausklammert. Seiner Ansicht nach kann eine Soziologie der Liebe nur die kulturellen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, Entstehungsgründe und Folgen der Liebe untersuchen, aber nicht die Liebe selbst, schon gar nicht die Leiblichkeit, die „ein dunkler Abgrund bleiben“ müsse (S. 59). Ich meine dagegen, dass ohne Leiblichkeit ein Verständnis der gegenwärtigen Ordnung der Liebe kaum möglich ist, vor allem, weil die Sexualität heute eine viel größere Rolle spielt. Der Hauptunterschied zwischen den Liebenden des 19. und des 21. Jahrhunderts (zumindest im westlichen Bürgertum) besteht nicht in verschärfter Konkurrenz der Liebesformen oder gesteigerter Kontingenz, sondern darin, dass die Männer damals erst eine declaration of love und einen Heiratsantrag machen mussten, bevor sie auch nur daran denken durften, ihre fleischlichen Begierden zu verfolgen, wohingegen man sich heutzutage bereits im Jugendalter mit „You Tube Tutorials für Blowjob-Techniken“ (S. 108) auf den Liebeskampf vorbereiten kann. Die Liebe beginnt, anders als Hansen meint (bei ihm nimmt sie ihren Ausgang im Empfinden des Individuums), oft mit einer sexuellen Begegnung, und das wechselseitige Empfinden dieser intimen Kommunikation am „morgen danach“ entscheidet darüber, ob es Liebe wird. Liebe ist eine leibzentrierte Praxis, eine höchstpersönliche soziale Beziehung, für deren Gelingen Küsse und Berührungen und andere leibliche Praktiken genauso wichtig sind wie der liebevolle Wortwechsel.
Trotz der kritischen Anmerkungen lässt sich am Ende festhalten, dass Thies Hansen zum breiten Liebesdiskurs einige wichtige Einsichten in Bezug auf Kontingenz und Konkurrenz beigesteuert hat, und seine gesammelten Phänomene lassen vielleicht auch noch andere interessante Deutungsmöglichkeiten zu. Wenn auch keine fertige Theorie der neuen Liebesordnung, so hat er doch einen nicht unerheblichen Beitrag dazu geliefert.
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Hannah Schmidt-Ott.
Kategorien: Affekte / Emotionen Körper Technik Zeit / Zukunft
Zur PDF-Datei dieses Artikels im Social Science Open Access Repository (SSOAR) der GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gelangen Sie hier.
Empfehlungen
„Kulturpoetik“ oder Phänomenologie?
Rezension zu „Augenmaß. Zur Ästhetik politischer Entscheidung“ von Christian Metz
Liebe jenseits des Marktes
Rezension zu „Die Liebe der Gesellschaft. Soziologie der Liebe als Beobachtung von Unwägbarkeit“ von Udo Thiedeke
Sociological Perspectives on Emotional Reflexivity
Tagung am Hamburger Institut für Sozialforschung, 30. September bis 2. Oktober 2015