Hartmut Kaelble | Rezension | 15.06.2023
Prekäre Errungenschaften
Rezension zu „Eine kurze Geschichte der Gleichheit“ von Thomas Piketty
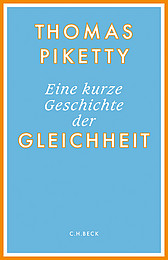
Thomas Piketty ist nicht nur der erfolgreichste, wirtschaftshistorische Buchautor der jüngsten Zeit, er hat auch die Forschung zur Geschichte der sozialen Ungleichheit nachhaltig geprägt. In dem hier zu besprechenden kurzen Band versucht er, hunderte von Seiten seiner bisherigen Publikationen auf nur 264 zusammenzufassen. Das Buch ist allerdings deutlich mehr als das Kondensat von Pikettys Arbeiten für Leser:innen mit wenig Zeit. Es präsentiert auch einen etwas anderen Thomas Piketty, was die drei neuen oder erneuerten Ansätze deutlich machen, die das Buch enthält.
Erstens möchte Piketty nicht mehr über Ungleichheit, sondern über Gleichheit schreiben. Das kommt schon im Titel des Buches zum Ausdruck. Vor allem im 20. Jahrhundert, so die These des Autors, habe Gleichheit in der Weltgeschichte – sowohl innerhalb der einzelnen nationalen Gesellschaften als auch zwischen den Ländern der Welt (S. 12 f.) – zugenommen. Es geht ihm also nicht darum, eine (weitere) düstere Geschichte von immer mehr Ungleichheit zu erzählen, sondern sichtbar zu machen, in welchem Umfang Ungleichheit abgemildert werden konnte. Gleichzeitig betont Piketty, in welch begrenztem Umfang es überhaupt möglich ist, Ungleichheit zu verringern und warnt vor einer Rückkehr in die Ungleichheit früherer Epochen. Zudem zeigt er Wege auf, mit denen das bisherige Engagement für Gleichheit aufrechterhalten werden kann.
Zweitens distanziert sich Piketty in Kapitel 1 dieses Buchs von einer eindimensionalen Sicht auf soziale Ungleichheit, die sich auf Vermögen oder Einkommen beschränkt. Seiner Auffassung nach habe die Geschichte der sozialen Gleichheit auch Bildung, Gesundheit, Konsum, Wohnen, Mobilität und Kultur zu erfassen (Kapitel 1, S. 35, 42).
Drittens nimmt Piketty de facto Abstand von dem Denken in Gesetzmäßigkeiten der historischen Entwicklung sozialer Ungleichheiten. In seinem ersten Buch Das Kapital im 21. Jahrhundert hatte er noch versucht, die Geschichte der sozialen Ungleichheit auf eine einfache mathematische Formel zu bringen. Doch soziale Ungleichheit hängt, so die Kernbotschaft seines neuen Buches, maßgeblich von Politik und einer Vielzahl politischer Instrumente ab, auf die gleich noch zurückzukommen sein wird.
Eine kurze Geschichte der Gleichheit reiht Kapitel zu diversen Themen der sozialen Ungleichheit locker aneinander. Einige Kapitel befassen sich mit dem Abbau sozialer Ungleichheit, andere eher mit deren zäher Beständigkeit; wieder andere Kapitel thematisieren eher wirtschaftliche Ungleichheit, andere politische Ungleichheit; manche Kapitel beziehen sich auf die Vergangenheit, andere sind auf die Zukunft gerichtet. Piketty behandelt zu Beginn des Buches (Kapitel 2), als Aufschlag sozusagen, sein Lieblingsthema: die zunehmende Konzentration von Vermögen im 19. Jahrhundert in den Händen der aristokratischen und bürgerlichen Oberschicht. Anschließend geht er auf die Dekonzentration der Vermögen nach dem Ende des Ersten Weltkriegs ein, vor allem auf die Entstehung einer dauerhaften, vermögenden Mittelschicht. Er leistet damit einen wichtigen Beitrag zur langen Debatte über die Frage nach Niedergang oder Beständigkeit der Mittelschicht in Europa und den USA. Allerdings, so betont Piketty, habe die untere Hälfte der Gesellschaft nur sehr wenig davon profitiert. Anschließend befasst sich der Autor in zwei Kapiteln (Kapitel 3 und 4, S. 61–109) mit dem Kolonialismus und der Sklaverei im 18. und 19. Jahrhundert. Auf kluge Art und Weise versucht er, den Siegeszug der europäischen kolonialen Vorherrschaft zu erklären. In diesem Kontext stellt er unter anderem die These auf, dass die heutigen Wohlstandsunterschiede zwischen den Ländern dieser Welt, aber auch innerhalb dieser Länder immer noch das Resultat der Nachwirkungen von Sklaverei und Kolonialismus seien. Dies sei auch auf die Wiedergutmachungszahlungen zurückzuführen, die an frühere Sklavenbesitzer für die Freilassung „ihres“ Eigentums, mithin die Abschaffung der Sklaverei, respektive an frühere Kolonialmächte für den Verlust „ihrer“ Kolonien entrichtet wurden. Das zeichnet er insbesondere anhand der Kolonialgeschichte Frankreichs nach und behandelt damit Entwicklungen, die den deutschen Leser:innen wenig bekannt sein dürften.
Piketty argumentiert dann in Kapitel 5 über politische Gleichheit (S. 110–135), dass die Zeit der Privilegien und Statusungleichheit mitnichten zu Ende sei. Vielmehr bestünden gravierende Ungleichheiten in rechtlicher wie politischer Hinsicht trotz der Einführung formal-juristischer und politisch-liberaler Gleichheit seit dem Ende der französischen Revolution in Form von Zwangsarbeit und von Zensuswahlrecht im 19. Jahrhundert fort; auch die Finanzierung von Wahlkämpfen, von Medien und von Think Tanks im 20. Jahrhundert reihe sich hier ein.
Die beiden zentralen Kapitel 6 und 7 (S. 136–190) widmet Piketty der wirtschaftlichen Ungleichheit und zeichnet die historische Entwicklung und die Wirkung der beiden bedeutsamsten, erst im 20. Jahrhundert entwickelten Instrumente zur Abmilderung wirtschaftlicher Ungleichheit nach, nämlich (1) die progressive Einkommens- und Vermögenssteuer sowie (2) der Wohlfahrtstaat. Die Einkommens- und Vermögenssteuer sowie teilweise auch der Wohlfahrtstaat kamen allerdings seit den 1980er-Jahren in nur noch abgeschwächter Form zu Einsatz. Piketty plädiert in diesen beiden zentralen Kapiteln dafür, diese wirkungsvollen Instrumente wieder stärker zu nutzen und durch neue zu ergänzen, etwa durch Grundeinkommen, Beschäftigungsgarantie, Erbschaftsteilung, Ausweitung von profitorientierten Unternehmen und Re-Regulierung des Kapitalmarkts. Welche dieser Maßnahmen und Instrumente Piketty für politisch durchsetzbar hält, lässt er offen.
Kapitel 8 (S. 191–219) thematisiert den Abbau der Diskriminierung von Frauen und Ethnien sowie der Diskriminierung im Bildungsbereich. Piketty stellt die immer noch starke Ungleichheit in Bezug auf Bildungschancen, die weiterhin bestehende wirtschaftliche Benachteiligung von Frauen, aber auch – als positives Beispiel – die Erfolge Indiens hinsichtlich der Verbesserung der wirtschaftlichen Chancen unterer Kasten heraus, die er auf die Quotenpolitik des Landes seit den 1980er- und 1990er-Jahren zurückführt.
Dann springt der Autor in Kapitel 9 zurück zum Thema Neokolonialismus. Ähnlich wie andere Ökonomen auch sieht Piketty seit den 1980er-Jahren (und nicht schon direkt nach der Dekolonisierung der 1940er- bis 1960er-Jahre) einen Rückgang der massiven wirtschaftlichen Ungleichheit zwischen den Ländern der Welt, vor allem auch zwischen der nördlichen und südlichen Hemisphäre. Dieser Rückgang hat in seinen Augen nicht allein mit dem rasanten wirtschaftlichen Aufstieg Chinas, sondern auch mit der neuen wirtschaftlichen Stärke Südostasiens und des subsaharischen Afrika zu tun. Aber die globalen Wirtschaftsbeziehungen blieben nach Pikettys Ansicht aufgrund der völligen Liberalisierung des Kapitalverkehrs und der geringen Steuerkraft vieler Länder des Südens auch nach den 1980er-Jahren weiterhin ungleich. Für Piketty besteht vor allem in regionalen Zusammenschlüssen von Staaten die Chance, diese globale Ungleichheit weiter abzubauen.
Das letzte Kapitel (S. 245 ff.) widmet sich ausschließlich der Zukunft. Piketty diskutiert, wie sich eine Klimakatastrophe auswirken würde, wie sich die Konkurrenz zwischen China mit seiner extremen innerstaatlichen Ungleichheit und dem Westen mit der begrenzten und weiter begrenzbaren Ungleichheit in Europa auswirken könnte. Außerdem geht er der Frage nach, wie das im Rahmen der Banken- und Finanzkrise 2008 entstandene, neue Gewicht der Zentralbanken in Hinblick auf soziale Ungleichheit spürbar werden dürfte. Die außergewöhnliche Erhöhung der Geldmenge durch die Zentralbanken seit der Finanzkrise habe in seinen Augen die wirtschaftliche Ungleichheit verstärkt, ließe sich aber im Fall einer Inflation (zum Zeitpunkt der Abfassung des Buches noch ein hypothetisches Szenario) von den Zentralbanken nicht weiter durchhalten.
Für die nächste Auflage dieses Buches hätte ich mehrere Wünsche: Da wäre zunächst der Wunsch nach einem modifizierten Titel, der den Leser:innen deutlicher werden lässt, wovon die Rede ist. Denn eine strenge Geschichte der sozialen Ungleichheit, aufgebaut nach Epochen oder Themen, erzählt das Buch nicht. Vielmehr präsentiert Piketty Lehren, die er aus der Geschichte von Gleichheit und Ungleichheit gezogen hat. Ich würde mir zweitens wünschen, der Autor löste seine in Kapitel 1 geäußerten Absichten, mehr über die Ungleichheit des Wohnens, der Gesundheit oder des Konsums zu schreiben, noch entschiedener ein. Vermögen und Einkommen bleiben seine zentralen Themen, Bildung kommt immerhin zur Sprache, aber über die Ungleichheit des Wohnens, der Gesundheit, des Konsums und der Mobilität bekommt man wenig zu lesen. Schließlich und drittens würde ich mir wünschen, der Autor würde sich noch mehr mit der Ungleichheit zwischen den Mitgliedsländern der Europäischen Union befassen. Hierbei handelt es sich um ein drängendes und bislang vernachlässigtes Thema. Europa hat Piketty zwar ohne Zweifel im Fokus, doch müsste er noch einen größeren Schritt in diese Richtung machen.
Ungeachtet solcher Wünsche hat dieses Buch eindrucksvolle Vorzüge: Piketty stellt erneut die ihm eigene, schlichtweg beneidenswerte Fähigkeit unter Beweis, seine Analysen und Thesen in einer verständlichen Sprache vorzustellen. Er vermeidet zu stark vereinfachende wie schwer verständliche Indikatoren; stattdessen entwickelt er neue, innovative, transparente Indikatoren wie etwa den zur sozialen Ungleichheit durch Umweltverschmutzung (Kapitel 1, S. 35 ff.). Piketty ist mehr noch als in seinem ersten, sehr erfolgreichen Buch kein blinder Quantifizierer, sondern schildert eindrucksvoll, warum im historischen Kontext das Vermögen im 18. Jahrhundert mit all seinen Privilegien und Vorrechten statistisch etwas anderes war als dasselbe Vermögen im 20. Jahrhundert. In der Struktur dieses Buchs mag die berühmte französische Klarheit womöglich nicht ganz durchschlagen, doch liefert seine Lektüre klar vorgetragen die Grundargumente Pikettys: Aus der Geschichte der sozialen Ungleichheit Europas lassen sich positive Lehren ziehen, vor allem aus dem 20. Jahrhundert, in dem gänzlich neue Instrumente zur Reduzierung sozialer Ungleichheit entwickelt, aber auch wieder abgeschwächt wurden (etwa Einkommensteuer, Vermögensteuer, sozialstaatliche Leistungen). Besonders in dieser Zeit versierte Historiker:innen können eine wichtige Rolle in der aktuellen Debatte über Ungleichheit spielen – ein Umstand, den sich Piketty auch zunutze macht wie kein anderer. Er vertritt in einem anregenden, interventionistischen Reformismus die Position, soziale Ungleichheit könne abgemildert werden, und zwar durch politische Instrumente, die er im Einzelnen aufführt und die soeben genannt wurden. Ein Teil dieser Instrumente wurde bereits im 20. Jahrhundert erfolgreich eingesetzt, andere sind eher Zukunftsmusik. Wie auch immer man im Einzelnen zu seinen Vorschlägen stehen mag: Niemand sonst aus dem Feld der Wirtschaftsgeschichte entwickelt derart anregend, einfallsreich und auch selbstkritisch neue Vorschläge zur Abmilderung sozialer Ungleichheit. Piketty versteht sich dabei selbst als Teil eines politischen Prozesses, schließlich schrieb er dieses Buch nicht nur als Historiker, sondern ebenso als politisch engagierter Intellektueller.
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Stephanie Kappacher.
Kategorien: Geschichte Globalisierung / Weltgesellschaft Kapitalismus / Postkapitalismus Politik Soziale Ungleichheit Wirtschaft
Zur PDF-Datei dieses Artikels im Social Science Open Access Repository (SSOAR) der GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gelangen Sie hier.
Empfehlungen
Made in Germany
Rezension zu „Dreihundert Männer. Aufstieg und Fall der Deutschland AG“ von Konstantin Richter
Transformation ja, aber wie?
Bericht von der digitalen Jahrestagung "Unsustainable Past – Sustainable Futures?" der DFG-Kolleg-Forschungsgruppe "Zukünfte der Nachhaltigkeit" am 11. und 12. Februar 2021
Vom richtigen Leben im falschen
Erik Olin Wright weist Wege aus dem Kapitalismus
