Eva-Maria Roelevink | Rezension | 27.10.2025
Made in Germany
Rezension zu „Dreihundert Männer. Aufstieg und Fall der Deutschland AG“ von Konstantin Richter
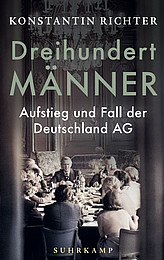
In der Tat, Dreihundert Männer ist ein gelungenes Werk; passend zu unserer Zeit ist es ein bisschen wehmütig. Aber dazu später. Man könnte in dem von Konstantin Richter gleich zu Beginn aufgeworfenen Bild bleiben und Dreihundert Männer als Symphonie lesen, als ein Stück, das – mithilfe der Montagetechnik frisch arrangiert – zunächst vielleicht etwas sperrig daherkommen mag, dann aber, Zug um Zug, enorme Komplexität zu einem Gesamtklang, zu einem „Sound“, verdichtet (S. 9).
In drei Bücher gegliedert, handelt der erste Hauptteil von der wirtschaftlichen Entwicklung im Kaiserreich. Stilistisch wirkt das bisweilen durchaus atemlos, so kurz sind die Häppchen, die Richter darbietet. Das passt aber völligst in den Kapitalismus der Gründerjahre, von dem Richter schreibt, dass er „viel Spaß“ gemacht habe (S. 21). Der große Spaß endete allerdings und einigermaßen abrupt mit der Gründerkrise 1873. Die sich formierende Unternehmerschaft zog aus dieser zunächst grandiosen und dann beklemmend ernüchternden Zeit eine breit geteilte Konsequenz: die schrankenlose Wettbewerbswirtschaft mit ihren fürchterlichen Kapriolen benötigte eine ausrichtende Hand! Die Wirtschaft musste in Ordnung und in eine verlässliche Struktur gebracht werden. Und genau das taten die Gründerunternehmer: Alfred Krupp tat es, Werner und Georg Siemens natürlich auch, und ja, das versuchten sogar die zu sehr am Spaß interessierten Erfinderbrüder Mannesmann. Nachdem die Gründergeneration abgetreten war, strebten neue Unternehmertypen an die Spitze der Unternehmen, nun oft Manager, angestellte Unternehmer also, Carl Duisberg war so ein Fall. Jedenfalls, sie überzogen das zügig wachsende Wirtschaftsdickicht mit einer Portion Wissenschaftlichkeit. Andere – wie Robert Bosch – versuchten es ein bisschen anders, sie wähnten sich als gute, das heißt soziale Unternehmer. Denn und ohne Zweifel: die soziale Frage, die eklatante Armut und die große Angst vor der ungezügelten Gewalt des rohen Proletariats verlangten zumindest eine Diskussion. Und obschon die Antworten mitunter unterschiedlich ausfielen, bildete sich am Ende ein gemeinsames Handlungsmuster der Unternehmer heraus, welches das deutsche Unternehmensgefüge auf Dauer prägen und kennzeichnen sollte: man schloss sich zusammen, mal vertraglich abgesichert, mal verstand man sich auch ohne formale Absprache, man fand sich ein, in Kartellen und Interessengemeinschaften, und man war aktiv in Verbänden, die eine gut finanzierte Verwaltung und eigene Verbandsfunktionäre erhielten. Für die sich formierende Männer-Kaste machte das großen Sinn, schien es doch, „als habe erst die Abkehr von der liberalen Marktwirtschaft den Aufschwung erlaubt“ (S. 60).
Die selbst auferlegte Ordnung funktionierte wunderbar. Abgesehen von einer Reihe kleinerer Interventionsmaßnahmen des Staates, die Richter nur streift, hatten sich die Herren der Wirtschaft zu einer Art regelgeleitetem Boxkampf eingefunden. Der Erste Weltkrieg bedeutete dann ein großes Störfeuer für diese selbst gegebene Struktur. Die nun folgende wechselreiche Zeit zwischen 1914 und 1945 bietet den Stoff für den zweiten Hauptteil. Bald ein materialverspeisender „Wirtschaftskrieg“, beschleunigte der Krieg die Konzentrationsneigung, ja er befeuerte die Zusammenschlüsse und auch die Verflechtung zwischen Staat und Wirtschaft nachhaltig (S. 171). Das Problem war nur: mit dem Krieg endete auch die Monarchie und das patriarchale Herr-im-Haus-Regime der Unternehmer passte nur schwer in die neue Gesellschaftsordnung. Die Herrschaft der wenigen, der dreihundert Männer, war bedroht, und zwar existenziell: „Nun scheint die Ordnung, diese feste Burg, die sie miteinander errichtet haben, binnen weniger Tage zu bersten.“ (S. 207) Die Unternehmer versuchten zu restaurieren, beteiligten sich an der Gegenrevolution und waren damit durchaus erfolgreich. Ihre Struktur, ihre Ordnung erwies sich als „resilient“; auch unter den neuen politischen Vorzeichen sprang das Unternehmergeflecht in die alte Fassung zurück (S. 232). Die Kredite aus Amerika, die der Dawes-Plan ermöglichte, sorgten für neue Liquidität und ein kollektives Aufatmen, das in der Welt von Kunst und Kultur vielfach als Goldene Zwanziger eingefärbt wurde, was durchaus mit dem neuen Frauenbild zu tun hatte. Nur in der Wirtschaft spielten Frauen weiterhin keine Rolle, überhaupt keine unter den dreihundert Männern, einmal abgesehen von dem gescheiterten Künstler Hitler, dem vielfach Frauen das bisschen Salonfähigkeit anerzogen. Nun ja. In der Wirtschaft war ohnehin etwas anderes los. Wieder kam der Absturz zügig; die Weltwirtschaftskrise traf die deutsche Wirtschaft hart, wenn auch nur kurz. Die Versuchung des Nationalsozialismus fiel auf einen gut vorbereiteten Boden. Dass Hitler aber von der Industrie in den Sattel gehievt wurde, stimmt natürlich so nicht. Fritz Thyssen unterstützte die Nationalsozialisten zwar frühzeitig, insgesamt aber war das Verhalten der Unternehmer ein breit gestreutes: Parteien wurden mit der Gießkanne bedacht, man wusste in dieser Politshow der Präsidialkabinette ja ohnehin nie so ganz genau, wohin die Reise wohl gehen würde. Machtergreifung und Gleichschaltung störten die deutsche Unternehmerschaft, die paar hundert Männer wenig, schließlich wurden sie endlich von den anstrengenden Gewerkschaften befreit, deren Interessen sie neuerdings zu berücksichtigen hatten. Und der Rüstungskurs, der half ja auch vielen von ihnen. Dabei war Hitler selbst eher an den Gründertypen interessiert, denen, die eigentlich keine Macht hatten, Ferdinand Porsche zum Beispiel. Das Verhältnis des Big Business zu Hitler war dagegen ein einträgliches, aber nicht konfliktfreies. Die dreihundert Männer agierten trotzdem als „skrupellose Opportunisten“ und beugten sich dem aggressiven, rassistischen und vernichtenden Kurs (S. 288). Bei aller propagandistisch zum Ausdruck gebrachten Zuneigung für den Mittelstand und die kleinen Erfinderunternehmer sorgte die Aufrüstungspolitik für eine weitere Konzentration der Wirtschaftsmacht der wenigen, der I.G. Farben und auch der Großbanken im Besonderen. Nicht zu belegen ist, dass die dreihundert Männer den Holocaust befürworteten oder gar anstrebten; dass sie ihn nutzten und dabei ein „völlig amoralisches Effizienzstreben“ an den Tag legten, trifft es schon eher (S. 326). Auch im Nationalsozialismus fand ein Generationswandel in der Unternehmerkaste statt, rückten neue „Veränderer“ an die Spitzen der Unternehmen (S. 332). Sie nahmen den Aktivitätswandel noch einmütiger hin, arisierten skrupellos, während andere, zumeist ältere, opportunistisch blieben; nur sehr wenige arisierten freundschaftlich. Der Beitrag der Unternehmer zum Holocaust war für Richter zuvorderst zuliefernder Art: das galt für die Degesch und viele mehr. Und dann war da noch die Zwangsarbeit. Auch hier waren die Unternehmer natürlich beteiligt, im Bilde und sie profitierten. Zwangsarbeiter:innen und KZ-Häftlinge trugen zur „Wirtschaftsleistung“ bei, die Albert Speer über seine Präsentationen vor wie nach 1945 gerne zum Besten gab (S. 351). Die Bilanz war ernüchternd: mangelndes Unrechtsbewusstsein, wechselseitig abgestützt durch die starke, immer noch resiliente Struktur.
Der dritte Hauptteil befasst sich mit der Zeit seit 1945 und reicht bis in unsere Gegenwart. Es ist der stärkste Teil des Buches. Der harte Kern der Unternehmerschaft wurde nach Kriegsende verhaftet, bald aber freigesetzt. Abgesehen von den spektakulären Nürnberger Prozessen blieb die Unternehmerschaft erst einmal unangeklagt. Die Alliierten wandten sich bald ab von ihren ursprünglichen Überlegungen, die Demontagen wurden beendet. Spätestens mit dem Koreakrieg 1950 zeigte sich: die wesentlichen Fertigungsstätten waren nicht schwer getroffen, sondern überwiegend intakt geblieben. Die Westintegration konnte dank der vorhandenen Kapazitäten zügig vorangetrieben werden. Bald standen die Auslandsmärkte und der internationale Kapitalmarkt den deutschen Unternehmern wieder offen, nicht zuletzt, weil Hermann Josef Abs ein Kunstwerk von einem Schuldenabkommen organisierte. Ohnehin, es war kein „Wunder“, die Entwicklung der deutschen Wirtschaft nach 1945, sondern es gab Anlagen, es gab die verschworene Gemeinschaft der dreihundert Männer, die ihre Haftzeit für die Zukunftsplanung genutzt hatten, und dann gab es da auch noch die günstigen Arbeitskräfte, zunächst die Vertriebenen, dann die geflüchteten DDR-Bürger:innen und schließlich die Gastarbeiter (S. 376). Die Unternehmen reorganisierten sich; die Deutsche Bank war hier wesentlich, sie kehrte bald zu alter Stärke zurück, baute ihre Industriebeteiligungen aus. Noch immer war es Richter zufolge „eine Haltung, eine Kultur, eine Denkweise“, die das Aufbauhandeln der Wundermänner leitete (S. 399). Das Konkurrenzgefüge nach innen war begrenzt, wirkte nach außen aber beinahe hermetisch abgeschlossen. Die ersten Pleiten, die von Borgward 1961 und Schlieker 1962, zeigten einen Wandel an. Der Abgesang auf die deutsche Wirtschaft, er begann schon zu Beginn der 1960er-Jahre. 1968 markierte den vorläufigen Höhepunkt eines Veränderungsschubs, der sich schon anzeigte, es sollte aber noch dauern, bis er in den Chefetagen und bei den dreihundert Männern ankam. Ezdard Reuter, mehr aber noch Alfred Herrhausen, wurden zu den Figuren, die den Wandel durchsetzten. Obschon beide scheiterten – Reuter mit dem Umbau von Daimler und Herrhausen mit der Neuausrichtung der Deutschen Bank –, konnte nach ihnen nichts mehr bleiben, wie es war. Die dreihundert Männer wurden weniger, unter dem nach Bretton Woods und der Thatcherisierung einsetzenden Veränderungsdruck in der Finanzwelt drohten sie zu verschwinden. Aufgehalten wurde dieser Prozess vom Mauerfall. Wie „koloniale Eroberer“ schwärmten die Vertreter der deutschen Unternehmerschaft aus und kauften ein (S. 485). Sie übernahmen Standorte, Kontakte, Kundendateien und Mitarbeiter:innen, jedenfalls manchmal. Die Altlasten übernahmen sie nicht, das wurde zur Sache des Staates. Ein hartes Vorgehen, das Richter erstaunt, bedenkt man mit wie viel Fingerspitzengefühl die Herren den Wiederaufbau nach 1945 betrieben oder wie sorgfältig und vorsichtig sie die Schwerindustrie an Rhein und Ruhr zu Grabe getragen hatten. Und dann: wieder eine neue Generation. Thomas Middelhoff, Ron Sommer und diese Leute. Nicht mehr als „Manager“, sondern als „CEOs“, natürlich englischsprechend, zerteilten sie die alten Mischkonzerne, denn strategieklare und ausrichtungseindeutige Unternehmen brachten einfach mehr ein. Sie verdienten mehr. Die Vorteile deutscher Rechnungslegung, Stille Reserven und die Privilegierung von Insidern tauschten sie gegen die härteren Bandagen des US-amerikanischen Wirtschaftsstils, hatten dafür aber nun mit der Sammelklage und größerer Transparenz in der Rechnungslegung umzugehen. Das Ende markierte der Mannesmann-Deal: 2002 übernahm Vodafone den alten Industriekonzern, der ursprünglich in Röhren und dann in Mobilfunk gemacht hatte. Das war der endgültige „Bruch mit der Tradition. Die Festung fällt“ (S. 508).
Richter zeichnet das Werden und Vergehen dieser Struktur kollektivbiografisch. Dazu hat er eine Reihe von Unternehmerbiografien arrangiert und in seine Montage eingefügt: immer dabei sind die Eigentümer und Verwalter des Krupp-Konzerns, in jedem Hauptkapitel werden die Führungsfiguren der Deutschen Bank charakterisiert, unzählige Unternehmernamen werden angeführt und in ihrer Haltung auf den Kontext bezogen. Eine besondere und daher erwähnenswerte Rolle bekommt Walther Rathenau. Er, der Exot unter den Wirtschaftsmächtigen, hatte 1909 in einer seiner Zeitdiagnosen das Leit- und Titelthema des Buches formuliert: „Dreihundert Männer, von denen jeder jeden kennt, leiten die wirtschaftlichen Geschicke des Kontinents“ (S. 151). In der ersten Hälfte des Ersten Weltkrieges wurde das als Konzentration wirtschaftlicher Entscheidungsmacht nicht mehr nummerisch festgehalten. Rudolf Hilferding brachte seine Zeitdiagnose auf die Formel „organisierter Kapitalismus“. Später wurde das dieserart identifizierte Zusammenwirken als „Deutschland AG“ bezeichnet, das war dann aber bereits ein Stück Geschichtswissenschaft, keine Zeitdiagnostik mehr. Die Literatur- und Materialgrundlage, die Richter für seine Montage gewählt hat, besteht zu einem Teil aus Zeitdiagnosen, die mal von pfiffigen Journalisten – besonders begeistert hat ihn wohl William Manchester (S. 64) –, mal von Ökonomen oder auch Unternehmern verfasst wurden. Hervorzuheben ist aber, dass Richter es nicht bei dieser Materialgrundlage belässt, sondern auch einige wirtschafts- und unternehmenshistorische Fachliteratur verarbeitet hat. Das ist schon erfreulich und keineswegs selbstverständlich.
Und schließlich: die Wehmut. Das ist ein Topos, der sich im Genre der populären Wirtschaftsgeschichtsschreibung schon lange findet. Die ersten Unternehmer, die Gründerunternehmer, wurden noch als Fortschritts- und Lichtgestalten beschrieben. Dann aber folgte sie schon, die Wehmut, die sich fortwährend als zeitgebundener Blick zurück, darauf, dass es mal besser war, charakterisieren lässt. Richter schreibt auch ein bisschen wehmütig. Die neueren Skandale, Cum-Ex und andere Schrecklichkeiten, bringen ihn zu der Frage: „Haben sie [die deutschen Unternehmer] ihren moralischen Kompass verloren?“ (S. 524). Das mag ich als Wirtschaftshistorikerin nicht beantworten, Zeitdiagnostik liegt mir nicht. Gleichwohl scheint mir aber doch eine Gegenfrage angebracht: hat der Kollektivakteur, die deutsche Unternehmerschaft, einen solchen „moralischen Kompass“ denn jemals besessen? Wenn man Richters Ausführungen folgt, sind Zweifel durchaus angebracht. Richters Populärgeschichte der Dreihundert Männer ist opulent, mehr als 500 Seiten schwer. Und es fehlen trotzdem viele und auch einiges. Großflächig fehlt die andere Hälfte Deutschlands; die Hälfte, die zwischen 1949 und 1989 DDR war. Bei der langen Linie, die Richter aufmacht, ist dieses Loch auffällig und auch bedauerlich. „Die Zukunft ist offen“, so lautet sein letzter Satz (S. 530). Das ist so. Richtig ist sicher auch, dass die Geschichte helfen kann, in die Zukunft zu denken. Und damit: Bei allem Verlust an Halt und Zuversicht, den diese dreihundert Männer für ihresgleichen bedeutet haben: der „Sound“ von Richter lässt hoffen – auf die vielen anderen Männer und auch Frauen, die jetzt zumindest mitspielen dürfen. Und wer weiß, vielleicht macht es ja Spaß.
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Karsten Malowitz.
Kategorien: Arbeit / Industrie Demokratie Geld / Finanzen Geschichte Gesellschaft Globalisierung / Weltgesellschaft Gruppen / Organisationen / Netzwerke Kapitalismus / Postkapitalismus Konsum Macht Politische Ökonomie Soziale Ungleichheit Sozialer Wandel Staat / Nation Wirtschaft
Zur PDF-Datei dieses Artikels im Social Science Open Access Repository (SSOAR) der GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gelangen Sie hier.
Empfehlungen
Die Häutungen des Leviathan
Rezension zu „The Project-State and Its Rivals. A New History of the Twentieth and Twenty-First Centuries“ von Charles S. Maier
Armut, Steuern und Schulden in den USA
Rezension zu „Im Land des Überflusses“ von Monica Prasad
Kritische Theorie oder empirieferne Deduktion?
Rezension zu „Der Allesfresser. Wie der Kapitalismus seine eigenen Grundlagen verschlingt“ von Nancy Fraser
