Hanna Doose | Rezension | 23.03.2022
Am Markt vorbei
Rezension zu „Just Housing. The Moral Foundations of American Housing Policy“ von Casey J. Dawkins
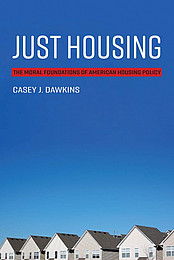
Die Debatte um die gerechte Verteilung von Wohnraum mit ihrer Vielzahl an dazugehörigen Themen – etwa der Frage nach Privateigentum, Mietpreisen und Mietsicherheit, Bauvorhaben und -tätigkeit oder Recht auf Stadt – bewegt Menschen weltweit. Mit Just Housing konzentriert sich der an der University of Maryland lehrende Professor für Urban Studies and Planning Casey J. Dawkins allerdings ausschließlich auf den US-amerikanischen Raum. Der Theorie als auch der Praxis US-amerikanischer Wohnungspolitik gebührt hierbei die ganze Aufmerksamkeit des Autors, dessen (individualistischer) Ansatz sich wohl nur ansatzweise auf den europäischen Raum übertragen ließe.
Vor dem Hintergrund der in der Corona-Pandemie noch größer gewordenen Schere zwischen Arm und Reich – im Bereich Wohnraum in Form der zugespitzten Obdachlosigkeitskrise auf der einen und den vorstädtischen Einfamilienhäusern als Sinnbild des amerikanischen Traumes auf der anderen Seite – erläutert Dawkins seine Vorschläge für eine rechtebasierte Konzeption von Wohnraumgerechtigkeit, bei der jede:r Bürger:in das Recht auf sicheren und längerfristig gesicherten Wohnraum hat. Für diese widmet sich der Autor nicht nur ausführlich und mit klaren Worten der philosophischen Rechtfertigung von Privateigentum und dem US-amerikanischen historischen Kontext, der den jeweiligen philosophischen Strömungen zum Thema Wohnraum zugrunde liegt, er befasst sich auch mit der Frage nach (sozialer) Gerechtigkeit sowie der Gleichberechtigung unterschiedlicher ethnischer Gruppen bei der Inanspruchnahme von Wohnraum und wie diese in konkreten Maßnahmen im US-amerikanischen Kontext aussehen könnten. Nicht nur zeitgenössische Gerechtigkeitsdiskurse, etwa im Kontext der Black Lives Matter- oder der Recht auf Stadt-Bewegungen, sondern auch angewandte Ethik und Bereiche der Politikwissenschaft finden hier ihren Platz. Folglich bietet die Publikation diverse Anschlussmöglichkeiten für ein breites Themenspektrum.
Besonders hervorgehoben werden im ersten und zweiten Teil des Buches unterschiedliche theoretische Strömungen. Elemente dieser Theoriediskurse kombiniert Dawkins mit Aspekten progressiver und pragmatischer Rechtfertigungen von Privateigentum, um schließlich seinen eigenen Ansatz für das Recht auf Wohnraum vorzustellen. Dieser fußt auf einer erweiterten Definition der US-amerikanischen Staatsbürgerschaft, der sogenannten sozialen Staatsbürgerschaft (social citizenship), bei der sowohl die Bürger:innen untereinander als auch Bürger:innen und Staat zueinander in Beziehung und Schuldverhältnissen stehen, um allen ein würdevolles Leben zu ermöglichen. Dawkins betont an dieser Stelle insbesondere die Bedeutsamkeit von Gleichstellung und Gleichberechtigung aller Bürger:innen, die er als civic equality bezeichnet und die sich aus der moral equality (der vertikalen Beziehung zwischen Staat und Bürger:innen, bei der jede Person als moralisch ebenbürtig angesehen wird) und der relational equality (der horizontalen Beziehung zwischen Bürger:innen, in welcher gegenseitige Anerkennung der Gleichheit im sozialen Gefüge und den bürgerlichen Freiheiten herrscht) zusammensetzt.
Unter Berufung auf all diese Konzepte, die zusammen die soziale Staatsbürgerschaft ausmachen, streitet Dawkins im dritten Teil seines Buches gegen gängige Argumentationsweisen, insbesondere gegen diejenige von Wohnraumaktivist:innen, die oftmals die Verstaatlichung bestehenden Wohnraums fordern. Dawkins definiert das Recht auf Wohnraum als das Recht auf (langfristig) gesicherte Wohnverhältnisse, die in unterschiedlichsten Formen, etwa Miet- oder Eigentumswohnungen sowie durch verschiedene fiskalische Reformen garantiert werden sollen. An dieser Stelle argumentiert der Autor, dass Privateigentum eher konstitutiv als widersprüchlich für das Recht auf Wohnraum sei. Zwar erschaffe es das Problem unsicheren Wohnraums zunächst, allerdings sei es gleichermaßen die Lösung dieses Problems, schließlich mache es die langfristige Sicherung von Wohnraum überhaupt erst möglich. Häufig mangele es jedoch an verfügbarem Wohnraum und die Zugangsbarrieren seien hoch. Zur praktischen Lösung dieser Probleme schlägt Dawkins konkrete steuerliche Maßnahmen vor: Zum einen plädiert er für die Einführung einer negativen Verbrauchsteuer auf Wohnraum. Die hieraus generierten Steuereinahmen aus der unterstellten Miete von Hauseigentümer:innen sowie die Besteuerung von Mieteinnahmen sollen eine monatliche Zuteilung für Mieter:innen mit geringem Wohnraumkonsum finanzieren. Zum anderen spricht sich Dawkins für eine auf Wohnraum konzentrierte inkrementelle Vermögenssteuer in Form einer progressiven Kapitalertragssteuer auf Wohnraumerwerb aus. Für den Erwerb des ersten Eigenheims, für die Verbesserung bestehenden Wohnraums sowie für die kostengünstige Veräußerung von Wohnraum soll es allerdings vorrübergehende Steuererleichterungen geben.
Die Einnahmen aus den genannten Steuern sollen nach Dawkins‘ Vorstellung den Kommunen zugeführt werden, die diese umverteilen und in lenkender Rolle dazu nutzen sollen, flächendeckend allen Bürger:innen den Zugang zu Wohnraum zu ermöglichen, etwa in Form von wohnraumspezifischen Steuerfreibeträgen, Subventionen für Angebot und Nachfrage von bezahlbarem Wohnraum sowie für die Finanzierung von Maßnahmen zur Verringerung der in Wohngebieten bestehenden Ungleichheit.
Trotz der Leistung des Autors, die eingangs vorgestellte moralische Rechtfertigung von Eigentum in sehr praktische Handlungsoptionen zu übersetzen, bleibt nach der Lektüre ein großes Fragezeichen über deren Grundlagen und ihrer möglichen Anwendbarkeit. Vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen ist nicht nachvollziehbar, weshalb Dawkins sowohl hinsichtlich seiner Argumentation als auch seiner vorgebrachten Lösungsvorschläge so stark auf der individuellen Ebene verbleibt und darüber hinaus kein Problem in der Ungleichverteilung des Eigentums an Wohnraum zwischen institutionellen Eigentümer:innen und natürlichen Personen erkennt. Nicht nur Mehrfamilienhäuser sind mit wachsender Tendenz im Besitz von institutionellen Investoren, auch Einfamilienhäuser haben als Anlageklasse für ebendiese in den letzten Jahrzehnten, besonders seit der Finanzkrise 2007/2008, in den Vereinigten Staaten und auch weltweit stark an Bedeutung gewonnen.[1] Diese Entwicklung trägt nicht nur maßgeblich zur Ungleichverteilung von Wohlstand bei, sondern beeinflusst auch den Zugang zu sowie die Verfügbarkeit von Wohnraum negativ. Zwar berücksichtigt Dawkins die Rolle von Investor:innen in seinen Überlegungen zum Eigentumsregime (S. 208), widmet sich dieser Akteursgruppe allerdings nur am Rande und schenkt ihr auch im weiteren Verlauf wenig Aufmerksamkeit. Hinsichtlich einer praktischen Anwendung der Dawkins‘schen Ausführungen ergeben sich so zweierlei entscheidende Konsequenzen:
Zunächst sei bezüglich seiner theoretischen Rechtfertigungsgrundlagen angemerkt, dass diese auf den Beziehungen und Verpflichtungen der Bürger:innen untereinander und deren Beziehung zum Staat basieren. Körperschaften, zu denen auch institutionelle Investoren zählen, sind Bürger:innen jedoch weder gesetzlich noch moralisch gleichgestellt, sodass Dawkins‘ Konzept der bürgerlichen Gleichberechtigung für diese Gruppe bedeutsamer Marktakteure schlichtweg nicht greift. Folglich verlieren auch die daraus abgeleiteten praktischen Vorschläge für institutionelle Investor:innen ihre Rechtfertigungsgrundlage. Wenn Konzerne und Investoren nun von den vorgeschlagenen steuerlichen Reformen ausgenommen sind, können die Mechanismen nur teilweise oder gar nicht greifen. Dawkins‘ Vorschläge würden eher die Dominanz und das Missbrauchspotenzial institutioneller Wohnungsgeber stärken, da die Konkurrenz von Individuen auf dem Wohnungsmarkt geschwächt würde (diese müssen nämlich erhöhte Steuern zahlen, institutionelle Investoren selber aber nicht). Die aus einer solchen verstärkten Monopolstellung resultierende Machthierarchie würde viele Bürger:innen möglicherweise sogar verstärkt in ein Abhängigkeitsverhältnis gegenüber institutionellen Investoren bringen.
Zweitens seien auch bezüglich der praktischen Umsetzung von Dawkins‘ Vorschlägen Bedenken angemeldet: Institutionelle Investoren könnten, unabhängig von der Rechtfertigungsgrundlage, ebenfalls zum Einhalten der genannten Maßnahmen verpflichtet werden. Hier stellt sich jedoch die Frage, wie sich die veränderte Anreizstruktur auf die Wohnraumentwicklung und den Bausektor auswirken würde. Einer Anhebung der Kapitalertragssteuer kann mit dem traditionellen Argument der Anreizverringerung begegnet werden. Hier schlägt Dawkins staatliche Lenkung mittels der Deregulierung von Forschung und Entwicklung vor sowie Investitionen in diesen Sektor (S. 212). Es ist fraglich, inwiefern solche Maßnahmen tatsächlich ausreichen, um die Verringerung der Anreize zu kompensieren und mit Einführung der vorgeschlagenen Steuern rechtzeitig in Effekt treten zu können, besonders wenn der Staat überwiegend in einer lenkenden und nur teilweise aktiven Rolle im Bau- und Mietsektor tätig werden soll. Gerade vor dem Hintergrund einer steigenden Bevölkerungszahl (und der Herausforderung, dem gegenwärtig relativ hohen Anteil an Obdachlosen in der Bevölkerung dauerhaft Wohnraum zur Verfügung zu stellen) müssen bei jedem Vorschlag zu mehr Wohnraumgerechtigkeit solche möglichen negativen Konsequenzen berücksichtigt werden.
Ein letzter Aspekt sei in Bezug auf die Gerechtigkeit für unterschiedliche ethnische Gruppen angemerkt: Dawkins widmet dieser Thematik ein Unterkapitel (S. 228–236), in dem er die Bedeutung seines Arguments der bürgerlichen Gleichberechtigung und die daraus entwickelten Maßnahmen im Kontext der Wohnraumdiskriminierung nicht-weißer Gemeinschaften untersucht. Seine hier vorgebrachten Schlussfolgerungen für die betroffenen Gruppen müssen als schlichtweg nicht zufriedenstellend bezeichnet werden, denn Dawkins‘ Hauptfokus liegt auf der wohnräumlichen Segregation verschiedener ethnischer Gruppen, die er glaubt mit der Gleichberechtigung der Bürger:innen verringern zu können – und das muss erstmal reichen. Denn vor dem Hintergrund der herrschenden Ressourcenknappheit stellt Dawkins dieses Thema prioritär hinter die Beschaffung von Wohnraum für obdachlose Individuen. Der Autor zieht Maßnahmen, die eher generell ungleichheitsverringernd sind solchen vor, die bestimmte benachteiligte Bevölkerungsgruppen unterstützen. So könnten Dawkins‘ Maßnahmen zwar möglicherweise zukünftig Ungerechtigkeit verringern, bilden aber keine Grundlage dafür, vergangene Enteignungen sowie andere Formen der Diskriminierung und insbesondere die daraus resultierenden Wohlstandsunterschiede für die Betroffenen auszugleichen. Die Möglichkeit direkter Kompensationen für in der Vergangenheit liegende Ungerechtigkeiten zieht der Autor jedenfalls nicht in Betracht. Auch wenn es bei einer Vielzahl von sich überlappenden Rechtsansprüchen nicht einfach wäre, sie zu bestimmen, sollten derlei Aspekte bei Überlegungen zum Thema Gerechtigkeit nicht ausgeklammert werden.
Insgesamt ist Just Housing ein interessanter Ansatz, der den Diskurs um Wohnraumgerechtigkeit aus einer pro-Eigentum-Perspektive angeht. Dawkins‘ Überblick über die historischen Entwicklungen in den USA und die sich wandelnden Perspektiven zur Rechtfertigung von Grundbesitz und dem Recht auf Wohnraum in den ersten Kapiteln sind eine anregende, und vielleicht auch der lesenswerteste Teil der Lektüre. Seine Argumentation zu Wohnraumgerechtigkeit, die schlussendlich auf simple Vorschläge für steuerliche Maßnahmen hinausläuft, kann allerdings nur als Denkanstoß dienen und nicht als konkrete Problemlösung in die politische Entscheidungsfindung mit einfließen. Der scheinbar unbedingte Wille, Marktmechanismen nicht grundlegend zu kritisieren und Wohnraumprobleme eher durch Anreize und steuerliche Lenkung als durch konsequentes Eingreifen lösen zu wollen, legt hier die Verantwortung für Wohnraumprobleme ausschließlich in die Hände von Staat und Bürger:innen. Die Vernachlässigung einer der wichtigsten Gruppen im Wohnungsmarkt, den institutionellen Eigentümer:innen, ist eine allzu große Schwachstelle, als dass Dawkins‘ Vorschläge ernsthaft in Erwägung gezogen werden könnten. Denn ohne diese Gruppe ausreichend in den Überlegungen zu berücksichtigen, könnten die vorgeschlagenen Maßnahmen die Ungleichheit im Wohnsektor möglicherweise sogar noch verstärken, statt langfristig Wohnraumverhältnisse zu verbessern.
Fußnoten
- Brett Christophers, How and Why U.S. Single-Family Housing Became an Investor Asset Class, in: Journal of Urban History (2021), Juli, S. 1–20.
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Stephanie Kappacher.
Kategorien: Geld / Finanzen Politik Soziale Ungleichheit Sozialpolitik Stadt / Raum
Zur PDF-Datei dieses Artikels im Social Science Open Access Repository (SSOAR) der GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gelangen Sie hier.
Empfehlungen
Wohnen an den Rändern der Stadt
Rezension zu „Die Ungleichheit der Städte. Urbane Problemzonen im postkolonialen Frankreich und der Bundesrepublik“ von Christiane Reinecke
Armut, Steuern und Schulden in den USA
Rezension zu „Im Land des Überflusses“ von Monica Prasad
