Felix Krämer | Rezension | 10.07.2025
Armut, Steuern und Schulden in den USA
Rezension zu „Im Land des Überflusses“ von Monica Prasad
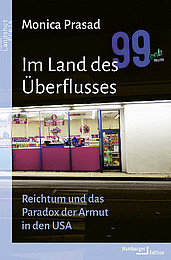
The Land of Too Much, so der Originaltitel des Buchs von Monica Prasad, welches nun in deutscher Übersetzung in der Hamburger Edition publiziert wurde, ist Anspielung und Anklage zugleich. Zum einen zitiert die Autorin damit Huey Long, einen populistischen Politiker und ehemaligen Gouverneur von Louisiana, der sich zur Zeit der Weltwirtschaftskrise für den Ausgleich von Vermögensunterschieden durch steuerliche Umverteilung stark machte. Zum anderen pointiert Im Land des Überflusses den Kontrast zwischen Überproduktion und grassierender Armut in den Vereinigten Staaten im 20. und 21. Jahrhundert. Hierzu entfaltet die an der Northwestern University lehrende Soziologin Prasad in dem Buch ein spannendes historisches Argument: Es war die spezifische Ausgestaltung des Steuersystems, die in den USA eine mangelhafte Entwicklung des Sozialstaats begünstigte. Die auf Förderung privater und betrieblicher Fürsorge zielende Besteuerung bewirkte letztlich ein kreditbasiertes Sozialnetz, was für alle Menschen jenseits regulärer Lohnverhältnisse Armut und Prekarität bedeutete. Entscheidenden Anteil an dieser Entwicklung hatten Vertreter der US-Agrarindustrie. Weiße Farmer und Kleinbauern hatten seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert intensive Lobbyarbeit gegen Monopolstrukturen in der Infrastruktur, in der Beförderung ihrer Güter und der Finanzierung durch Geldinstitute betrieben. Dabei war es nach Prasad nicht zuletzt die von dieser Seite forcierte Implementierung progressiver Besteuerung, die sich für die Entwicklung eines starken Sozialstaates in den USA als äußerst hinderlich erweisen sollte. Statt einer föderalen Umsatzsteuer und der Nutzung dieser Mittel zum Transfer und der Finanzierung einer staatenübergreifenden Wohlfahrt gab es die Steuererleichterung für Selbstversorger in Bezug auf Einkommen. Dabei war im Gegensatz zu verschiedenen europäischen Staaten in den USA nicht etwa ein gewollt schwacher Föderalstaat für die sozialen Unterschiede verantwortlich. Im Gegenteil, es herrschten strengere Regulierungen und Verbraucherschutz in vielen Bereichen, was sich im New Deal der 1930er-Jahre noch verstärkte und sich für einen Moment zu Beginn der Great Depression und des New Deal tatsächlich auf Sozialgesetzgebung ausdehnen ließ. Sozialrisiken blieben allerdings privatisiert und ab Mitte der 1930er-Jahre übernahmen staatliche Absicherungen für Markt- und Konsumanreize die spärlichen sozialpolitischen Initiativen.[1]
Prasads historische Darstellung führt die Leser:innen in einem großen Bogen von der Wachstumsphase und den gewaltigen Haushaltsüberschüssen seit Ende des 19. Jahrhunderts über die Weltwirtschaftskrise der 1930er-Jahre und den neoliberalen Turn der 1970er- und 1980er-Jahre bis in die Zeit der Finanzkrise von 2007/2008. Dass Prasad die Ursachen der Finanzkrise auf der Basis ihres historisierenden Argumentationsganges als Konsequenz der Deregulierung einer maßgeblich kreditfinanzierten Gesellschaft und der durch diese geleiteten Finanzströme gleich miterklärt, gibt einen Hinweis darauf, dass die Finanzkrise das auslösende Moment für Prasads Untersuchung gewesen sein dürfte, war doch die ursprüngliche Ausgabe des Buches bereits 2012 bei Harvard University Press erschienen.[2] Dessen ungeachtet lässt sich ihre umfangreiche Geschichte von Regulierung, Populismus, Bürokratie, Deregulierung, Krediten und Verschuldung auch als geschichtliche Folie zur politischen Gegenwart 2025 gewinnbringend lesen. Darauf wird am Ende zurückzukommen sein.
Das Buch gliedert sich in drei Teile. Der erste umreißt die Geschichte bundesstaatlicher Interventionen in den USA. Prasad nimmt dabei eine vergleichende Perspektive ein und bewegt sich durch unterschiedliche Landschaften aus Regeln, Gesetzen, Praktiken und Rationalitäten im Industriekapitalismus Europas und der USA seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts (S. 15 ff.). Dabei stellt sie unter anderem fest, dass der Verbraucherschutz in den USA bis in die 1960er-Jahre hinein weitaus strenger (und besser) reguliert war als in den meisten Ländern Europas (S. 36). Kenntnisreich setzt sie sich mit Klassentheorien und Spielarten des Kapitalismus auseinander und betont auch die rassistische Fragmentierung der US-Gesellschaft, einen Umstand, dem sie etwas überraschend allerdings keine durchgreifende Bedeutung für die Eigentumsproblematik der USA zuschreibt (S. 63).[3] Schließlich diskutiert sie die Weltwirtschaftskrise der 1930er-Jahre, die unter dem Strich Ergebnis einer Überproduktion war, welche die Preise erodieren ließ. In Reaktion darauf wurde das „Endverbraucher-Paradigma“ durchgesetzt (S. 123), das alle unternehmerischen Entscheidungen am Endverbraucher und dessen Bedürfnissen ausrichtet. Entsprechend interpretiert Prasad auch den gemeinhin als gewerkschaftsfreundlich gelesenen Wagner Act von 1935, der Arbeitnehmer:innen im privaten Sektor in dem Recht zur Gründung von Gewerkschaften und zur Durchführung von Streiks bestärkte, nicht als Teil eines blassen Klassenkampfes, sondern als Bestandteil einer immensen Konsumrevolution, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts über einen „Hypotheken-Keynesianismus“ weiterwirken sollte (S. 125 u. 130).
Die historisierenden Abschnitte im zweiten Teil des Buches (Kapitel 4–6) befassen sich mit dem US-Steuersystem und dessen Bedeutung für den Sozialstaat, wobei in dem Part insbesondere Prasads intensives Quellenstudium überzeugt (vgl. u. a. S. 141, Fn. 23). Ausgehend von der Frage, warum es in den USA keine nationale beziehungsweise föderale Umsatzsteuer gibt (S. 137 ff.), zeichnet Prasad zunächst drei gescheiterte Versuche zu deren Einführung nach. Der erste Versuch schlug 1921 fehl, als eine Umsatzsteuer angedacht wurde, um Kriegsschulden zu bezahlen. Ein zweiter Versuch erfolgte 1932 vor dem Hintergrund der Auswirkungen der Great Depression. 1985 –mitten in der Reagan-Ära – wurde ein dritter (erfolgloser) Anlauf unternommen, diesmal interessanterweise zur Gegenfinanzierung eines Umweltfonds.
Anhand ausgewählter Positionen, wie der des eingangs erwähnten Politikers Huey Long, zeichnet Prasad exemplarisch die in der ersten Hälfte der 1930er-Jahre geführte Debatte um die 1913 mit dem 16. Verfassungszusatzartikel eingeführte progressive Besteuerung nach (S. 176). In ländervergleichender Perspektive beschreibt sie, wie in den USA diese Besteuerung etabliert wurde und welche höheren Einkommen stärker belastet wurden. In der Konsequenz stellten sich Betriebe, Arbeiterschaft und Angestellte durch die eingepflegten Steuervergünstigungen für betriebliche Renten- und Gesundheitsversorgung darauf ein, dass andernorts sozialstaatlich garantierte Leistungen in den USA innerhalb dieses Rahmens über „tax exemptions“ abgesichert werden (S. 200), was der Politikwissenschaftler Christopher Howard als Hidden Welfare State beschrieben hat.[4] Letztlich erklärt Prasad überzeugend, wie in den 1940er-Jahren der Widerstand gegen die Umsatzsteuer im Zusammenspiel mit den Steuererleichterungen für Sozialleistungen bei der Einkommenssteuer dem aus ihrer Warte „seltsamen Prozess“ von Überproduktion hin zu progressiver Besteuerung und eingeschränkter Sozialstaatlichkeit in den USA den Weg ebneten (S. 230).
Im dritten und letzten Teil mit dem Titel „Die agrarorientierte Regulierung des Finanzsystems“ verfolgt Prasad anhand der Themen Regulierung, Steuern, Kredit und Schulden die Verbindungslinien von den beschriebenen Strängen der politischen Ökonomie des 19. und 20. Jahrhunderts zur Finanzkrise von 2007. Demnach hatten die oben genannten Agrarier und deren Vertreter im Kongress am Ende des 19. Jahrhunderts ein bürokratisches Kartellrecht zu ihren Gunsten durchgesetzt. Die Gruppe der Farmer und Geschäftsleute wurde durch ein schuldnerfreundliches Insolvenzrecht abgesichert und bevorteilt, das von 1898 bis 2005 Privatinsolvenzen günstiger als in anderen Ländern regelte, wie Prasad darlegt. Die Autorin stellt sogar die Frage, ob das Drängen agrarischer Gruppen auf diese Form der Insolvenzgesetzgebung nicht im Widerspruch zum Eigentumsprinzip des Kapitalismus stehe (S. 241 u. 244). Aufgrund eines Konflikts um die Bepreisung von Transportdienstleistungen durch die Bahn hatten die Agrarier sich bereits Ende des 19. Jahrhunderts für eine bundesweite Regulierungsbehörde eingesetzt, was 1887 die Gründung der Interstate Commerce Commission (ICC) zur Folge hatte (S. 250 ff). Weitere Maßnahmen zur Regulierung des Marktgeschehens führten in den Folgejahren zu einem Ausbau einer entsprechenden Bürokratie. Einen wichtigen Entwicklungsschritt markiert in diesem Zusammenhang die Regulierung des Bankensektors während der Weltwirtschaftskrise durch den Glass-Steagall Act von 1933, der eine Trennung von Geschäfts- und Investmentbanken festschrieb. Prasad verfolgt die Wirkungen dieser und weiterer staatlicher Maßnahmen auf den Nexus von Kredit und Schulden bis zum Beginn der Finanzkrise im Jahr 2007. Dabei stellt sie fest, dass noch bis Ende des 20. Jahrhunderts US-amerikanische Banken prinzipiell stärker reguliert waren als jene in Europa. Ihre fortgesetzte Deregulierung in den Jahren 1994 und 1999 hatte aber andere Folgen, da die politische Ökonomie in den USA nach dem Zweiten Weltkrieg in starkem Maß durch Hypothekenfinanzierung getrieben war (S. 240). Zu den zeithistorischen Ereignissen, die diese Entwicklung beförderten, gehört für Prasad unter anderem die wirtschaftliche Stagnation und Krise seit den 1970er-Jahren, wie sie in einer konstruktiven Kritik an Greta Krippners Capitalizing on Crisis zeigt (S. 260).[5] War nach der Einführung von Ratenkrediten zum Autokauf 1915 die spezifische Form des kreditfinanzierten Immobilieneigentums durch die Regulierung und Federal Housing Administration (FHA) zu einem wichtigen Baustein der politischen Ökonomie geworden, übersetzte sich der Trend der Kreditfinanzierung von den 1930er-Jahren bis in die Gegenwart auch in die Sozialpolitik (S. 271 f.). Unter Bezugnahme auf den Göttinger Wirtschaftshistoriker Jan Logemann sieht Prasad einen Hauptunterschied zwischen den politischen Ökonomien der USA und der Bundesrepublik in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts darin, dass die Mobilisierung von Spareinlagen in Deutschland einen produktionssteigernden Effekt hatte (S. 278), und sie stellt fest: „Es war Deutschland, das Hayeks Lehren zu den Gefahren leichter Kreditaufnahme beherzigte, während die USA die keynesianische Vergrößerung des Konsums übernahm“ (S. 279).
Die Finanzkrise 2007/2008 erscheint aus dieser Sicht als das Ergebnis eines Zielkonflikts zwischen privater kreditbasierter und staatlicher sozialer Absicherung in den USA. Den (europäischen) Sozialstaat bezeichnet Prasad entsprechend als Umverteilung aus der Gegenwart, Kredit hingegen als Umverteilung aus der Zukunft (S. 318). Die Unterentwicklung des US- Sozialstaates gilt ihr daher als wichtige Teilursache der Finanzkrise (S. 320). Die pfadabhängige Entwicklung der Steuerfinanzierung traf in den 1970er-Jahren auf eine unüberwindbare Krise, so das Argument. Das vorhandene System sorgte nicht nur für einen Anstieg der Armut, die vor allem diejenigen traf, die nicht als kreditwürdig eingestuft wurden und somit ohne jede Absicherung blieben, sondern auch für einen stetig steigenden Bedarf an Kredit und wachsende Verschuldung in der Gesellschaft (S. 326). Infolge der Deregulierung und der Aufhebung des Glass-Steagall Act eröffneten sich 1999 neue Möglichkeiten der Finanzialisierung, mit denen das Bankensystem nicht umgehen konnte. Demnach rächte sich, dass Formen der Absicherung, die anderenorts zum Leistungsspektrum des Sozialstaats gehören, in den USA jahrzehntelang über private Kredite finanziert worden waren. Deren immense finanzielle Risiken hatte man bekanntlich zunächst den jeweiligen Schuldner:innen aufgebürdet, bevor man sie zunehmend in Derivate verpackte und über die ganze Welt streute. Diese Zusammenhänge stellt Prasad sehr überzeugend heraus. Ebenfalls überzeugend sind die Reformvorschläge, die Prasad am Ende des Buchs formuliert, beispielsweise ihr Rat an die US-Gesellschaft, in „Armutsbekämpfung eine Wachstumsstrategie“ zu erkennen (S. 347).
Was das Buch vermissen lässt, obwohl der Untertitel eigentlich anderes verspricht, ist eine Auseinandersetzung mit der Armut in den USA und der verbreiteten Prekarität von und durch Verschuldung, die sich über eine genauere Betrachtung von Schuldendifferenz fassen ließe.[6] Plausibel ist hingegen Prasads Plädoyer für einen stärkeren Fokus der vergleichenden politischen Ökonomie auf die Geschichte des starken Staates, wobei Pfadabhängigkeiten der Regulierung herauszuarbeiten wären. Dabei kämen auch die Ambivalenz der Maßnahmen und Regulierungen und der in ihnen verwobene im- wie explizite Rassismus zum Vorschein und könnten historisch weiter zurückverfolgt werden. So wäre die Genealogie der von Prasad fokussierten Agrarier beispielsweise bis zum Ende des 18. Jahrhunderts zu verlängern, als sich weiße Sklavenhalter in den USA eine Verfassung gaben, die nicht zuletzt ihren Eigentumsinteressen dienen sollte. Dieser Gedanken kann aber den positiven Gesamteindruck vom Buch in keinem Falle schmälern. Es liegt ein instruktives Buch zur Sozialgeschichte von Steuern und Kredit in den USA vor, das dem deutschsprachigen Publikum (auch) zum Verständnis von Geschichte und Gegenwart des Finanzkapitalismus in den USA sehr zu empfehlen ist.
Wie sich die jüngsten Massenentlassungen von Angestellten der Bundesbehörden durch die gegenwärtige Exekutive in diese Geschichte des US-Bundesstaates und seiner Kraft einordnen lässt, müsste wahrscheinlich Thema eines noch zu entwerfenden Kapitels in The Land of Too Much sein. Dieses Kapitel könnte am Ende leider auch kaum ferner von Monica Prasads politischem Plädoyer von 2012 enden, als sie – mit der Finanzkrise im Rücken – noch dafür plädierte in der Armutsbekämpfung in den USA eine Wachstumsmöglichkeit zu erkennen.
Fußnoten
- Dies korrespondiert mit Jefferson Cowies These von einer Great Exception, welche die wohlfahrtsstaatliche Bundespolitik von den 1930er-Jahren an im Kontext der US-Sozialpolitik darstellte. Allerdings ist der von Prasad zu Recht hervorgehobene Exzeptionalismus des progressiven Steuersystems mit seinen Anreizen und dem Mangel an bundesweiten Einkommenssteuern zur Verstetigung der Sozialpolitik des New Deal hierin nicht berücksichtigt. Vgl. Jefferson Cowie, The Great Exception: The New Deal and the Limits of American Politics, Princeton, NJ 2017. Vgl. zur Frage der Armut auch Frank Stricker, Why America Lost the War on Poverty. And How to Win It, Chapel Hill, NC 2011.
- Monica Prasad, The Land of Too Much. American Abundance and the Paradox of Poverty, Cambridge, MA 2012.
- Vgl. hierzu etwa Keeanga-Yamahtta Taylor, Race for Profit. How Banks and the Real Estate Industry Undermined Black Homeownership, Chapel Hill, NC 2019. Etwas breiter und stärker rechtsgeschichtlich argumentiert Cheryl I. Harris, Whiteness as Property, in: Harvard Law Review 106 (1993), 8, S. 1707–1791.
- Christopher Howard, The Hidden Welfare State: Tax Expenditures and Social Policy in the United States, Princeton, NJ 1999.
- Greta R. Krippner, Capitalizing on Crisis. The Political Origins of the Rise of Finance, Cambridge, MA 2011.
- Felix Krämer, Leben auf Kredit. Menschen, Macht und Schulden in den USA vom Ende der Sklaverei bis in die Gegenwart, Frankfurt am Main 2024.
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Karsten Malowitz.
Kategorien: Arbeit / Industrie Europa Geld / Finanzen Geschichte Gesellschaft Gruppen / Organisationen / Netzwerke Kapitalismus / Postkapitalismus Konsum Normen / Regeln / Konventionen Politische Ökonomie Recht Soziale Ungleichheit Sozialpolitik Wirtschaft
Zur PDF-Datei dieses Artikels im Social Science Open Access Repository (SSOAR) der GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gelangen Sie hier.
Empfehlungen
Made in Germany
Rezension zu „Dreihundert Männer. Aufstieg und Fall der Deutschland AG“ von Konstantin Richter
Das Ende der Arbeit, wie wir sie kannten
Rezension zu „Arbeit in der modernen Gesellschaft. Eine Einführung“ von Heiner Minssen
McKinsey & Co. und das „Gute“ im Kapitalismus
Rezension zu „Schwarzbuch McKinsey. Die fragwürdigen Praktiken der weltweit führenden Unternehmensberatung“ von Walt Bogdanich und Michael Forsythe
