Felix Esch | Rezension | 10.10.2025
Der Ordo der Austerität
Rezension zu „Die Ordnung des Kapitals. Wie Ökonomen die Austerität erfanden und dem Faschismus den Weg bereiteten“ von Clara E. Mattei
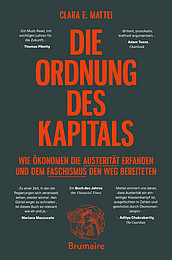
Vor gut 16 Jahren rechtfertigte die CDU-Mandatsträgerin Antje Tillmann die Einführung der Schuldenobergrenze des Fiskus im Bundestag mit den Worten: „Schuldenbegrenzung ist Sozialpolitik, weil gerade die Schwachen darauf angewiesen sind, dass der Staat seinen Verpflichtungen jederzeit nachkommen kann.“[1] Gregor Gysi, damals wie heute Abgeordneter der Partei Die Linke, entgegnete Tillmann: „Sie tun so, als ob das Geld, das dem Bund zur Verfügung steht, aus Gottes Hand käme. Tatsächlich entscheidet aber der Gesetzgeber über die Höhe der Steuern und damit auch über die Einnahmen des Staates.“[2] Knapp fünf Monate später wurde die Schuldenbremse im Grundgesetz verankert, die Frage nach den parlamentarischen Gestaltungsmöglichkeiten der Fiskalpolitik beantwortete sich damit durch die Verfassung. Die Geschichte der Schuldenbremse ist bekanntlich eine Geschichte der krisenbedingten Ausnahme- und Sondervermögen, die – mit dem letztlich regierungsstürzenden Urteil aus dem Winter 2023 – ihr Ende in einer verfassungsgerichtlichen Intervention in den politischen Auslegungsspielraum fand.[3] Wenn nicht „Gottes Hand“, wie Gysi sagt, über das Ausmaß der Staatsausgaben verfügt, so doch die vorgeblich ‚unsichtbare Hand‘ aus Karlsruhe.
Die Entscheidung über die Staatsverschuldung – und da geht es letztlich um die Bedingungen der politischen Frage schlechthin: Wem wieviel? – der Verfassung zu übertragen und damit dem Bereich des Politischen zu entziehen, erzwingt aber nicht erst seit dieser bundesrepublikanischen Episode den lautstark geäußerten Anschlussverdacht, dass die Entpolitisierung unmittelbar politischer Fragen selbst eine politische Maßnahme ist. In ihrem nun auf Deutsch erschienenen Buch Die Ordnung des Kapitals zeichnet die Ökonomin Clara Mattei den Präzedenzfall dieser Auseinandersetzung mit bestechender Klarheit nach: „Indem dieses Buch die Geschichte des Wiederaufbaus nach dem Ersten Weltkrieg durch die Linse der Austerität erzählt, hat es gezeigt, dass Austerität eine ausgeklügelte Übung in Klassenherrschaft war und ist.“ (S. 550) Wohlgemerkt einer Klassenherrschaft, die „dem Faschismus den Weg bereitete“, wie es im Untertitel des Buches heißt.
Auf rund 560 Seiten beschreibt die Professorin für Wirtschaftswissenschaften an der University of Tulsa in zwei Teilen à vier und sechs Kapiteln, wie die militärischen Notwendigkeiten des Ersten Weltkriegs die bis dato weitgehend naturalisierte ökonomische Ordnung straffer Staatshaushalte in Italien und England erstmals infrage stellten. Im Anschluss daran kämpften in beiden Ländern unterschiedliche Gruppen um diesbezügliche Deutungs- und Gestaltungsmacht. Der erste Teil widmet sich dem Krieg und den daraus entstehenden ideologischen und handfesten Kämpfen um die verteilungspolitische Hegemonie zwischen dem Staat und den erstarkenden Arbeiterbewegungen. Als Sieger gingen im Folgejahrzehnt, so die Autorin im zweiten Teil, die britischen und italienischen „internationalen Technokraten“ hervor, ihre „Erfindung der Austerität“ zeichnet Mattei diskursanalytisch nach. Einzig im vorletzten Kapitel untermauert sie, weil sie „als Ökonomin nicht anders kann“ (S. 36), ihr Argument der Dienstbarkeit der Austerität für Partikularinteressen mit Wirtschaftsstatistiken.
Schüsse auf das ökonomische Dogma
Matteis These ist die Folgende: Avancierte die politische Ökonomie seit dem späten 17. Jahrhundert sukzessive zur neuen Heilslehre und verschob die neue Verteilungsordnung unter den Vorzeichen von Privateigentum und Lohnverhältnis in den Bereich des politisch Unberührbaren, so wurde diese Unantastbarkeit im Verlauf des Ersten Weltkriegs, in dem „der Staat seine früheren Handlungsgrenzen“ (S. 45) sprengte, offen in Zweifel gezogen. Adam Smiths „invisible hand“ der „Providence“, durch die sich die Verteilungsungleichheiten kontinuierlich austarieren sollten,[4] wurde aufgrund kriegswirtschaftlicher Eingriffe in den Preismechanismus deutlich sichtbar. Erscheinen die Wahrheiten der Ökonomie aber einmal als bloße Definitionssache der Politik, geht es nicht länger darum, ehernen Marktgesetze zu folgen, sondern um die Frage, welche konkrete sichtbare Hand die Verteilungshoheit zu ergreifen vermag: Zuerst, so Mattei, waren das in England und Italien, ihren beiden Fallbeispielen, die Arbeiterbewegungen, deren Erfolge aber bald eine aggressive Konterrevolution der Austeritätsökonomen nach sich zogen.
Im Laufe des Ersten Weltkriegs löste sich die klare Trennung zwischen Politik und Wirtschaft auf und es entstand ein staatliches Interesse an Produktion, Privateigentum und Lohnverhältnis. In Italien und England übernahm der Staat die Kontrolle der Privatbetriebe des Primär- bis Tertiärsektors (S. 56 f.), er scheute sich nicht davor, Land zu beschlagnahmen (S. 59), und verurteilte das Fernbleiben von Beschäftigten in den italienischen „Fabrikkasernen“ nach Maßgabe des Kriegsrechts als Desertation (S. 64). Während des Krieges und in den unmittelbaren Nachkriegsjahren, insbesondere 1919/1920 im italienischen Biennio Rosso, aber auch in Großbritannien, erlangten die oft kriegsaversen (S. 181) Arbeiterbewegungen so weitreichende Zustimmung und Deutungshoheit wie sonst nur in Sowjetrussland und -ungarn (S. 213). Streiks von nie dagewesenem Ausmaß, die Durchsetzung des Achtstundentags sowie Stimmrechtserweiterungen für Frauen und Ungelernte stürzten das „alte System in eine ausgewachsene Krise“ (S. 168).
Eine manifeste Krise – das liegt bekanntlich in ihrem Begriff – fordert zur Entscheidung auf: „Entweder überwinden die Organisationen des Volkes die kapitalistischen Verhältnisse oder die herrschende Klasse stellt ihre Herrschaft wieder her. Die Austerität diente letzterem Ziel.“ (S. 215) So war also das „Hauptziel der Austerität die Entpolitisierung des Ökonomischen – oder die Wiederherstellung einer Trennung zwischen Politik und Wirtschaft“ (S. 232). Um Verteilungsfragen wieder dauerhaft in die mehr oder weniger unsichtbaren Hände einer kleinen Gruppe von Ökonomen zu legen, musste diese Ordnung von einer Aura der Unantastbarkeit umgeben sein: Presse-, Versammlungs-, politische und Meinungsfreiheit waren dabei nur hinderlich. So erklärt sich auch, wie Mattei zeigt, die in vielen Ländern zu beobachtende Dankbarkeit und Unterstützung des internationalen „liberalen Establishments“ angesichts der darauffolgenden brutalen, autoritären Durchsetzung der neuen austeritätsgeprägten Ökonomie vermittels Repressionen(S. 453–460).
Faschismus und Austerität
Matteis Hauptanliegen ist es, einen konkreten Augenblick in der Geschichte der Verteilungsfrage zu beleuchten und den Beitrag herauszustellen, den die Verabsolutierung des Herrschaftswissens in ebendiesem Moment für die Entstehung des historischen Faschismus leistete. Die „intellektuelle Vorgeschichte der heutigen Mainstream-Ökonomik“ war nicht die „einzige Triebfeder für die faschistische Wirtschaftspolitik der 1920er Jahre“, aber – neben dem Nationalismus und der Industriepolitik – doch eine entscheidende, die bisher unzureichend beleuchtet wurde (S. 361). Mit beeindruckender, bisweilen aber auch erschöpfender Detailfreude zeichnet Mattei nach, wie die Ökonomen der Zwischenkriegszeit das Austeritätsprinzip zur Begrenzung der verteilbaren Güter installierten und es dabei immer wieder explizit mit der „Zähmung des Menschen“ begründeten (S. 375 und S. 521).
Theoretisch interessant ist dabei die von Mattei skizzierte Abkehr von einer politisch-ökonomischen, vormals philosophischen Denkweise, die den Arbeiter und dessen Arbeitskraft ins Zentrum der Warenwertfrage stellt. Stattdessen entwickelten Ökonomen wie Maffeo Pantaleoni eine Preistheorie, in der sie „die Arbeit wie jede andere Ware als eine Sache ansahen, deren Preis ausschließlich durch Angebot und Nachfrage bestimmt wird“ (S. 400). Vorläufer dieser Ansicht gab es bereits vor der Genese der klassischen Arbeitswerttheorie im 17. Jahrhundert, mit dem Abdanken Letzterer seit dem späten 19. Jahrhundert gewann sie wieder an Stärke, was sich beispielsweise an der Einberufung Pantaleonis in den Senat Mussolinis zeigte.[5]
Ideologienpluralismus und Kritik
Die Ordnung des Kapitals ist als fundierte Ideologiekritik der Sparsamkeitsdoktrin ein wichtiges Buch. Allerdings muss es sich die Frage nach seiner Haltbarkeit gefallen lassen: „Die heutige Allgegenwart des Kapitalismus“, schreibt Mattei einleitend, „hat zur Folge, dass Kritik am Kapitalismus oder auch nur seine Beobachtung seltsam erscheinen können.“ (S. 25) Stimmt das? Wem – vor allem, aber nicht nur an den Universitäten – erscheint heute die Kritik am Kapitalismus seltsam? Die Kritik an Kapitalismus und Austerität scheint vielmehr so omnipräsent wie die Phänomene selbst. An wen, gerade wenn Mattei keine „selektive oder gar parteiische Erzählung“ (S. 36) bezweckt, richtet sich dann das Buch?
Im Jahr 1736, wenige Jahrzehnte bevor Smith seine Idee der „invisible hand“ als behelfsmäßige Ersatzideologie für die erschütterte Heilslehre der Vorzeit vorstellte, publizierte der englische Philosoph und Theologe George Berkeley einen „Discourse Addressed to the Magistrates and Men in Authority“. Seitenlang beklagte er darin den Verfall der göttlichen Ordnung und schloss mit der Sorge: „The age of monsters is not far off.“[6] Bald zwei Jahrhunderte später zerbröselte das ökonomische Surrogat der göttlichen Ordnung zum ersten Mal unter dem Druck des Ersten Weltkriegs. In Reaktion darauf erkoren die Ökonomen die Austerität erneut zur Gottheit, in einem historischen Augenblick, den Gramsci – Mattei zitiert ihn immer und immer wieder als „Spiegel des revolutionären Geistes“ (S. 185) – in seinen Gefängnisheften als jenen Zeitraum bezeichnet, in dem das „Alte noch nicht gestorben ist und das Neue noch nicht geboren werden kann“. In diesem Interregnum, so Gramsci weiter, „treten die unterschiedlichsten Krankheitserscheinungen auf“. Wieder ein knappes Jahrhundert später, unter dem Eindruck der Finanzkrise 2007 ff. und ihren Austeritätsfolgen, zitierte der Eklektiker Slavoj Žižek diesen Satz Gramscis.[7] Doch er veränderte ihn entscheidend, indem er nicht mehr von Krankheitserscheinungen, sondern von der „time of monsters“ sprach.[8] Vielleicht redete er Berkeley bewusst zu jenem Zeitpunkt das Wort, an dem die Sakralisierung der Fiskalpolitik einen neuen Höhepunkt erlebte. Der politische Impetus ihrer Apologeten wird mindestens all jenen schon offenbar sein, die so gut recherchierte Bücher wie dieses von Clara Mattei zur Kenntnis nehmen.
Fußnoten
- Bundestag, 16. Wahlperiode, 215. Sitzung, 27.3.2009, 23367 [17.7.2025].
- Bundestag, 16. Wahlperiode, 215. Sitzung, 27.3.2009, 23369 [17.7.2025].
- Sebastian Huhnholz, Austerität und Ausnahme. Die Politik der Staatsausgaben nach der Karlsruher Entscheidung, in: Merkur 78 (2024), 3, S.5–19.
- Adam Smith, Theory of Moral Sentiments [1759], New York 2009, S. 215 (dt. Fassung: ders., Theorie der ethischen Gefühle, hrsg. von Horst D. Brandt, übers. von Walther Eckstein, Hamburg 2010).
- Ein side quest Matteis sollte in diesem Zusammenhang ebenfalls Erwähnung finden: Mit großem Nachdruck rückt sie Luigi Einaudi in ein neues Licht. Einaudi war der erste italienische Präsident nach dem Ersten Weltkrieg, der Verlag seines Vaters gibt heute unter anderem die Werke Antonio Gramscis und Giorgio Agambens heraus. Seine Flucht vor dem Faschismus 1943 scheint ihn in den Augen der italienischen Öffentlichkeit von allen früheren Sünden reinzuwaschen (S. 367 f.). Tatsächlich aber gebe es, so arbeitet Mattei heraus, wenig „ideologische[] Unterschiede“ zwischen dem „vermeintlich liberaleren Einaudi“ und den anderen, teils bekennend faschistischen Ökonomen seiner Zeit (S. 368, S. 380 und S. 385). Einaudi war es, der die „Anhäufung von Reichtum“ über jedes „Ziel der sozialen Gerechtigkeit oder einer egalitäreren Umverteilung des Reichtums“ stellte (S. 390). Überzeugungen, die Mussolini in den 1920er-Jahren in Form von fiskalischer und industrieller sowie monetärer Austerität staatlich durchsetzte (S. 359).
- George Berkeley, A Discourse Addressed to the Magistrates and Men in Authority, in: ders., Works of George Berkeley, Bd. 4: Miscellaneous Works, 1707–1750, hrsg. von Alexander Campbell Fraser, Oxford 1901, S. 483–506, hier S. 506.
- Slavoj Žižek, Living in the Time of Monsters, in: Critical Pedagogy (2012), 422, S. 32–44, hier S. 43 f.
- Ein kurzer Blick in die Begriffsgeschichte von Monster [2.6.2025] auf Wikipedia ist in diesem Kontext sehr aufschlussreich.
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Henriette Liebhart.
Kategorien: Arbeit / Industrie Kapitalismus / Postkapitalismus Politik Politische Ökonomie Wirtschaft
Empfehlungen
Deutschlands Wege in die Moderne
Rezension zu „From Old Regime to Industrial State. A History of German Industrialization from the Eighteenth Century to World War I“ von Richard H. Tilly und Michael Kopsidis
Armut, Steuern und Schulden in den USA
Rezension zu „Im Land des Überflusses“ von Monica Prasad
