Philip Manow | Rezension | 04.04.2023
Die neue Multi-Elitenherrschaft
Rezension zu „Political Cleavages and Social Inequality. A Study of Fifty Democracies, 1948–2020” von Amory Gethin, Clara Martínez-Toledano und Thomas Piketty (Hg.)
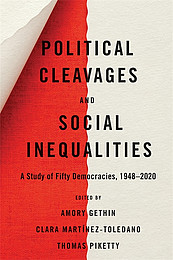
Wenn eine Gruppe von Ökonomen die immense Bedeutung politischer Repräsentation für Demokratie und Ungleichheit betont und damit ihre eingehende Untersuchung des Beitrags historisch gewachsener Parteiensysteme zur Politisierung oder Entpolitisierung des Klassenkonflikts begründet – welcher Politikwissenschaftler würde ihnen da widersprechen wollen?
Mit dieser Fragestellung ist das Forschungsinteresse der jüngsten Publikation aus dem Hause Piketty präzise benannt. Darin untersuchen die Autoren den Zusammenhang zwischen verschiedenen Spielarten der Ungleichheit – operationalisiert entweder als Einkommens-, Vermögens- oder als Bildungsungleichheit – und dem Wahlverhalten in fünfzig nach einem recht großzügigen Schema als „Demokratien“ klassifizierten Ländern seit dem Zweiten Weltkrieg, wobei andere wichtige Determinanten des Wahlverhaltens wie Beruf, Geschlecht, Alter, Religion, Herkunft, ethnische Zugehörigkeit, Stadt/Land oder Kohortenzugehörigkeit von ihnen ebenfalls berücksichtigt werden.
Folgerichtig referieren die Autoren erst einmal seitenlang die einschlägige politikwissenschaftliche Forschung zu den Spaltungslinien moderner Gesellschaften und erläutern, wie sich diese in je spezifische Parteiensysteme übersetzt haben, die dann die gesellschaftlichen Konflikte auf ihre je eigene Art prozessieren. Was für die drei Ökonomen ein wahrer Augenöffner zu sein scheint, dürfte für Politikwissenschaftler weitgehend vertrautes Terrain sein. Nach einem Überblickskapitel, das den großen Bogen spannt, die theoretischen Bezüge herstellt und erste übergreifende Befunde konstatiert, werden in 18 weiteren Kapiteln – mal in Einzelländerstudien, zumeist jedoch in Analysen von kleinen Gruppen ‚verwandter‘ Länder – die empirischen Befunde vorgestellt. Die Darstellung, die sich insbesondere auf die im Zeitverlauf variierende unter- oder überdurchschnittliche Wahlneigung für linke Parteien konzentriert, ist dabei im Wortsinne erschöpfend: Die Autoren präsentieren Liniendiagramm um Liniendiagramm und Balkendiagramm um Balkendiagramm zum Wahlverhalten bestimmter Gesellschaftsgruppen – von Männern im Vergleich zu Frauen, von denen mit hohem Bildungsabschluss im Vergleich zu denen mit niedrigem, von Menschen mit Migrationshintergrund im Vergleich zu denen ohne, von Vermögenden im Vergleich zu den weniger Vermögenden etc. pp.
Ihre Daten bezieht diese sozialwissenschaftliche Grundlagenforschung aus der umfassenden, vereinheitlichten und öffentlich zugänglichen World Political Cleavages and Inequality Database (WPID), die in einer konzertierten Großanstrengung aus hunderten von nationalen, seit den 1950er-Jahren erhobenen Nachwahlbefragungen gewonnen wurde. Derart informiert wollen Piketty und seine beiden Ko-Autoren die ebenso basale wie zentrale Frage beantworten, wo und wann denn nun genau eher „Klasse“ oder eher „Identität“ für das Wahlverhalten bestimmend geworden ist – und dies, wie die Autoren wiederholt betonen, zunächst in explorativer, nicht explanativer Absicht. Das Motiv hinter dieser großen und nicht genug zu lobenden empirischen Anstrengung ist offenkundig: Vor dem Hintergrund der in Pikettys Weltbestseller Capital in the Twenty-First Century entwickelten Diagnose eines säkularen Trends steigender (vor allem:) Vermögensungleichheit stellt sich die Frage, warum die gewachsene wirtschaftliche Ungleichheit nur manchmal und nur mancherorts politisch virulent wurde. Will man nicht das beliebte Passepartout des ‚falschen Bewusstseins‘ bemühen – „Gewinnen soll immer die Puppe, die man ,historischen Materialismus‘ nennt“ (Walter Benjamin) –, sollte man sich zur Beantwortung dieser Frage den politischen Systemen, insbesondere den Parteisystemen zuwenden.
Es gehört zu den besonders interessanten Befunden, dass die Autoren in ihren empirischen Auswertungen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts (zumindest im Westen) einen viele unterschiedliche Länder übergreifenden Trend beobachten, der – so eine der Hauptthesen des Buches – eine Transformation des Wahlverhaltens anzeigt und schließlich zu dem führte, was Piketty und seine Mitstreiter „Multi-Eliten-Parteiensysteme“ nennen. Diese neuen Parteiensysteme würden – zumindest gegenwärtig noch – von zwei Arten von Parteien dominiert, die vornehmlich zwei Arten von Eliten repräsentieren, nämlich eine im Mitte-links-Spektrum verankerte Bildungselite und eine im Mitte-rechts Spektrum beheimatete Einkommenselite. Komplementär dazu hätten jene Bevölkerungsgruppen mit unterdurchschnittlicher Bildung und unterdurchschnittlichem Einkommen, die in den 1950er- und 1960er-Jahren noch das traditionelle Klientel linker (vor allem sozialdemokratischer, aber auch sozialistischer oder kommunistischer) Parteien bildeten, sich nun von ebendiesen Parteien ab- und zu großen Teilen der Neuen Rechten zugewandt. Der grundlegende Wandel habe sich dabei auf der Bildungsdimension vollzogen. Während das konservative voting with the purse der Vermögenden weitgehend unverändert geblieben sei, habe sich die Bildungselite im Laufe der Zeit eindeutig nach links orientiert. (Vielleicht könnte man das auch so sagen: Erst im Laufe der Zeit haben sich ‚Bildung und Besitz‘ stärker ausdifferenziert.) Allerdings, so die Autoren, hätten die Angehörigen der Bildungselite dabei die Interessen der vormaligen Wähler linker Parteien zunehmend aus den Augen verloren. In dieser neuen Konstellation, so das mehr implizite als explizierte Argument, würde die politische Artikulation des Klassengegensatzes daher eher unterdrückt als forciert. Man sieht: Das Gespenst des falschen Bewusstseins kehrt, wie das Gespenster halt so zu tun pflegen, doch wieder zurück. Und mit dem Befund, der Klassenkonflikt sei ja nie tot gewesen, sondern momentan nur – zumindest im Westen – lebendig begraben, sind wir endgültig in der Metaphernwelt der Schauerromantik angelangt.
Im Zentrum des Befundes stehen die beiden neuen ,Kasten‘ der Brahmin Left und der Merchant Right, die eine eine Bildungs-, die andere eine Wirtschaftskaste, jedoch vereint in ihrer Vernachlässigung bis hin zur offenen Verachtung der unteren Schichten. Zwischen den Zeilen und in den Fußnoten findet man hier viel argumentative und empirische Unterstützung für Diagnosen, die eine illustre Autorenschaft von Mark Lilla bis Wendy Brown (oder Bernd Stegemann) mit je unterschiedlichen Akzentuierungen auch schon getroffen hat, jedoch ohne Rückgriff auf eine derart umfangreiche systematische Datenbasis. Ist die Diagnose nun auch nicht grundstürzend neu – abgesehen vielleicht von der Operationalisierung von Ungleichheit auch als Bildungsungleichheit und der verwendeten Begrifflichkeit –, so erlaubt die (erneut sehr positiv hervorzuhebende) gewählte Perspektive, die nicht nur die entwickelten westlichen Industrienationen in den Blick nimmt, die interessante Beobachtung, dass wir jenseits der westlichen Welt eher die Rückkehr oder schlicht die Intensivierung des Klassenkonflikts erleben.
Das ist alles sehr erhellend, sehr klar, nüchtern, transparent und schnörkellos argumentiert, auch sehr erfrischend in seinem ganz direkten und systematischen Empiriebezug und dem weitgehenden Verzicht auf ökonometrischen Ballast. Political Cleavages and Social Inequalities ist daher ohne Frage ein eminent lesbares Buch. Es bleibt aber fraglich, ob damit nun alle Unklarheiten beseitigt und die Gründe für das aktuelle Elend der politischen Linken zutreffend benannt sind. Eine Stärke ihrer Diagnose sehen die Autoren in dem Umstand, dass der von ihnen konstatierte komplementäre Trend, dem zufolge sich die unteren Einkommens- und Bildungsschichten nun der Neuen Rechten zuwenden, ganz unabhängig vom politischen System, seiner Historie und den durch sie geprägten Spaltungslinien vollzieht: in den tiefgreifend vom race cleavage geprägten USA mit ihrem Zweiparteiensystem ebenso wie in den ja in dieser Hinsicht ganz anders geprägten westeuropäischen Mehrparteiensystemen.
Sicher können unterschiedliche Faktorenkombinationen zu ähnlichen Outcomes führen; aber zuweilen sollte man auch einfach die Varianz noch etwas genauer in den Blick nehmen. Einige kritische Einwände gegen ihre Diagnose müssen sich die Autoren zumindest gefallen lassen. So greifen sie dort, wo sie es doch einmal wagen, die vorfindbaren Trends zu erklären und nicht nur zu beschreiben, mehr oder weniger ad hoc auf bekannte Versatzstücke aus der Literatur zurück, etwa auf Ingleharts Argument von der Werterevolution, die seit den späten 1960er-Jahren zur Kulturalisierung politischer Konflikte geführt habe, oder auf das Argument von der diskursiven Hegemonie des Neoliberalismus, unter dem sowohl die Brahmin-Left als auch die Merchant-Right recht gut gelebt hätten, diejenigen mit geringerem Bildungsstatus und geringerem Einkommen hingegen weit weniger gut. Das sind recht pauschale Argumente, die gerade die je besonderen Spaltungslinien in den Parteiensystemen der untersuchten Demokratien ignorieren – und damit eben auch die Varianz hinsichtlich der eher sozio-ökonomisch oder der stärker sozio-kulturell geprägten Dimension der Politisierung. Und vom Neoliberalismus haben – je nach Beschaffenheit der Politischen Ökonomie – ganz unterschiedliche Gesellschaftsgruppen, auch untere, auf verschiedene Weise profitiert, während andere unter ihm gelitten haben. Da lassen sich für den Exportweltmeister Schweden (mit Rechtspopulismus) und für das unter China-Schock und De-Industrialisierung leidende Vereinigte Königreich (mit Rechstpopulismus) eben nicht umstandslos gleiche Kausalmechanismen annehmen. Und auch Ingleharts These von der silent revolution trägt nur wenig zur Erklärung der Trends bei, denn die relative Bedeutung von Identitätspolitik für die verschiedenen Länder ist ja eine Variable, keine Universalie. Zudem ist es nicht so, dass in den am meisten liberalisierten Ländern der kulturelle Backlash am heftigsten ausgefallen wäre, man denke nur an Polen oder Ungarn, etwa im Vergleich zu Schweden und den Niederlanden. Und schließlich formuliert sich der Protest gegen den Neoliberalismus in vielen Ländern nicht nur rechtspopulistisch, sondern auch linkspopulistisch. Auch hier trägt das Argument vom Wertewandel nur wenig zur Erklärung bei. Manchmal sind auch unsere traditionellen Eingruppierungen nach links und rechts nicht sonderlich hilfreich für das Verständnis des elektoralen Geschehens: die Migrationspolitik von Syriza und Nea Demokratia hat sich genauso wenig unterschieden wie die Fiskalpolitik von Draghi oder Meloni.
Das ist denn vielleicht auch die größte Schwäche des Buchs, dass es dort, wo es zur wichtigen Frage kommt, wie sich die unterschiedlichen Ausprägungen denn nun erklären lassen, ein komplett überraschungsfreies (Vierer-)Schema präsentiert, das allein von den identifizierten Ausprägungen selber definiert wird, also, wie man sagt, auf der abhängigen Variable sortiert. Hier haben wir dann Länder mit eindeutiger Dominanz des Klassenkonflikts auf dem einen Pol und Länder mit eindeutiger Dominanz von Identitätskonflikten auf dem anderen Pol, sodann eine Zwischenkategorie, in der beide Dimensionen irgendwie wichtig sind, und schließlich Länder, in denen die Parteiensysteme zu volatil und instabil sind, um eine eindeutige Zuordnung zu erlauben. Das bleibt leider ohne jeden intellektuellen Mehrwert. Hierzu hat die Politikwissenschaft in jüngster Vergangenheit deutlich schlauere und theoretisch versiertere Gruppierungsvorschläge gemacht,[1] die die jeweilige Prominenz der sozio-ökonomischen versus der sozio-kulturellen Dimension auch noch durch die historischen Prozesse der Parteiensysteme erklären. Piketty und seine Ko-Autoren hätten gut daran getan, auch diese Literatur noch wahrzunehmen.
Fußnoten
- Vgl. etwa Pablo Beramendi / Silja Häusermann / Herbert Kitschelt / Hanspeter Kriesi (Hg.), The Politics of Advanced Capitalism, New York u.a. 2015; Philip Manow / Bruno Palier / Hanna Schwander (Hg.), Welfare Democracies & Party Politics. Explaining Electoral Dynamics in Times of Changing Welfare Capitalism, Oxford 2018.
Dieser Beitrag wurde redaktionell betreut von Karsten Malowitz.
Kategorien: Demokratie Gesellschaft Kapitalismus / Postkapitalismus Politische Ökonomie Soziale Ungleichheit Sozialstruktur
Zur PDF-Datei dieses Artikels im Social Science Open Access Repository (SSOAR) der GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gelangen Sie hier.
Empfehlungen
Christoph Deutschmann, Hannah Schmidt-Ott
Wie geht es mit dem Wachstum bergab?
Folge 28 des Mittelweg 36-Podcasts
Nachgefragt beim Sonderforschungsbereich „Strukturwandel des Eigentums“
Fünf Fragen anlässlich der Eröffnungstagung, beantwortet von Silke van Dyk und Hartmut Rosa
